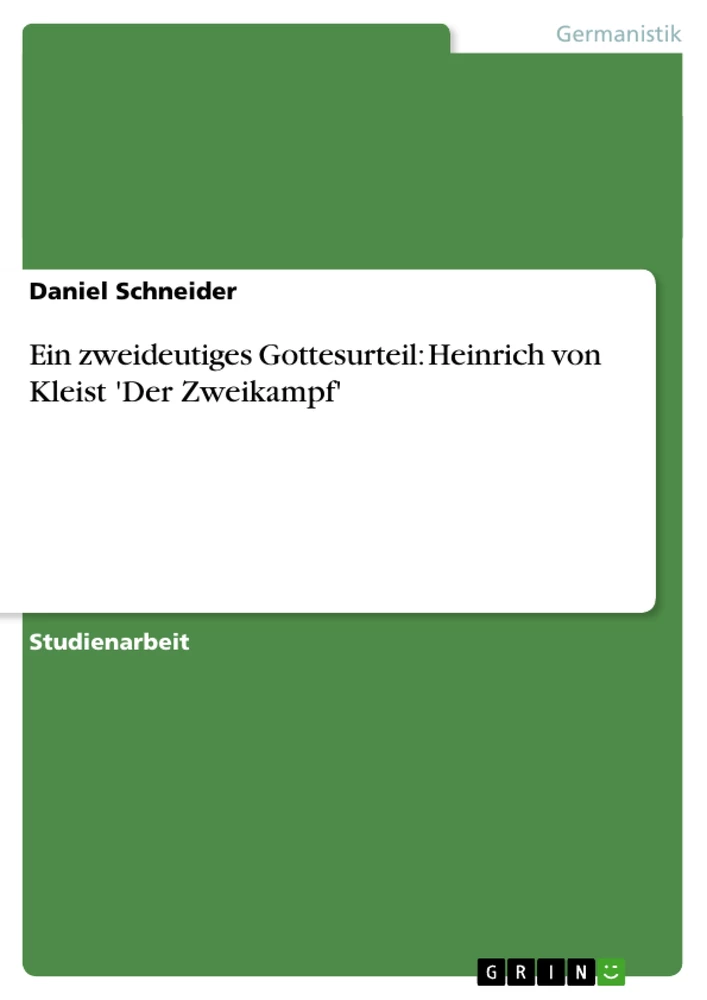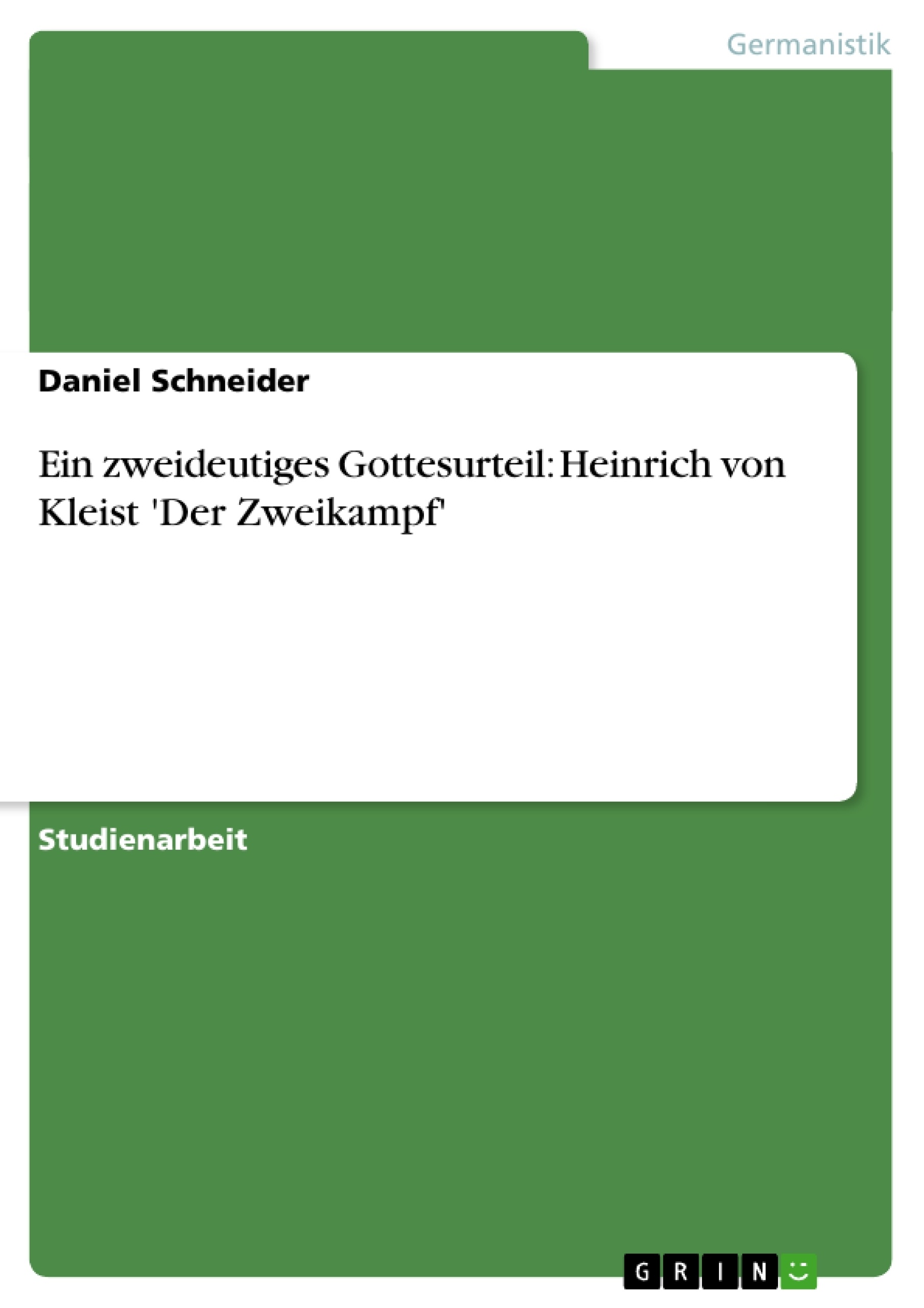„Der Zweikampf [...] hat viele treffliche Züge, aber der sonderbare Prozeß, der uns wieder hier vorgeführt wird, und der sich nur durch eine Art von Wunder entwickelt und aufklärt, interessirt uns nicht so, daß wir oft und gern zu dieser Erzählung zurückkehren sollten.“ Ludwig Tiecks kurze Bemerkung aus dem Jahre 1826 in der Einleitung zur ersten Gesamtausgabe der Werke Kleists zum Werk Der Zweikampf verdeutlicht beispielhaft die geringe Wertschätzung, die die Werke Heinrich von Kleists anfänglich erlangten. Erst seit Beginn des zwanzigsten Jahrhundert sollte Kleist, dem nun erst der Rang eines Klassikers zuerkannt wurde, für sein dichterisches Schaffen die ihm gebührende Aufmerksamkeit finden und „zu den großen deutschen Dichtern“ gezählt werden.
Die meiner neu konzipierten Arbeit zugrundeliegende Novelle Der Zweikampf war eins der letzten Werke Kleists und erschien 1811 kurz vor seinem Selbstmord in dem zweiten Band Erzählungen, der ursprünglich zusammen mit dem ersten Band den Titel Moralische Erzählungen tragen sollte. Die Gemeinsamkeit der Erzählungen auch mit denen des ersten Bandes liegt dabei in der Thematik, in dem Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit. Angeregt durch die Diskussionen im Seminar werden so auch bei meinen Ausführungen die Thematik der Wahrheitsfindung mittels des titelgebenden Zweikampfes sowie dessen Auslegung als Gottesurteil im Vordergrund stehen. Des Weiteren habe ich mich bemüht, der Kritik an meiner Erstfassung sowohl inhaltlich als auch konzeptionell gerecht zu werden. Der einleitend zu berücksichtigende Themenkomplex Ehre im Duell soll nun ebenfalls die Beziehung zwischen einem Zweikampf des 14. Jahrhunderts und einem Duell im 18. Jahrhundert explizit beleuchten. Erst danach werde ich mich dem zweideutigen Gottesurteil detailliert widmen. Grundlage hierfür wird neben den Gesprächen Friedrichs im Gefängnis mit seiner Mutter sowie mit Littegarde auch der Schluss des Textes sein, wo der Kaiser die Statuten des Gottesgerichts ändert. Die Arbeit findet ihren Anschluss in einem Resümee, das ein Gesamturteil beinhalten wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gottesurteil in Der Zweikampf
- Ehre im Duell
- Beziehung Zweikampf / Duell
- Deutung des Gottesurteils
- Friedrich und Helena
- Friedrich und Littegarde
- Relativierung des Gottesurteils
- Ehre im Duell
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Novelle „Der Zweikampf“ von Heinrich von Kleist und analysiert die zentrale Rolle des Gottesurteils im Werk. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Ehre im Duell und deren Beziehung zur Wahrheitsfindung durch den Zweikampf.
- Die Bedeutung der Ehre im Duell im 14. Jahrhundert im Vergleich zum Duell des 18. Jahrhunderts.
- Die Interpretation des Gottesurteils aus der Sicht verschiedener Protagonisten.
- Die Relativierung des Gottesurteils im Kontext der Novelle.
- Der Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit als zentrales Thema in Kleists Erzählungen.
- Die Auseinandersetzung mit der Kritik an einer Erstfassung der Arbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Novelle „Der Zweikampf“ dar und erläutert die Bedeutung des Werkes für Kleists Schaffen. Zudem wird die Relevanz der Thematik "Wahrheitsfindung durch den Zweikampf" sowie die Kritik an einer Erstfassung der Arbeit hervorgehoben. Das zweite Kapitel widmet sich dem Gottesurteil im Werk, wobei zunächst die Bedeutung der Ehre im Duell beleuchtet wird. Anschließend werden die unterschiedlichen Interpretationen des Gottesurteils durch die Figuren Friedrich, Helena und Littegarde untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themen Ehre, Duell, Gottesurteil, Wahrheitsfindung, Gerechtigkeit, Anarchie, Zweikampf, Anachronismus, Kleist, "Der Zweikampf".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Novelle „Der Zweikampf“?
Das zentrale Thema ist der Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit, der durch ein vermeintliches Gottesurteil in Form eines Zweikampfes entschieden werden soll.
Warum wird das Gottesurteil in der Novelle als „zweideutig“ bezeichnet?
Weil der Ausgang des Kampfes zunächst den Falschen als Sieger erscheinen lässt, was die Zuverlässigkeit des Gottesgerichts und die menschliche Wahrnehmung von Wahrheit in Frage stellt.
Welche Rolle spielt der Begriff der Ehre?
Ehre ist die Triebfeder für das Duell. Die Arbeit vergleicht dabei das Ehrverständnis des 14. Jahrhunderts (Handlungszeit) mit dem des 18. Jahrhunderts (Kleists Zeit).
Wie endet die Novelle in Bezug auf das Gottesgericht?
Am Ende ändert der Kaiser die Statuten des Gottesgerichts, was eine Säkularisierung und Relativierung dieser mittelalterlichen Rechtsform signalisiert.
Wie wurde Kleists Werk von seinen Zeitgenossen aufgenommen?
Anfangs erfuhr Kleist wenig Wertschätzung; Kritiker wie Ludwig Tieck bemängelten die sonderbaren Prozesse in seinen Erzählungen. Erst im 20. Jahrhundert wurde ihm der Rang eines Klassikers zuerkannt.
- Citation du texte
- Daniel Schneider (Auteur), 2003, Ein zweideutiges Gottesurteil: Heinrich von Kleist 'Der Zweikampf', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29497