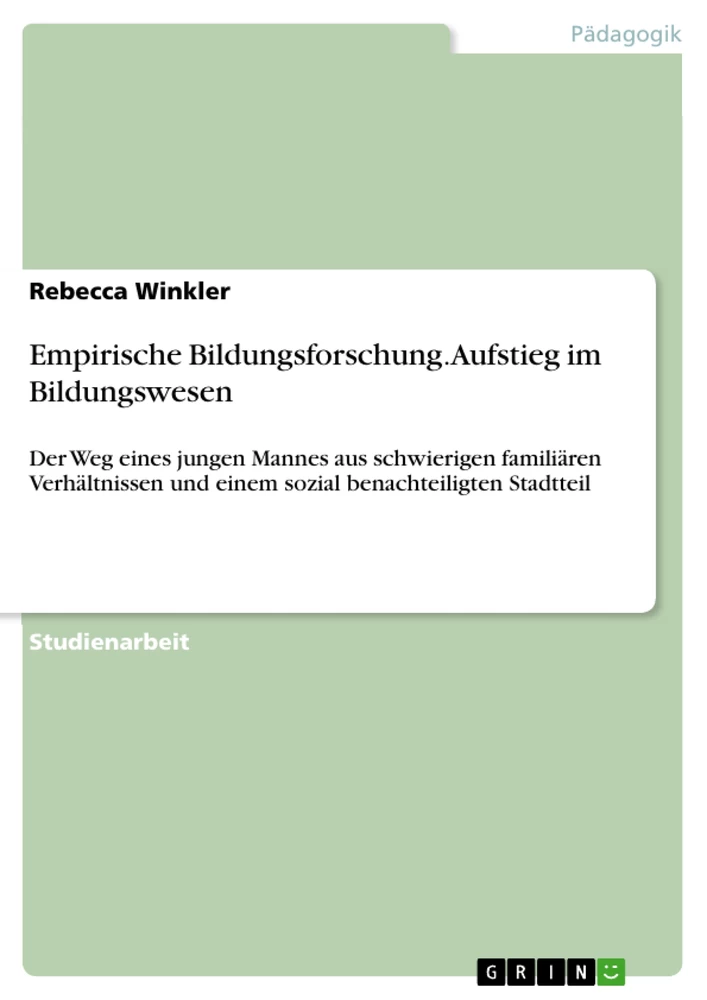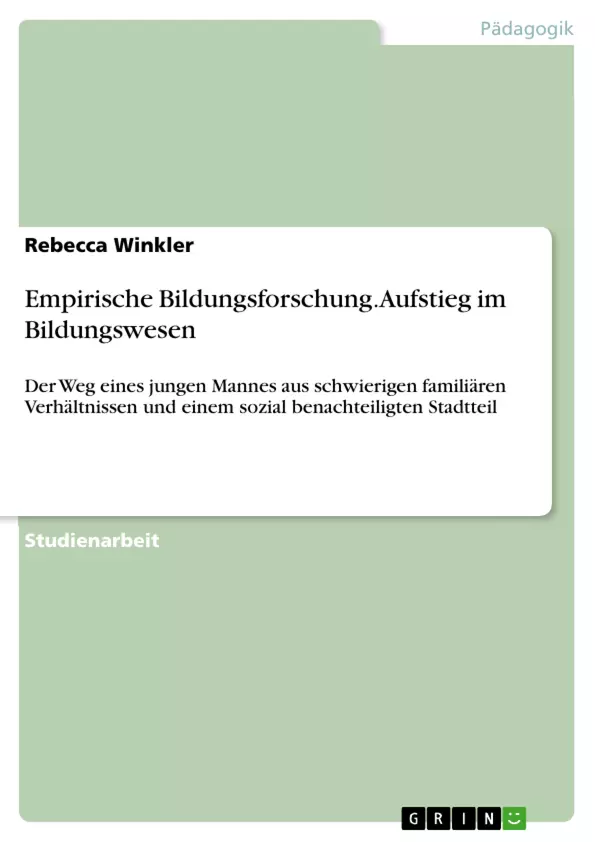In Deutschland verlassen jährlich mehr als 50.000 junge Erwachsene die Schule ohne einen Hauptschulabschluss und mehr als 1,5 Mio. Menschen zwischen 25 und 34 Jahren gelingt es nicht, einen Ausbildungsabschluss zu erwerben. Das Problem lässt sich in vielen Fällen auf eine fehlende Chancengleichheit zurückführen. Ob jemand in der Schule erfolgreich ist, hängt oft vom jeweiligen familiären Hintergrund ab. Bedeutet Armut demzufolge ein erhöhtes Bildungsrisiko für Kinder und Jugendliche?
Man spricht von primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft, welche die Bildungschancen beeinflussen. Kinder aus höheren sozialen Schichten werden durch gezielte Förderung, Erziehung und Ausstattung besser auf die Ansprüche der Schule vorbereitet als Arbeiterkinder und können somit bessere Schulleistungen verbuchen. Zum anderen werden die Bildungsentscheidungen häufig abhängig von den ökonomischen Ressourcen der Familien gefällt, weshalb Kinder aus Arbeiter- oder Erwerbslosenfamilien seltener eine weiterführende Schule besuchen. (vgl. Becker, Lauterbach 2010, S. 16) Selbst die wenigen Jugendlichen, die trotz ihrer sozialen Benachteiligung eine Hochschulberechtigung erlangen, nehmen seltener ein Studium auf. Auch ein Zusammenhang zwischen Studienabbruch und sozialer Herkunft lässt sich in vielen Fällen erkennen.
Dennoch gibt es einige Jugendliche die diese ungleichen Chancen überwinden und denen ein Aufstieg von “unten nach oben“ in der Sozialstruktur gelingt. Mit einem jungen Mann, der diesen Fortschritt geschafft hat, wurde für diese Hausarbeit ein narratives Interview geführt und ausgewertet. Dazu wurden zunächst drei Hypothesen sowie die Forschungsfrage gebildet, an der sich das Interview orientiert. Um aufzuzeigen warum Bildungsaufsteiger einen erschwerten Weg vor sich haben, wurde für den theoretischen Rahmen die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu gewählt, die anschaulich vermitteln soll, wie die soziale Herkunft den Menschen beeinflusst. Das narrative Interview wurde mit einem jungen Mann geführt, der aus einem familiär benachteiligten Haushalt stammt und in einem sozial schwachen Stadtteil Berlins aufgewachsen ist. Die Auswertung wurde nach dem Verfahren von Schütze durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Darstellung des Theorierahmens der Arbeit
- Forschungsstand
- Forschungsdesign und Methodenwahl
- Forschungsfrage
- Hypothesen
- Empirischer Teil
- Das narrative Interview
- Feldzugang
- Narrative Auswertung nach Schütze
- Datenauswertung
- Formale Textanalyse
- Strukturelle inhaltliche Beschreibung
- Analytische Abstraktion
- Wissensanalyse
- Interpretation der Ergebnisse
- Modifizierung der Hypothesen
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Datenerhebung
- Transkriptionsregeln
- Transkript
- Datenauswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Bildungsaufstieg eines jungen Mannes aus einem sozial benachteiligten Umfeld. Ziel ist es, die Herausforderungen und Faktoren zu untersuchen, die mit dem Aufstieg aus schwierigen familiären Verhältnissen und einem sozial benachteiligten Stadtteil verbunden sind. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen des Probanden im Bildungssystem und beleuchtet die Rolle der sozialen Herkunft und des Habitus im Bildungsprozess.
- Soziale Ungleichheit im Bildungssystem
- Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungschancen
- Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu
- Narrative Analyse von Bildungserfahrungen
- Bildungsaufstieg und soziale Mobilität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Bildungsaufstiegs ein und stellt die Relevanz des Themas anhand von Statistiken über Schulabbrecher und fehlende Ausbildungsabschlüsse dar. Sie beleuchtet die Problematik der sozialen Ungleichheit im Bildungssystem und die Auswirkungen der sozialen Herkunft auf Bildungschancen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen vor, die im Laufe der Arbeit untersucht werden.
Der theoretische Teil der Arbeit präsentiert die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu als theoretischen Rahmen. Die Kapitaltheorie erklärt, wie die soziale Herkunft den Habitus eines Menschen prägt und somit seine Bildungschancen beeinflusst. Die verschiedenen Kapitalarten (ökonomisches, kulturelles, soziales Kapital) werden erläutert und ihre Bedeutung für die soziale Positionierung und die Reproduktion sozialer Ungleichheit wird hervorgehoben.
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die Durchführung des narrativen Interviews mit dem Probanden. Die Methode der narrativen Auswertung nach Schütze wird vorgestellt und die Datenauswertung wird erläutert. Die Analyse der Erzählung des Probanden soll Aufschluss über seine Bildungserfahrungen und die Herausforderungen geben, die er im Bildungssystem bewältigen musste.
Die formale Textanalyse untersucht die Struktur und den Inhalt der Erzählung des Probanden. Die Analyse umfasst die strukturelle inhaltliche Beschreibung, die analytische Abstraktion und die Wissensanalyse. Diese Analyse soll die zentralen Themen und Botschaften der Erzählung herausarbeiten und die Bedeutung der Bildungserfahrungen für den Probanden beleuchten.
Die Interpretation der Ergebnisse befasst sich mit der Beantwortung der Forschungsfrage und der Modifizierung der Hypothesen. Die Ergebnisse der Analyse werden in Bezug auf die theoretischen Grundlagen diskutiert und die Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung zum Bildungsaufstieg wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bildungsaufstieg, die soziale Herkunft, den Habitus, die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu, das narrative Interview, die Bildungsungleichheit und die Bildungschancen. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen eines jungen Mannes aus einem sozial benachteiligten Umfeld und beleuchtet die Herausforderungen und Faktoren, die mit dem Aufstieg aus schwierigen familiären Verhältnissen und einem sozial benachteiligten Stadtteil verbunden sind.
- Quote paper
- Rebecca Winkler (Author), 2013, Empirische Bildungsforschung. Aufstieg im Bildungswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294984