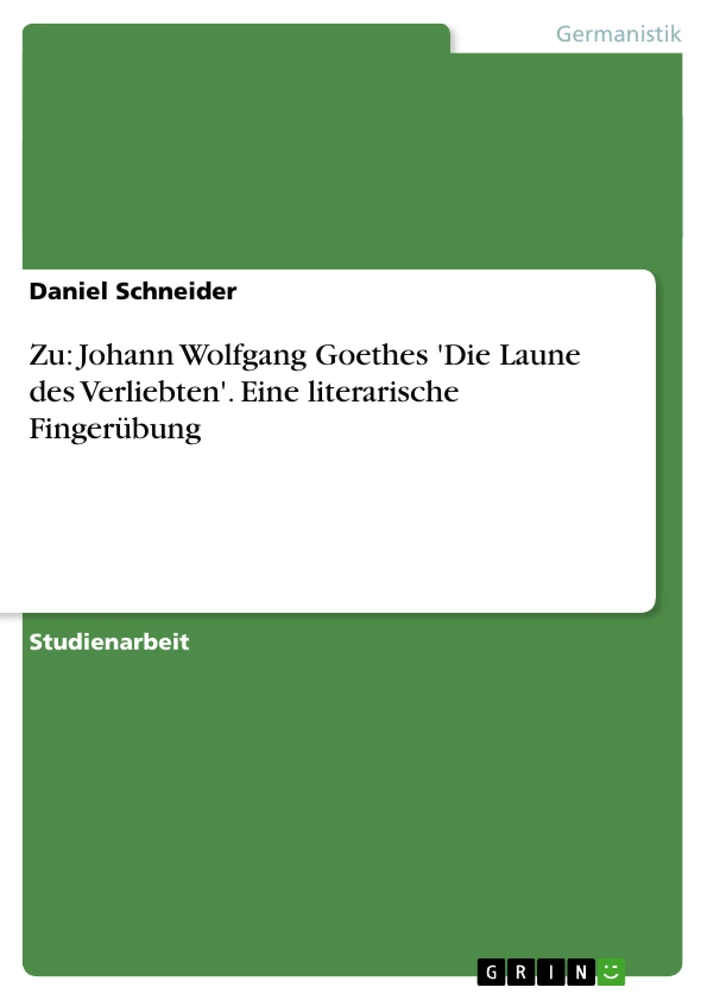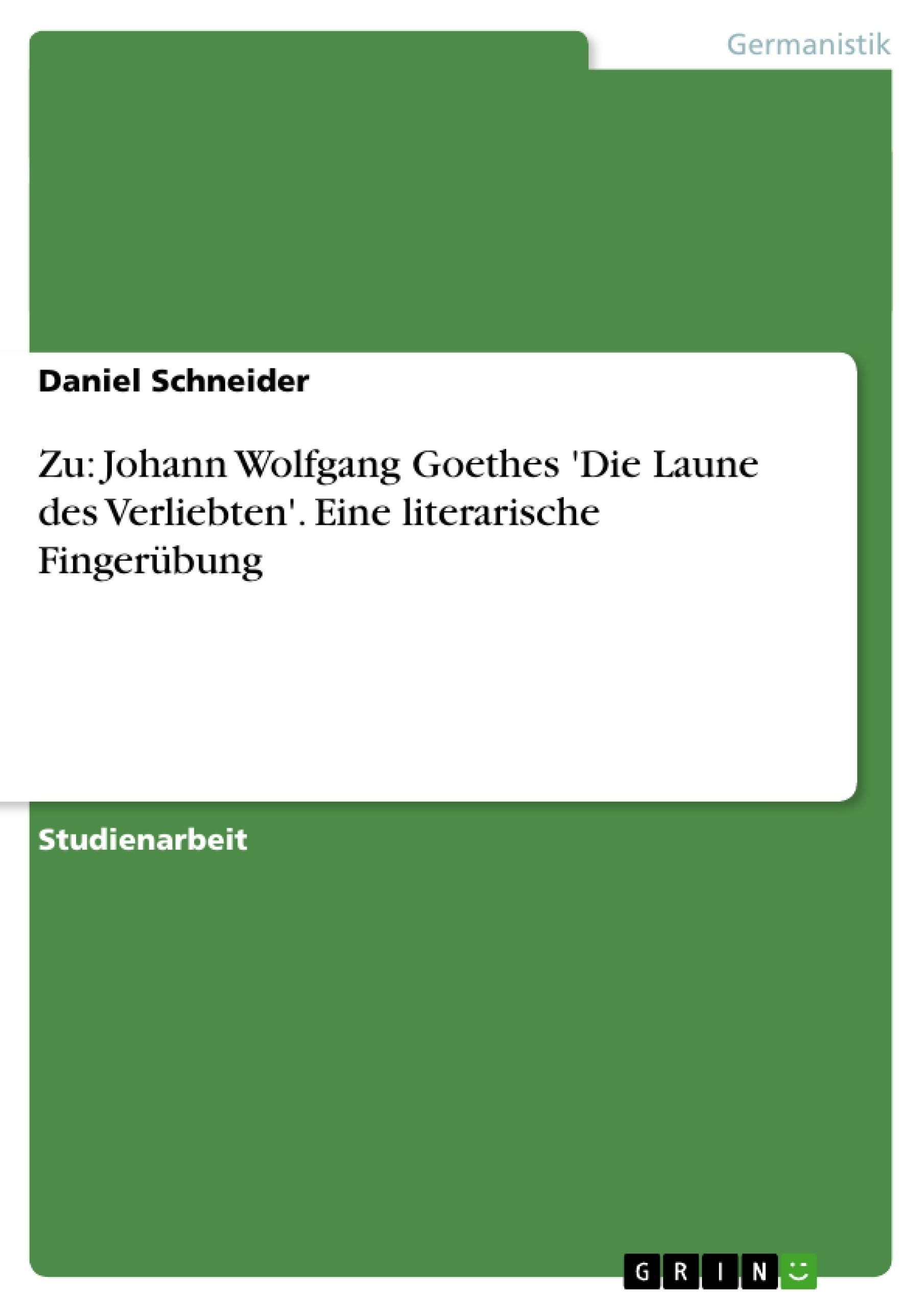In seinem Erstlingswerk Die Laune des Verliebten hat Johann Wolfgang Goethe mit der Wahl des Schäferspiels dem Zeitalter den ihm gebührenden Zoll gezahlt und sich literarisch an einer zeitlich aktuellen Gattung erprobt. Doch viele Aspekte, in denen Goethe über die Vorgaben des typischen Schäferspiels hinausgeht, deuten an, dass der erst 18-jährige Goethe sich bereits den Fesseln der genormten Literatur entledigen wollte und über den Tellerrand der strikten Normvorgaben des Schäferspiels hinausguckte. Dennoch ist für die Bedeutung von Die Laune des Verliebten innerhalb Goethes Schaffen nicht zu verachten, dass der junge Schriftsteller, dem schließlich der Höhepunkt der Geschichte des deutschen Schäferspiels zugeschrieben wird, sich als begabter Anakreontiker bewährt. Am Ende war es für Goethe aber eine literarische Fingerübung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Schäferspiel Die Laune des Verliebten
- Die Geschichte der Schäferdichtung
- Zwischen Rokoko und Empfindsamkeit
- Traditionelle Rokokoform
- Abweichungen Goethes in seinem Schäferspiel von der traditionellen Rokokoform
- Die Wahl des Schäferspiels
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In dieser Arbeit wird untersucht, warum sich der junge Goethe in seinem Erstlingswerk für die Gattung des Schäferspiels entschied. Die Analyse befasst sich mit der Entwicklung der Schäferdichtung und beleuchtet Goethes Umgang mit den konventionellen Normen des Rokoko-Schäferspiels. Besonderes Augenmerk liegt auf den Aspekten, die Goethes Werk von den traditionellen Mustern abweichen und mit der literarischen Strömung der Empfindsamkeit in Verbindung gebracht werden können. Die Arbeit berücksichtigt auch biographische Entstehungszusammenhänge, bevor sie im Resümee die theoretische Grundlage für die Wahl des Untertitels „Eine literarische Fingerübung“ erörtert.
- Die Geschichte der Schäferdichtung
- Goethes Umgang mit der traditionellen Rokokoform des Schäferspiels
- Abweichungen von der traditionellen Rokokoform im Kontext der Empfindsamkeit
- Biographische Entstehungskontexte
- Die Wahl des Schäferspiels als literarische Fingerübung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert den Forschungsgegenstand der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit Goethes Schäferspiel „Die Laune des Verliebten“ und stellt dessen Bedeutung in der Geschichte des Schäferspiels dar. In Kapitel 2.1 wird die Geschichte der Schäferdichtung vom antiken Griechenland bis ins 18. Jahrhundert beleuchtet. Dabei wird die Entwicklung der Gattung von Theokrit und Vergil bis hin zu Opitz und Gottsched erörtert. Kapitel 3 analysiert die Gattung des Schäferspiels im Kontext der Epochen des Rokoko und der Empfindsamkeit. Die traditionellen Formen des Rokoko-Schäferspiels werden vorgestellt und Goethes Abweichungen von diesen Normen im Hinblick auf die Empfindsamkeit untersucht.
Schlüsselwörter
Schäferspiel, Rokoko, Empfindsamkeit, Goethe, „Die Laune des Verliebten“, Geschichte der Schäferdichtung, literarische Fingerübung, biographische Entstehungszusammenhänge.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Goethes Werk 'Die Laune des Verliebten'?
Das Werk ist ein Schäferspiel, das Goethes Erstlingswerk darstellt. Es wird in der Arbeit als literarische Fingerübung analysiert, bei der sich der junge Goethe an einer zeitgenössischen Gattung erprobte.
Inwiefern weicht Goethe von der traditionellen Form des Schäferspiels ab?
Obwohl er die Gattung nutzt, deuten viele Aspekte darauf hin, dass der 18-jährige Goethe bereits die Fesseln der genormten Literatur sprengen wollte und über die strikten Normvorgaben des Rokoko hinausblickte.
Welche literarischen Strömungen beeinflussten das Werk?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der traditionellen Rokokoform und der aufkommenden Epoche der Empfindsamkeit.
Welche Rolle spielt die Geschichte der Schäferdichtung in der Analyse?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Schäferdichtung von der Antike (Theokrit, Vergil) bis ins 18. Jahrhundert (Opitz, Gottsched), um Goethes Beitrag einzuordnen.
Warum wird das Werk als 'literarische Fingerübung' bezeichnet?
Dieser Begriff verdeutlicht, dass es sich um ein Übungsstück handelt, in dem Goethe sein Talent als Anakreontiker bewies, bevor er zu seinen späteren literarischen Höhepunkten gelangte.
- Citar trabajo
- Daniel Schneider (Autor), 2004, Zu: Johann Wolfgang Goethes 'Die Laune des Verliebten'. Eine literarische Fingerübung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29499