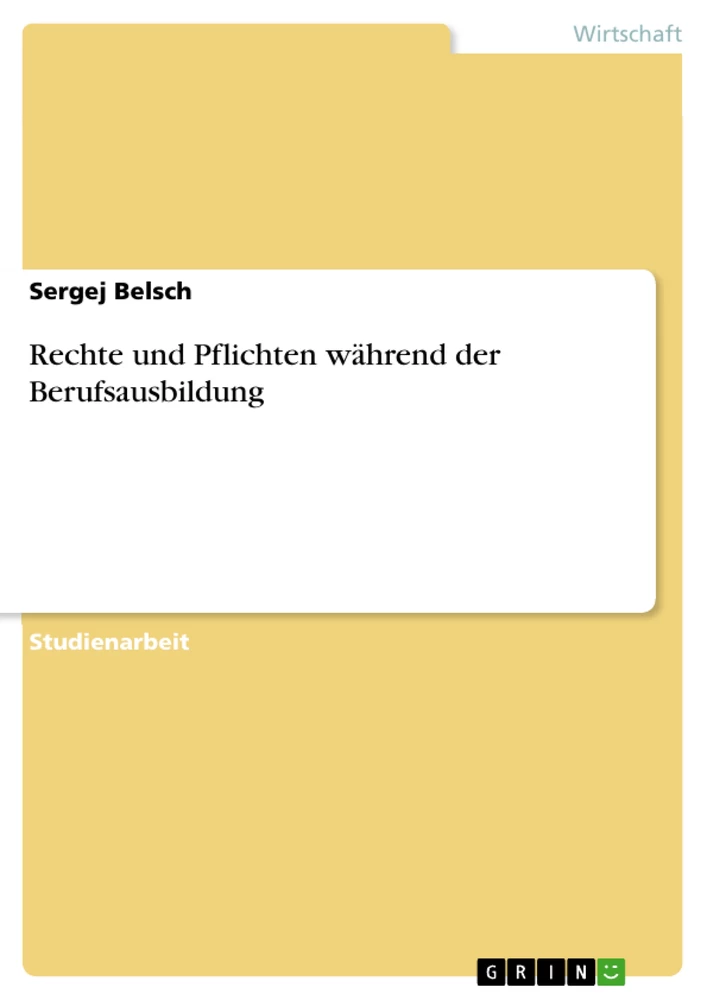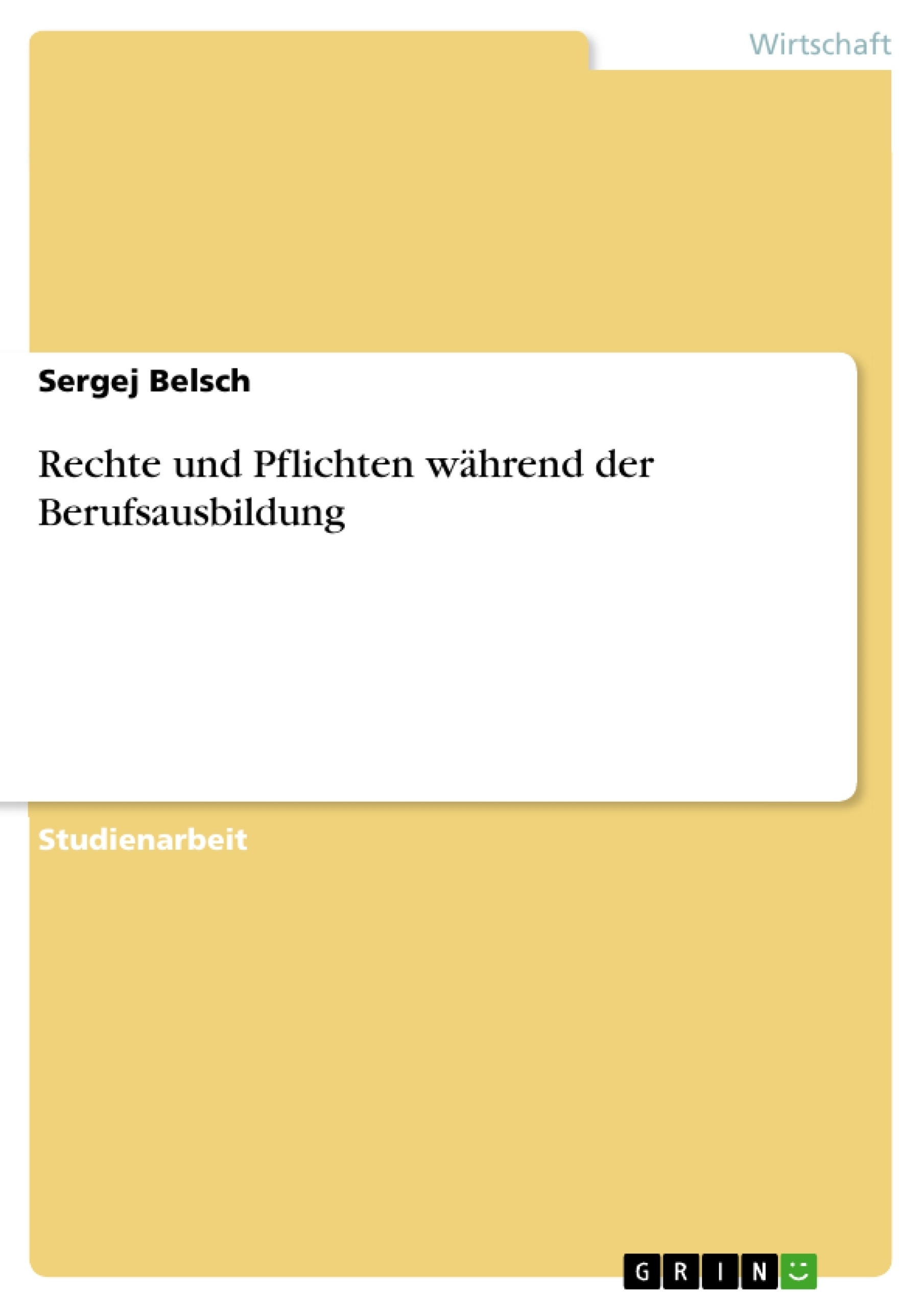Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 344 anerkannte Ausbildungsberufe. Für jeden anerkannten Ausbildungsberuf gibt es eine eigene Ausbildungsordnung. Sie regelt, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse in welchem Zeitraum bis zur Prüfung vermittelt werden müssen. Dies soll sicherstellen, dass junge Leute, die einen Beruf erlernen eine einheitliche und qualifizierte Ausbildung erhalten.
Aber wie gut kennen heutzutage die Auszubildenden ihre Rechte und Pflichten und wie ernst nehmen die Ausbildungsbetriebe die Rechte und Pflichten, die in der BBiG, JArbSchG, HwO und AEVO geregelt sind? Die Gesetze im BBiG oder in dem JArbSchG dienen überwiegend zum Schutz der jungen Menschen während der Berufsausbildung. Aber was nutzen diese Gesetze, wenn die Auszubildende kaum über ihre Rechte und Pflichten informiert werden oder Angst haben ihre Rechte durchzusetzen, weil sie keine Streitigkeiten mit dem Vorgesetzten haben wollen.
Diese Arbeit soll verdeutlichen, warum die Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung so wichtig sind und was es bei einer korrekten Anwendung zu erreichen ist. Unter anderem werden dem Leser die wichtigen Paragraphen genannt, die eine große Rolle in diesem Thema spielen. In erster Linie hat diese Arbeit das Ziel, die Theorie mit der Praxis zu vergleichen, um zu schauen, welchen Einfluss die Gesetze in der Praxis haben. Außerdem dient diese Arbeit als Informationsquelle für die jungen Leute, die ihre Erstausbildung in einem Unternehmen beginnen möchten.
Laut meinen Recherchen im Internet und bei der Befragung der ehemaligen Auszubildenden (Verwandten, Bekannten und Studenten) stellte ich fest, dass die Mehrheit der Befragten überwiegend bei kleineren Betrieben unzufrieden war. Viele beklagten sich hauptsächlich über die unbezahlten Überstunden, geringe Vergütung, mangelnde Vermittlung der fachlichen und methodischen Kompetenz sowie über die schlechte Informierung über die Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung. Ferner berichten User im Internet, dass sie aus Angst sich nicht trauten während der Berufsausbildung ihre Rechte durchzusetzen, weil sie ihren Ausbildungsplatz nicht aufs Spiel setzen wollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung / Problemstellung
- 2. Ausbildungsberuf und Ausbildungsordnung
- 3. Eignung von Ausbildungsstätte und Ausbildungspersonal
- 3.1 Ausbildungsstätte
- 3.2 Ausbildungspersonal
- 3.3 Überwachung der Eignung
- 4. Berufsausbildungsvertrag
- 4.1 Vertragsparteien
- 4.2 Vertragsniederschrift
- 4.3 Eintragung des Berufsausbildungsverhältnisses
- 5. Ausbildungszeit
- 5.1 Ausbildungsdauer
- 5.2 Probezeit
- 5.3 Aufteilung der Ausbildungszeit
- 5.4 Urlaub
- 6. Rechte und Pflichten im Ausbildungsverhältnis
- 6.1 Ausbildungsziel
- 6.2 Freistellungs- und Teilnahmepflicht an Berufsschulunterricht
- 6.3 Bereitstellung von Ausbildungs- und Prüfungsmittel
- 6.4 Weisungen
- 6.5 Verschwiegenheitspflicht
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Rechten und Pflichten während der Berufsausbildung. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Rechte und Pflichten zu verdeutlichen und den Einfluss der relevanten Gesetze in der Praxis zu beleuchten. Außerdem soll die Arbeit als Informationsquelle für junge Menschen dienen, die ihre Erstausbildung in einem Unternehmen beginnen möchten.
- Rechte und Pflichten von Auszubildenden
- Rechte und Pflichten von Ausbildungsbetrieben
- Die Bedeutung der Ausbildungsordnung
- Der Berufsausbildungsvertrag und seine Inhalte
- Die praktische Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und den Hintergrund der Arbeit erläutert. Im zweiten Kapitel werden der Ausbildungsberuf und die Ausbildungsordnung näher betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Eignung von Ausbildungsstätten und Ausbildungspersonal. Das vierte Kapitel behandelt den Berufsausbildungsvertrag und seine Bestandteile. Im fünften Kapitel wird die Ausbildungszeit detailliert besprochen. Das sechste Kapitel widmet sich den Rechten und Pflichten im Ausbildungsverhältnis. Die Arbeit endet mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Berufsausbildung, Ausbildungsordnung, Rechte, Pflichten, Ausbildungsvertrag, Ausbildungszeit, Ausbildungsstätte, Ausbildungspersonal, Berufsschulunterricht, BBiG, JArbSchG, HwO, AEVO, duale Berufsausbildung, Ausbildungsrahmenplan.
Häufig gestellte Fragen
Welche Gesetze regeln die Rechte von Auszubildenden?
Die wichtigsten Grundlagen sind das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und für Minderjährige das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG).
Was muss in einem Berufsausbildungsvertrag stehen?
Er muss unter anderem Angaben zu Art und Ziel der Ausbildung, Dauer der Probezeit, Vergütung, Arbeitszeit und Urlaubsanspruch enthalten.
Welche Pflichten hat ein Ausbildungsbetrieb?
Der Betrieb muss die Ausbildungsmittel bereitstellen, den Azubi für die Berufsschule freistellen und dafür sorgen, dass das Ausbildungsziel erreicht wird.
Welche Pflichten hat der Auszubildende?
Auszubildende haben eine Lernpflicht, müssen Weisungen befolgen, die Berufsschule besuchen und die Verschwiegenheitspflicht wahren.
Was sind häufige Probleme in der Ausbildungspraxis?
Häufige Kritikpunkte sind unbezahlte Überstunden, mangelnde Vermittlung von Fachwissen und unzureichende Information über die eigenen Rechte.
- Quote paper
- Sergej Belsch (Author), 2012, Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295306