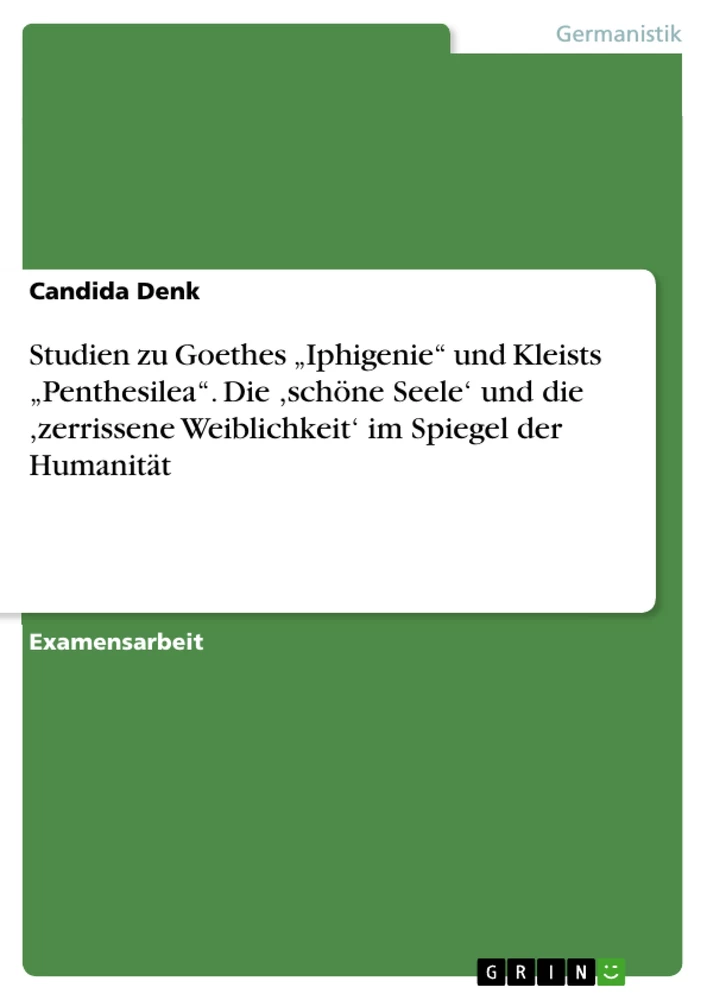Dieses besondere Verhältnis zwischen den beiden Dichtern, das schon „die Zeitgenossen durch repräsentative Gegensätzlichkeit“ bestimmt sahen und die unterschiedliche Art der beiden, die griechische Antike jeweils für ihre Dramen wiederzuentdecken, macht einen Vergleich zwischen den Werken „Iphigenie“ und „Penthesilea“ so interessant. Hinzu kommt Goethes ablehnende Haltung gegenüber letzterem Drama und die Tatsache, dass die Tragödie Kleists in der Forschung häufig als „Anti-Iphigenie“ bezeichnet wurde.
Da es sich bei beiden Hauptfiguren um weibliche Helden handelt, wie sie augenscheinlich gegensätzlicher nicht sein könnten, und sich beide Autoren, jeweils auf ihre Weise, auf Humanität beziehen, liegt es nahe, die beiden Dramen unter diesen Gesichtspunkten zu vergleichen. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der zentralen Frage, ob Kleists „Penthesilea“ als düsteres Gegenbild ihrer ‚Weimarer Schwester‘ – als Kontrast „Iphigenies“ bezeichnet werden kann.
Dabei sollen einige einleitende Vergleiche, wie Unterschiede in der formalen Gestaltung der beiden Dramen, und grundsätzliche Aspekte über den klassischen Humanitätsgedanken zum Thema hinführen. Nach einer vergleichenden Betrachtung unter dem Aspekt der „Humanität“ erfolgt eine Gegenüberstellung der beiden Protagonistinnen unter dem Gesichtspunkt „Weiblichkeit“, um dann unter Einbezug beider vergleichenden Aspekte zur abschließenden Beantwortung der Leitfrage zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bearbeitung des mythologischen Stoffes
- Die,,mythologische Nachbarschaft“ der beiden Dramen
- Goethes klassische Form und Kleists formale Zerrissenheit
- Humanität und erbarmungslose Grausamkeit
- Der klassische Humanitätsgedanke
- Iphigenie - verteufelt human?
- Der antike Stoff
- Das humane Potenzial zu Beginn des Stückes
- List und Wahrheitssprechung
- Humanes Ende?
- Penthesilea – inhuman und barbarisch?
- Der antike Stoff
- Krieg und Unmenschlichkeit zu Beginn?
- Selbstbestimmung wider Fremdbestimmung
- Das tragische Ende – Verfehlung der humanen Idee
- Iphigenie und Penthesilea – ungleiche Schwestern?
- Weiblichkeit
- Goethes,,schöne Seele“ und Kleists „Kentaurin“
- So frei geboren wie ein Mann?
- Iphigenie – beklagenswerter „Frauen Zustand“
- Penthesilea - hineingeboren in einen „autonomen Frauenstaat“
- Geschlechtsbedingter Konformismus
- Iphigenies Widerwille gegen männliche Fremdbestimmung
- Penthesileas Emanzipation vom Frauenstaat
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verbindung von „Antike und Moderne“ in den Dramen „Iphigenie auf Tauris“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist. Die Arbeit untersucht, wie die beiden Dichter den antiken Stoff jeweils für ihre Dramen wiederentdecken und die klassische Tragödie interpretieren. Im Mittelpunkt stehen die beiden weiblichen Figuren Iphigenie und Penthesilea, ihre unterschiedlichen Charaktere und deren Verhältnis zu den Begriffen Humanität und Weiblichkeit.
- Die Bearbeitung des mythologischen Stoffes in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts
- Der Humanitätsgedanke in der Antike und in der Aufklärung
- Die Darstellung von Weiblichkeit in den Dramen von Goethe und Kleist
- Die Rolle von Gewalt und Grausamkeit in der Tragödie
- Die Frage nach der Selbstbestimmung und Fremdbestimmung der Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die beiden Dramen „Iphigenie auf Tauris“ und „Penthesilea“ vor und erläutert die Intention der Arbeit. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Bearbeitungsphasen der Dramen und die Reaktion der Zeitgenossen auf die Werke. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Bearbeitung des mythologischen Stoffes und den unterschiedlichen formalen Gestaltungsmerkmalen der beiden Dramen. Kapitel 3 untersucht die Interpretation des Humanitätsgedankens in beiden Dramen und stellt die Figuren Iphigenie und Penthesilea in Bezug auf ihre menschliche und unmenschliche Seite dar. Kapitel 4 beleuchtet die Darstellung von Weiblichkeit in den beiden Dramen und zeigt die Kontraste zwischen Goethes „schönen Seele“ und Kleists „zerrissener Weiblichkeit“ auf. Kapitel 5 analysiert die Frage nach der Selbstbestimmung und Fremdbestimmung der Frau in den Dramen und untersucht die Rolle von Geschlechtsbedingtem Konformismus.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Humanität, Weiblichkeit, Antike, Tragödie, Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, Goethes Iphigenie auf Tauris, Kleists Penthesilea, klassische Form, formale Zerrissenheit, „schöne Seele“, „zerrissene Weiblichkeit“.
- Quote paper
- Candida Denk (Author), 2014, Studien zu Goethes „Iphigenie“ und Kleists „Penthesilea“. Die ,schöne Seele‘ und die ,zerrissene Weiblichkeit‘ im Spiegel der Humanität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295363