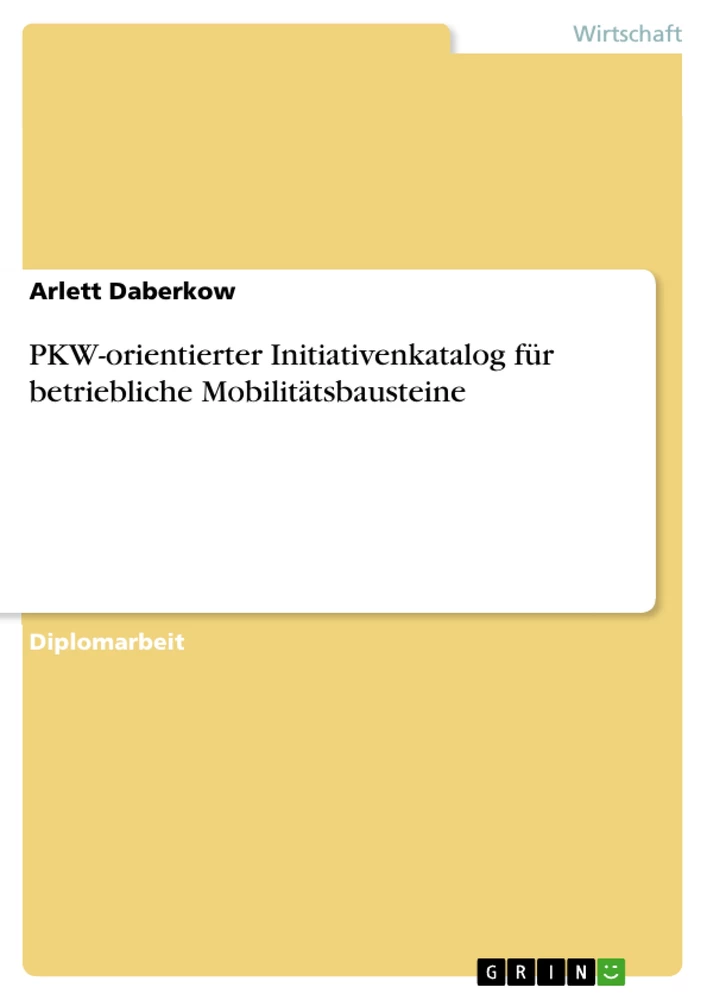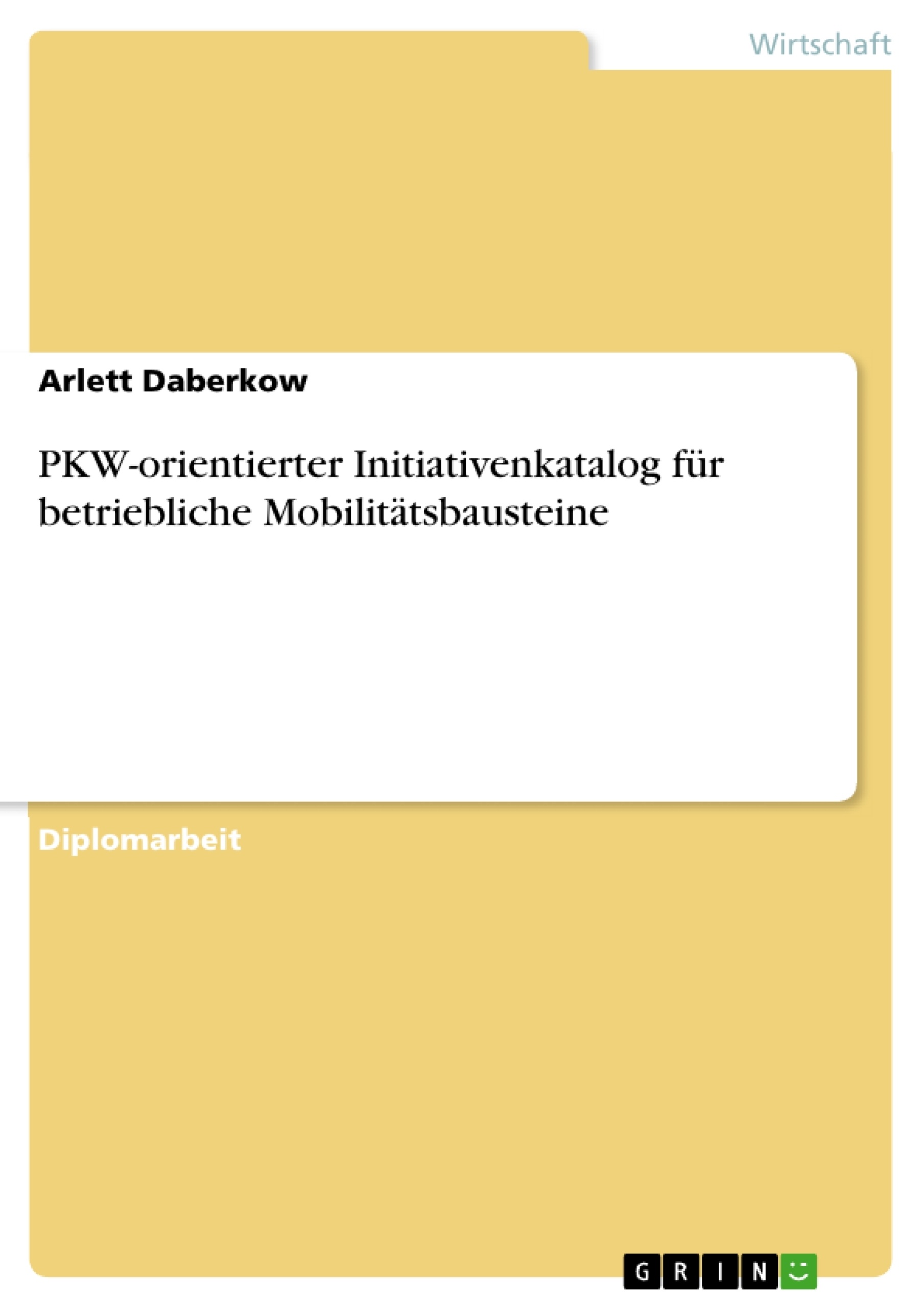Die betriebliche Mobilität birgt neben Immobilienportfolios mitunter das größte Potenzial zur unternehmerischen Nachhaltigkeitssteigerung. Diese genießt aufgrund des Klimawandels aber auch aus einer Vielzahl anderer Beweggründe, wie etwa einer stabilen Wirtschaftsentwicklung, eine mittlerweile priorisierte Stellung in Unternehmen. Die Kenntnis um Optimierungspotenziale im betrieblichen Mobilitätsmanagement hingegen ist gegenwärtig als oberflächlich einzustufen.
Das Facility Management, welches seit Anbeginn dem Prinzip der Nachhaltigkeit unterliegt, findet über das Fuhrparkmanagement den Anschluss zum komplexen Thema der Mobilität. Neben den Immobilien erhielt dieses bis dato jedoch nur unterschwellige Beachtung. Infolgedessen bereitet die betriebliche Mobilität nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die unterstützende Managementdisziplin den Zugang zu neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten.
Mit Hilfe einer Ergänzung des konventionellen Fuhrparkmanagements um weitreichende Mobilitätskomponenten kann das Facility Management die Frage der Unternehmen beantworten, wie sich mit dem eigenen Fuhrpark der Nachhaltigkeit schrittweise angenähert werden kann. Die in diesem Zusammenhang aufgegriffenen Anregungen der vorliegenden Arbeit umfassen kurzfristige Möglichkeiten der Nachhaltigkeitssteigerung wie der Emissionskompensation, Parkraumbewirtschaftung, Fahrzeugtechnik oder Verhaltensschulung über mittelfristige Ansätze der Hybridtechnik und disponibler Treibstoffarten bis hin zu langfristigen Szenarien der Elektromobilität mittels Batterie- und Wasserstoffantrieb.
Mit diesen Informationen wird das Facility Management-spezifische Wissen um das Thema Mobilität erweitert und Möglichkeiten zur betrieblich-nachhaltigen Mobilitätsoptimierung aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Kurzfassung
- Executive Summery
- Ausgangslage & aktueller Forschungsstand
- Problemstellung
- Forschungsfrage & Zielsetzung
- Prolog
- Methodik & Aufbau
- Der Klimawandel
- Beweggründe für eine mobile Revolution
- „Problemkinder“ Öl und Gas
- Peak Oil & Peak Gas
- Ölpreisentwicklung
- Betriebener Aufwand fossiler Energien
- Die Emissionspolitik
- Globale Raumplanung
- Glokalisierung - Zurück in die Zukunft
- Kundenorientierung auf dem Weg
- Nachhaltige Regelwerke
- Energieinfrastruktur
- Große und kleine Projekte
- Internet der Energie
- Allen voran die Energieeffizienz
- FM erweitert um den Faktor Mobilität
- Facility Management
- Betriebliches Verkehrsmanagement
- Fuhrparkmanagement
- Travelmanagement
- Mobilitätsmanagement
- Integriertes Management
- FM und Mobilität
- Betriebliches Supportmanagement
- Initiativensammlung aus dem Support Management
- Grundbaustein Organisation
- Zielsetzung als Antrieb und roten Faden
- Manuelle & digitale Bestandsaufnahme
- Monitoring & Reporting
- Qualitätssicherung mit Kennzahlen
- Punktueller vs. Systematisierter Ansatz
- Kommunikation
- Zentraler Ansprechpartner im Unternehmen
- Interne Mobilitätskampagne
- Institutionsübergreifende Kooperationen
- Kurzfristige Mobilitätsbausteine
- Emissionskompensation
- Car Pool & Reiserichtlinie
- Parkraumbewirtschaftung
- Betriebliches Carsharing
- Fahrtrainings
- Fahrspartipps
- Fahrgemeinschaftsvermittlung
- Fahrzeugtechnik
- Downsizing
- Start-Stopp-System
- Unterstützende Telematik
- Reifenwahl
- Leichtlauföle
- Mittelfristige Mobilitätsbausteine
- Treibstoffwahl
- Compressed Natural Gas (CNG)
- Liquefied Petroleum Gas (LPG)
- Biokraftstoffe
- Hybridtechnik
- Langfristige Mobilitätsbausteine
- E-Mobilität mit Batterie
- Projektbeispiele
- Marktreife
- Ladeinfrastruktur
- E-Mobilität mit Wasserstoff
- Projektbeispiele
- Marktreife
- E-Mobilität als Initiativenbaustein
- Trends
- Best Practises für intermodale Bausteine
- Smart Mobility & Smart FM
- Berufsausbildung
- Abschließende Stellungnahme
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Initiativenkatalogs für betriebliche Mobilitätsbausteine, der den Fokus auf PKW-orientierte Maßnahmen legt. Die Arbeit analysiert die aktuellen Herausforderungen und Trends im Bereich der Mobilität und entwickelt konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
- Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Mobilität
- Die Rolle von Facility Management (FM) im Kontext von Mobilität
- Die Entwicklung von nachhaltigen Mobilitätskonzepten für Unternehmen
- Die Integration von verschiedenen Mobilitätsbausteinen in ein ganzheitliches Konzept
- Die Bedeutung von Kommunikation und Akzeptanz bei der Einführung von Mobilitätsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Relevanz des Themas Mobilität im Kontext des Klimawandels heraus. Anschließend werden die wichtigsten Beweggründe für eine mobile Revolution beleuchtet, die sich auf die Entwicklungen im Bereich der fossilen Brennstoffe, die Emissionspolitik und die globale Raumplanung konzentrieren.
Im nächsten Kapitel wird der Fokus auf die Integration von Mobilität in das Facility Management gelegt, wobei die verschiedenen Bereiche des betrieblichen Verkehrsmanagements (Fuhrparkmanagement, Travelmanagement, Mobilitätsmanagement) vorgestellt werden.
Daraufhin werden verschiedene Initiativen aus dem Support Management vorgestellt, die als Grundlage für den Initiativenkatalog dienen. Hierbei werden Themen wie Organisation, Zielsetzung, Bestandsaufnahme, Monitoring, Qualitätssicherung, Kommunikation und Kooperation behandelt.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit der detaillierten Beschreibung von kurz-, mittel- und langfristigen Mobilitätsbausteinen, wobei verschiedene Ansätze wie Emissionskompensation, Car Pooling, Parkraumbewirtschaftung, Betriebliches Carsharing, Fahrtrainings, Fahrzeugtechnik, Treibstoffwahl, Hybridtechnik und E-Mobilität vorgestellt werden.
Im letzten Kapitel werden aktuelle Trends im Bereich der Mobilität beleuchtet, wie beispielsweise Best Practices für intermodale Bausteine, Smart Mobility und Smart FM, sowie die Bedeutung der Berufsausbildung im Kontext der Mobilität.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Themenbereich der betrieblichen Mobilität, insbesondere mit PKW-orientierten Initiativen. Schlüsselwörter sind: Mobilitätsmanagement, nachhaltige Mobilität, Facility Management, Klimawandel, Emissionsreduktion, Treibstoffalternativen, E-Mobilität, Hybridtechnik, Car Pooling, Fahrgemeinschaftsvermittlung, Parkraumbewirtschaftung, Kommunikation, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen
Was umfasst betriebliches Mobilitätsmanagement?
Es integriert Fuhrpark-, Travel- und Verkehrsmanagement, um die Mobilität von Mitarbeitern nachhaltiger, effizienter und kostengünstiger zu gestalten.
Welche kurzfristigen Maßnahmen zur Emissionsreduktion gibt es?
Dazu zählen Emissionskompensation, Parkraumbewirtschaftung, Car-Pooling, Fahrtrainings für spritsparendes Fahren und technische Optimierungen wie Reifenwahl oder Start-Stopp-Systeme.
Welche Rolle spielt Elektromobilität im Unternehmen?
E-Mobilität (Batterie oder Wasserstoff) gilt als langfristiger Baustein zur Dekarbonisierung des Fuhrparks, erfordert jedoch den Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur.
Was ist betriebliches Carsharing?
Hierbei stellen Unternehmen Poolfahrzeuge bereit, die von Mitarbeitern für Dienstfahrten (und teils privat) genutzt werden können, um den Bedarf an Individualfahrzeugen zu senken.
Wie hängen Facility Management und Mobilität zusammen?
Facility Management übernimmt oft die Verwaltung der Infrastruktur (Fuhrpark, Parkplätze) und erschließt durch Mobilitätskonzepte neue Wertschöpfungspotenziale für das Unternehmen.
- Quote paper
- Arlett Daberkow (Author), 2011, PKW-orientierter Initiativenkatalog für betriebliche Mobilitätsbausteine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295373