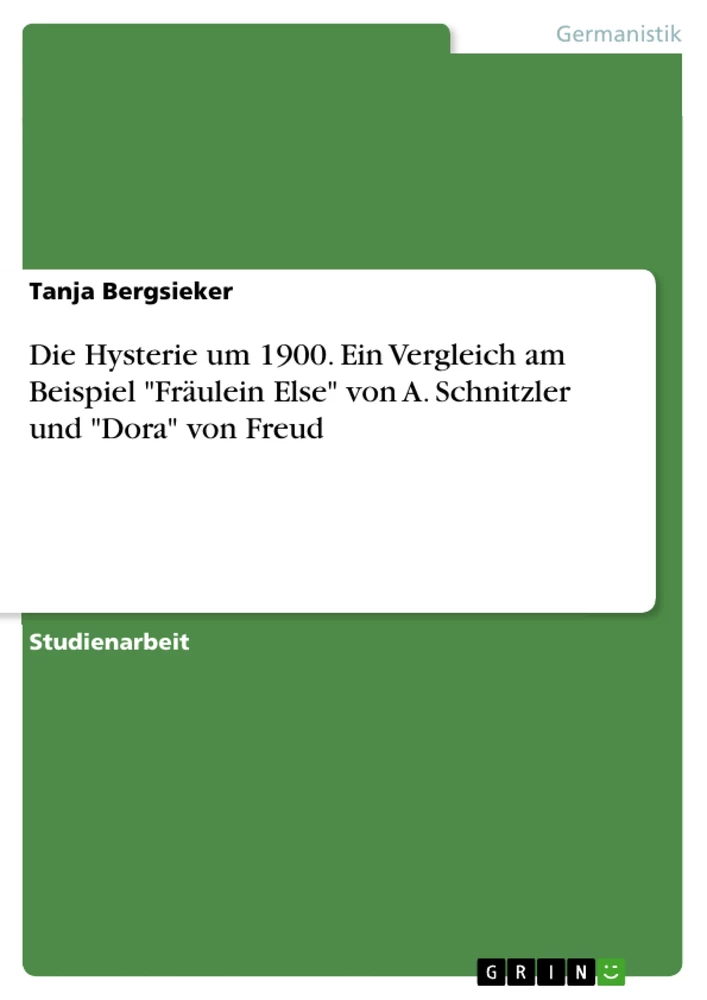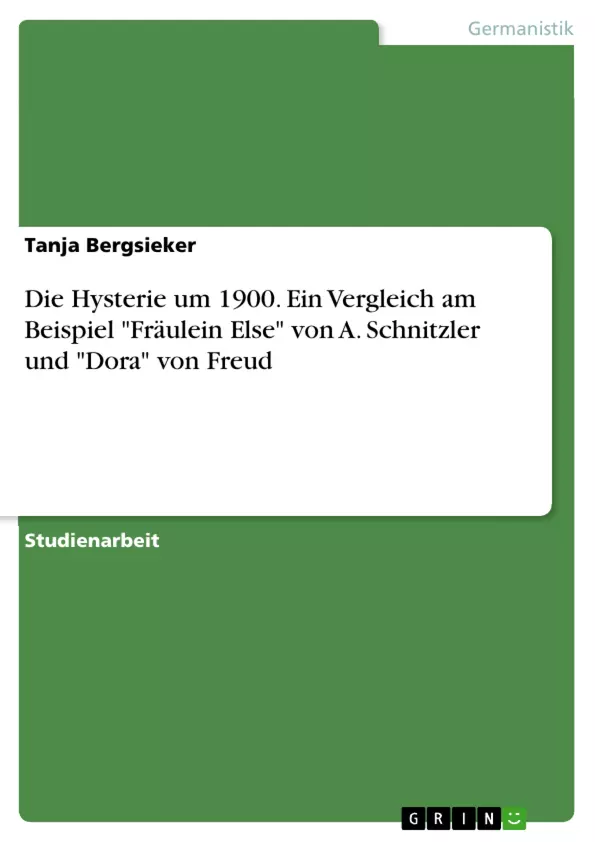Die Hysterie steht für all das, was das Fin de Siècle ausmacht: Lug und Täuschung, Schein und Fassadenhaftigkeit, Unfähigkeit und Krankheit, Betäubung und gescheiterte Existenzen. Schnitzler ist ein Vertreter dieser Epoche und er nimmt den Epochendiskurs auf und nutzt ihn, um in seinen Werken eine Gesamtdarstellung der Gesellschaft darzustellen, indem er ihr einen zeitgemäßen Rahmen und Hintergrund gibt. Auch seine Monolognovelle „Fräulein Else“, erschienen 1924, stellt eine Art fiktive Fallstudie über ein ,,seelisch erkranktes" Individuum dar. Auch Sigmund Freud, ein österreichischer Neurologe und Begründer der Psychoanalyse, war eines der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts.
Diese Seminararbeit untersucht die Hysterie und den Hysteriebegriff um 1900 am Beispiel zweier Krankheitsbilder – ‚Dora‘ und Else. Dabei wird ein Vergleich beider Krankheitsbilder geschaffen. Zunächst wird der Hysteriebegriff definiert und in einem weiteren Schritt zeitlich eingeordnet. Die Geschichte zur Entstehung des Hysteriebegriffs wird in einem weiteren Kapitel dargestellt und insbesondere die Zeit um 1900 mit einbezogen. Weiter geht es mit den Symptomen der Hysterie, um ein bildliches Vorstellungsvermögen des Krankheitsbildes zu haben. In Kapitel 3 erfolgt eine Darstellung über die Anfänge der Psychoanalyse. Spezieller werden die „Studien über Hysterie“ sowie „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ erläutert, um zwei markante Modelle zu verdeutlichen. Um später zum Vergleich von ‚Dora‘ und Else zu gelangen, werden zunächst die beiden Träume von ‚Dora‘ erfasst und analysiert, um sie in Punkt 4 mit der Fallgeschichte Elses gegenüberzustellen. Dabei wird eine kurze Inhaltsangabe Schnitzlers Werk wiedergegeben, um im Anschluss das soziale Umfeld, die Eltern-Kind-Beziehung und das Krankheitsbild zu erläutern.
Zur Hysterie sowie über die Fallstudien Freuds und Schnitzlers gibt es ausreichend Literatur. Basis bilden hier die Werke von Freud „Studien über Hysterie“, „Bruchstück einer Hysterie-Analyse sowie die Monolognovelle „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler. Es wird auf die Ausführungen von Kronberger "Die unerhörten Töchter", Elisabeth Bronfen "Das verknotete Subjekt. Hysterie in der Moderne", Regina Schaps "Hysterie und Weiblichkeit. Wissenschaftsmythen über die Frau" und Dorion Weickmann "Rebellion der Sinne. Hysterie - ein Krankheitsbild als Spiegel der Geschlechterordnung (1880-1920)" zurückgegriffen. Die Arbeit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hysterie
- Die Entstehung des Hysteriebegriffs
- Der Hysteriebegriff um 1900
- Die Symptome der Hysterie
- Die Anfänge der Psychoanalyse
- Die „Studien über Hysterie“ von 1895
- Bruchstück einer Hysterie-Analyse von 1905
- Der erste Traum
- Der zweite Traum
- Das Krankheitsbild „Dora“ in „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ im Vergleich zu „Fräulein Else“
- „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler
- Das soziale Umfeld Elses – die Männer um Else
- Die Eltern-Kind-Beziehung
- Elses Krankheitsbild – der hysterische Anfall
- „Fräulein Else“ von Arthur Schnitzler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Hysterie und den Hysteriebegriff um 1900 am Beispiel zweier Krankheitsbilder – ‚Dora' und Else. Dabei wird ein Vergleich beider Krankheitsbilder geschaffen. Zunächst wird der Hysteriebegriff definiert und in einem weiteren Schritt zeitlich eingeordnet. Die Geschichte zur Entstehung des Hysteriebegriffs wird in einem weiteren Kapitel dargestellt und insbesondere die Zeit um 1900 mit einbezogen. Weiter geht es mit den Symptomen der Hysterie, um ein bildliches Vorstellungsvermögen des Krankheitsbildes zu haben. In Kapitel 3 erfolgt eine Darstellung über die Anfänge der Psychoanalyse. Spezieller werden die „Studien über Hysterie“ sowie „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ erläutert, um zwei markante Modelle zu verdeutlichen. Um später zum Vergleich von ‚Dora' und Else zu gelangen, werden zunächst die beiden Träume von ‚Dora' erfasst und analysiert, um sie in Punkt 4 mit der Fallgeschichte Elses gegenüberzustellen. Dabei wird eine kurze Inhaltsangabe Schnitzlers Werk wiedergegeben, um im Anschluss das soziale Umfeld, die Eltern-Kind-Beziehung und das Krankheitsbild zu erläutern.
- Definition und Einordnung des Hysteriebegriffs
- Die Entstehung des Hysteriebegriffs und seine Entwicklung um 1900
- Die Symptome der Hysterie
- Die Anfänge der Psychoanalyse und ihre Bedeutung für die Erforschung der Hysterie
- Vergleich der Krankheitsbilder ‚Dora' und Else
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Hysterie als ein zentrales Phänomen des Fin de Siècle vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, den Hysteriebegriff um 1900 am Beispiel der Krankheitsbilder ‚Dora' und Else zu untersuchen. Sie stellt die wichtigsten Quellen und die Struktur der Arbeit dar.
- Kapitel 2 befasst sich mit dem Begriff der Hysterie und seiner Entwicklung. Es wird auf die antike Vorstellung der Hysterie als eine Krankheit der Gebärmutter eingegangen und die verschiedenen Theorien zur Entstehung des Begriffs beleuchtet. Des Weiteren werden die Symptome der Hysterie im 19. Jahrhundert und ihre Bedeutung für die damalige Gesellschaft beschrieben.
- Kapitel 3 widmet sich den Anfängen der Psychoanalyse und den wichtigsten Werken von Sigmund Freud, die sich mit der Hysterie befassen. Es werden die „Studien über Hysterie“ und das „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ vorgestellt und die Rolle der Traumdeutung für die psychoanalytische Theorie erläutert.
- Kapitel 4 stellt die Krankheitsbilder ‚Dora' und Else im Vergleich dar. Es wird auf die unterschiedlichen sozialen Umfelder der beiden Frauen eingegangen und ihre jeweiligen Krankheitsbilder im Kontext der Hysterie-Theorie analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Hysteriebegriff um 1900, der Psychoanalyse, den Krankheitsbildern ‚Dora' und Else, den Träumen als Ausdruck des Unbewussten, der Geschlechterordnung und der sozialen Verhältnisse im Fin de Siècle. Weitere wichtige Themen sind die Symptome der Hysterie, die Bedeutung der sexuellen Entwicklung, die Rolle der Familie und die gesellschaftliche Konstruktion von Krankheit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete der Begriff „Hysterie“ um 1900?
Die Hysterie galt als zentrale Krankheit des Fin de Siècle und spiegelte gesellschaftliche Phänomene wie Schein, Fassadenhaftigkeit und gescheiterte Existenzen wider.
Wie unterscheiden sich die Fallstudien „Dora“ und „Else“?
„Dora“ ist eine reale Fallanalyse von Sigmund Freud, während „Fräulein Else“ eine fiktive Monolognovelle von Arthur Schnitzler ist; beide behandeln jedoch ähnliche hysterische Symptome.
Welche Rolle spielen Träume in der Analyse der Hysterie?
In Freuds „Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ sind Träume zentrale Instrumente zur Deutung des Unbewussten und zur Aufdeckung verdrängter Konflikte.
Wie wird die Eltern-Kind-Beziehung thematisiert?
Sowohl bei Dora als auch bei Else spielen familiäre Verflechtungen und die Erwartungen der Eltern eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der psychischen Erkrankung.
Was sind typische Symptome der Hysterie in dieser Zeit?
Die Arbeit beschreibt körperliche Symptome ohne organischen Befund sowie den „hysterischen Anfall“ als Ausdruck innerer Rebellion gegen die Geschlechterordnung.
- Quote paper
- Tanja Bergsieker (Author), 2014, Die Hysterie um 1900. Ein Vergleich am Beispiel "Fräulein Else" von A. Schnitzler und "Dora" von Freud, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295488