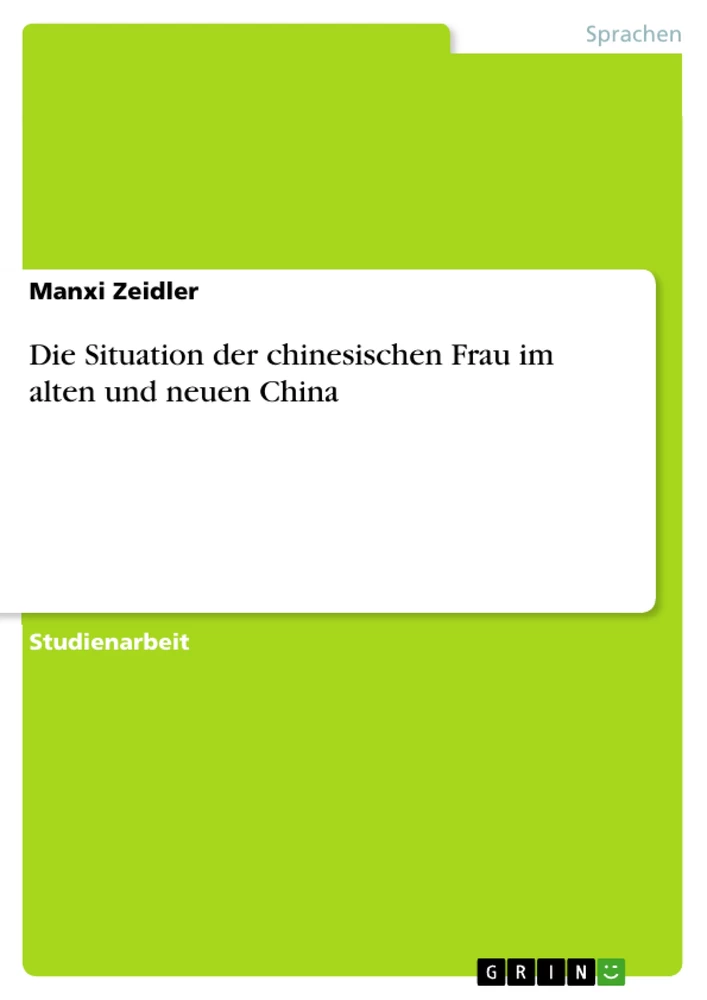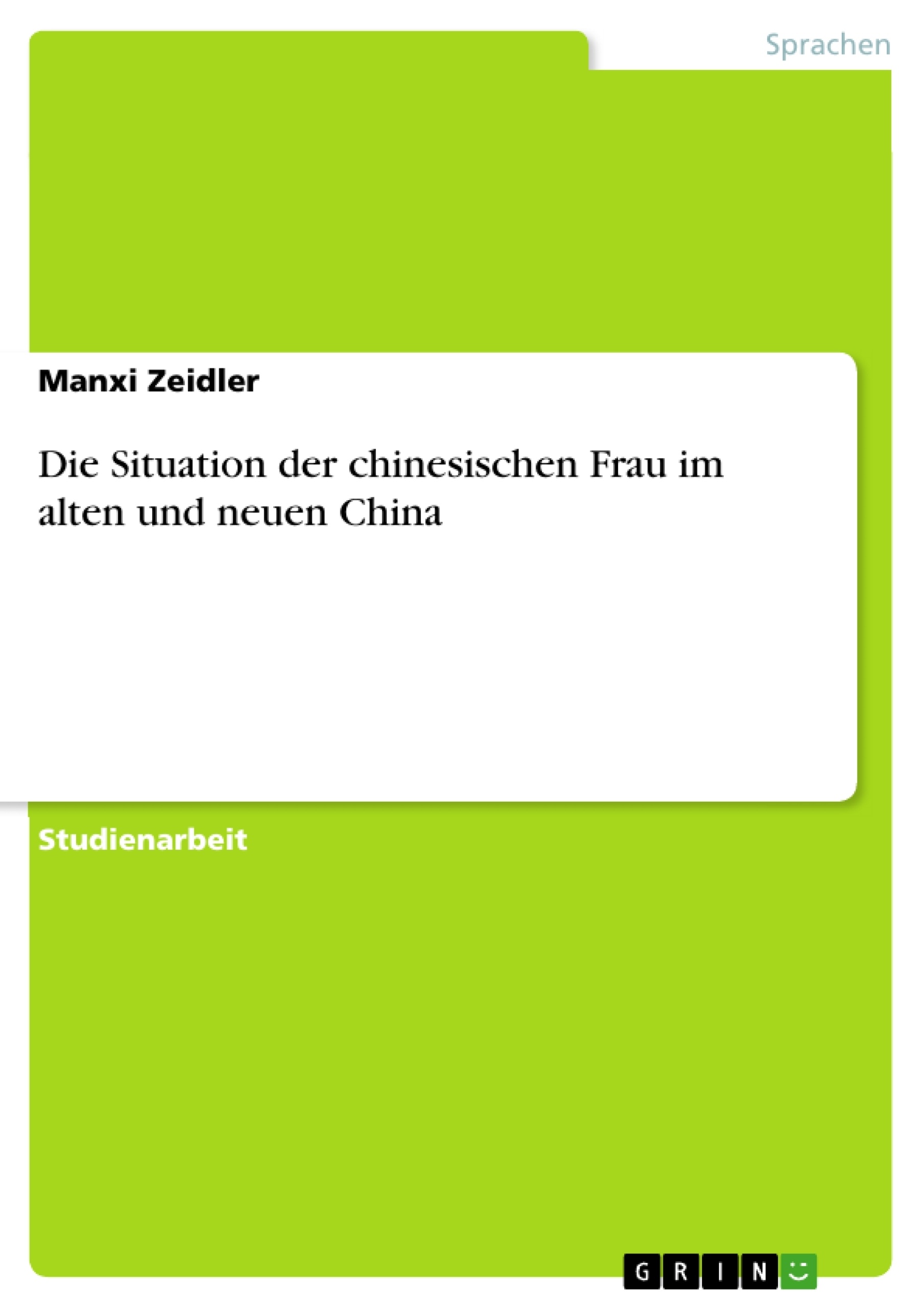Mit den Wirtschaftsreformen unter Deng Xiaoping und der Öffnungspolitik der Volksrepublik China (VR China) gegenüber dem Westen begannen erstmals feministische Sozialwissenschaftlerinnen und Sinologinnen sich intensiv mit der Stellung und der Rolle der Frau im alten und neuen China zu befassen. Im Rahmen der Entwicklung der internationalen neuen Frauenbewegung und der Frauenforschung wurden zahlreiche Studien über die Geschichte der Frauenbewegung in China und die aktuelle Situation der Frauen in der VR China nun aus einer feministischen Perspektive untersucht und neu bewertet.
Seit den 60er Jahren erschienen auch in Deutschland die ersten Arbeiten – jedoch von Nicht-Sinologinnen – zum Thema Frauen in China. Diese Publikationen beschäftigen sich vorwiegend mit der Suche nach der emanzipierten chinesischen Frau, die sich von den konfuzianischen Traditionen und ihrer patriarchalischen Unterdrückung befreit und somit als Vorbild der feministisch-sozialistischen Bewegung in Europa und den USA dienen sollte.
Ende der 70er Jahre begannen Chinawissenschaftlerinnen die Entwicklung der Frauenbewegung in China seit dem 19. Jahrhundert, die Frauenpolitik, die Stellung und Rolle der Frau in der Volksrepublik sowie ihr Beitrag zu den historischen Ereignissen darzulegen. Diese Wissenschaftlerinnen waren nun auch in der Lage, ihre Quellen selbst zu erschließen und somit „ihre Studien zu Frauen in China in die allgemeine chinesische Entwicklung einzubetten“, wodurch sich neue feministische Ansätze zur chinaspezifischen Frauenforschung entwickelten. Die Geschichte der Frauen wurde nun nicht mehr isoliert betrachtet, sondern in die allgemeine chinesische Geschichte und auch in konkrete Themen wie politische Geschehnisse integriert. Die Entwicklung neuer feministischer Ansätze und die Herausarbeitung spezifischer Kategorien zur chinabezogenen Frauenforschung sind laut Leutner notwendig, „um nicht in die Nische von ‚women studies’ abgedrängt zu werden [...]“.
In dieser Arbeit geht es vorrangig darum, einige methodische Ansätze zum Forschungsthema Frauen in China von einzelnen Wissenschaftlerinnen darzulegen. Dazu sollen im folgenden Kapitel fünf ausgewählte Werke zur Situation der Frauen im alten (Kapitel 2.1) und neuen China (Kapitel 2.2) betrachtet werden. Anschließen werden in Kapitel 3 die Ergebnisse kurz zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Literatur
- 2.1 Die Situation der Frauen im alten China
- 2.1.1 Frauenerziehung im alten China. Eine Analyse der Frauenbücher.
- 2.1.2 The Inner Quarters. Marriage and the Lives of Chinese Women in the Sung Period
- 2.2 Die Situation der Frauen im neuen China
- 2.2.1 The Unfinished Liberation of Chinese Women, 1949-1980
- 2.2.2 Gender and Work in Urban China: Women Workers of the Unlucky Generations
- 2.2.3 Dagongmei. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen
- 3 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht methodische Ansätze zur Erforschung der Situation chinesischer Frauen in Vergangenheit und Gegenwart. Fünf ausgewählte Werke werden analysiert, um verschiedene Perspektiven auf die Rolle der Frau im alten und neuen China aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Darstellung unterschiedlicher Forschungsmethoden und der Entwicklung feministischer Ansätze in der Chinaforschung.
- Die Rolle der Frau im traditionellen China unter dem Einfluss konfuzianischer Ideologie.
- Die Entwicklung der Frauenbewegung in China seit dem 19. Jahrhundert.
- Die Stellung und Rolle der Frau in der Volksrepublik China.
- Der Einfluss der Wirtschaftsreformen und der Öffnungspolitik auf die Situation der Frauen.
- Die Entwicklung feministischer Ansätze in der Chinaforschung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Beginn intensiver Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau im alten und neuen China durch feministische Sozialwissenschaftlerinnen und Sinologinnen im Kontext der Wirtschaftsreformen unter Deng Xiaoping und der Öffnungspolitik. Sie skizziert die Entwicklung der Frauenforschung in Deutschland, beginnend mit Arbeiten von Nicht-Sinologinnen, die nach der emanzipierten chinesischen Frau suchten, hin zu chinaspezifischen feministischen Ansätzen, die die Geschichte der Frauen in den allgemeinen chinesischen Kontext einbetten.
2 Literatur: Dieses Kapitel dient als Überblick über die ausgewählten Werke, die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden. Es teilt die Literatur in zwei Teile auf: den ersten Teil, der sich mit der Situation der Frauen im alten China auseinandersetzt, und den zweiten Teil, der die Situation der Frauen im neuen China beleuchtet. Die Werke werden chronologisch nach ihrem Erscheinungsjahr aufgeführt.
2.1 Die Situation der Frauen im alten China: Dieses Kapitel untersucht die Situation der Frauen im traditionellen China anhand ausgewählter Literatur. Es beleuchtet die konfuzianische Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Frauenrolle, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch Fußbinden und die fehlende öffentliche Bildung für Frauen. Die Rolle von Frauenbüchern wie dem "Nü Si Shu" und die Vorstellung der traditionellen Frauenerziehung werden detailliert analysiert, unterstreichend, wie die konfuzianische Moralvorstellung die Frauen auf die Rolle als Ehefrau und Mutter beschränkte.
2.2 Die Situation der Frauen im neuen China: Dieses Kapitel analysiert die Situation der Frauen im neuen China anhand ausgewählter Literatur. Es geht auf die Entwicklungen nach 1949 ein, beleuchtet die anhaltende Diskriminierung und die komplexen Auswirkungen von Wirtschaftsreformen und Globalisierung auf die Lebensbedingungen von Frauen. Die ausgewählten Werke bieten Einblicke in die Arbeitswelt von Frauen, ihre Herausforderungen und die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von Frauen in verschiedenen sozialen Schichten. Das Kapitel setzt sich kritisch mit dem Thema "Emanzipation" auseinander und hinterfragt Fortschritte und anhaltende Ungleichheiten.
Schlüsselwörter
Chinesische Frauen, Frauenrolle, Konfuzianismus, Frauenbewegung, Wirtschaftsreformen, Globalisierung, Feministische Chinaforschung, Patriarchat, Emanzipation, Frauenarbeit, Geschlechterungleichheit.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Situation chinesischer Frauen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Situation chinesischer Frauen in Vergangenheit und Gegenwart anhand ausgewählter Literatur. Der Fokus liegt auf der Untersuchung unterschiedlicher Forschungsmethoden und der Entwicklung feministischer Ansätze in der Chinaforschung. Sie beleuchtet die Rolle der Frau im traditionellen China, die Entwicklung der Frauenbewegung und die Auswirkungen von Wirtschaftsreformen und Globalisierung auf die Lebensbedingungen von Frauen.
Welche Literatur wird untersucht?
Die Arbeit analysiert fünf ausgewählte Werke, die in zwei Gruppen unterteilt sind: Literatur zur Situation der Frauen im alten China (einschließlich Analysen von Frauenbüchern und Studien zur Ehe und zum Leben von Frauen in der Song-Dynastie) und Literatur zur Situation der Frauen im neuen China (mit Fokus auf die Zeit nach 1949 und die Auswirkungen von Wirtschaftsreformen und Globalisierung). Die einzelnen Werke werden chronologisch aufgeführt und im Detail im Kapitel 2 besprochen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Rolle der Frau im traditionellen China unter konfuzianischem Einfluss, die Entwicklung der Frauenbewegung seit dem 19. Jahrhundert, die Stellung der Frau in der Volksrepublik China, der Einfluss von Wirtschaftsreformen und Öffnungspolitik auf die Situation der Frauen und die Entwicklung feministischer Ansätze in der Chinaforschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Literaturkapitel (unterteilt in den alten und neuen China), eine Zusammenfassung und ein Kapitel mit Schlüsselbegriffen. Das Literaturkapitel bietet einen detaillierten Überblick über die analysierten Werke. Die Einleitung skizziert die Entwicklung der Frauenforschung in Deutschland und den Kontext der Arbeit. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit wendet eine methodische Analyse der ausgewählten Literatur an, um verschiedene Perspektiven auf die Rolle der Frau im alten und neuen China aufzuzeigen. Sie untersucht Forschungsmethoden und die Entwicklung feministischer Ansätze in der Chinaforschung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Relevante Schlüsselbegriffe sind: Chinesische Frauen, Frauenrolle, Konfuzianismus, Frauenbewegung, Wirtschaftsreformen, Globalisierung, Feministische Chinaforschung, Patriarchat, Emanzipation, Frauenarbeit und Geschlechterungleichheit.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse des alten China?
Die Analyse des alten China beleuchtet die konfuzianische Ideologie und deren Auswirkungen auf die Frauenrolle, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit (Fußbinden), den Mangel an öffentlicher Bildung für Frauen und die Rolle von Frauenbüchern in der traditionellen Frauenbildung. Es wird gezeigt, wie die konfuzianische Moralvorstellung Frauen auf die Rolle als Ehefrau und Mutter beschränkte.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse des neuen China?
Die Analyse des neuen China untersucht die Entwicklungen nach 1949, die anhaltende Diskriminierung von Frauen und die komplexen Auswirkungen von Wirtschaftsreformen und Globalisierung auf die Lebensbedingungen von Frauen. Sie bietet Einblicke in die Arbeitswelt von Frauen, ihre Herausforderungen und die unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen von Frauen in verschiedenen sozialen Schichten. Die Arbeit setzt sich kritisch mit dem Thema "Emanzipation" auseinander und hinterfragt Fortschritte und anhaltende Ungleichheiten.
- Arbeit zitieren
- Manxi Zeidler (Autor:in), 2014, Die Situation der chinesischen Frau im alten und neuen China, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295706