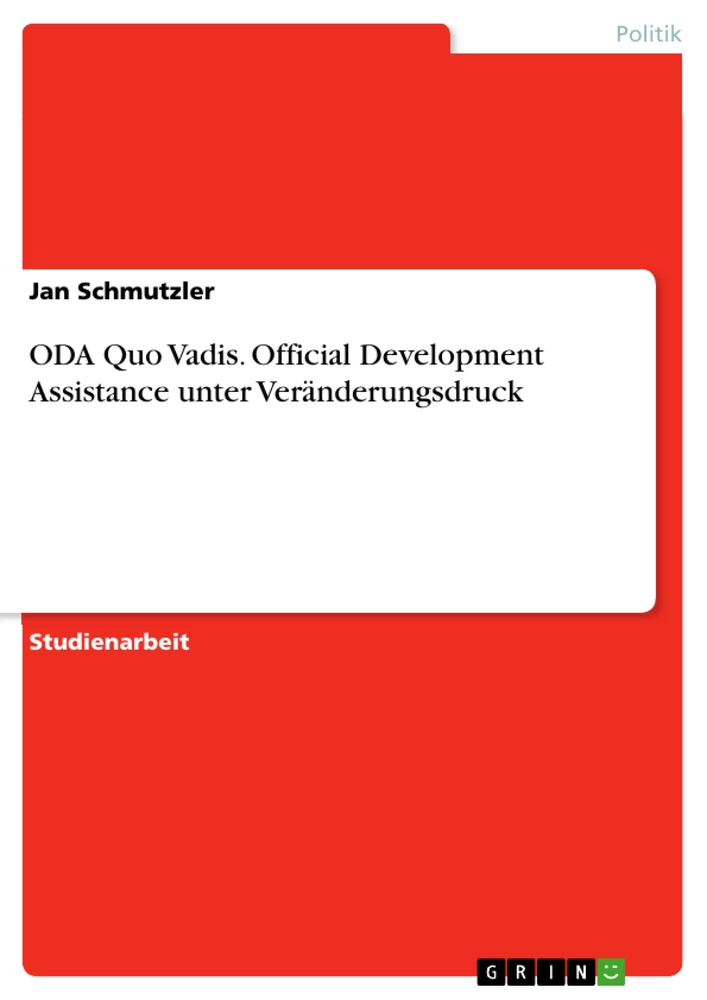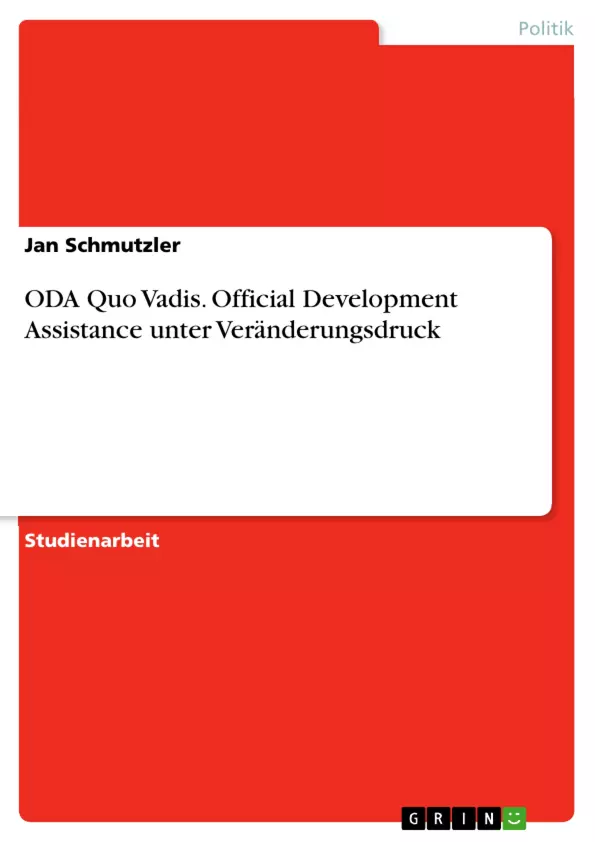Wenn man heute über die Finanzierung von Entwicklungspolitik spricht, ist der zentrale Begriff ODA. Doch was steckt überhaupt hinter diesen drei Buchstaben und wieso steht diese Kennzahl in letzter Zeit so in der Kritik? Ist es überhaupt noch zeitgemäß Entwicklungspolitik, die sich längst vom Gießkannenprinzip losgesagt hat am Wasserstand derselben zu bemessen?
In der Fachliteratur häufen sich die Vorschläge zur Reform der ODA. Dabei geht es vor allem um die Frage wie breit die ODA sein sollen, d.h. welche Ausgaben dazugezählt werden sollen und welche nicht. Während NRO dabei traditionell eher für strenge Kriterien plädieren, gibt es von offizieller Seite eher den Wunsch das Aggregat zu erweitern. So oder so wird man sich fragen müssen, warum man es seit den 70er Jahren nicht geschafft hat das selbst gesteckte Ziel ,0,7% des BNE für ODA
aufzuwenden, nicht erreicht hat. Nachdem ich kurz die Geschichte sowie einige Daten zur ODA vorgestellt habe, werde ich mich kritisch mit einigen Ausgaben auseinandersetzen, die bisher als ODA zählen. Anschließend werde ich auch eine mögliche Erweiterung bzw. Anpassung des ODA-Begriffs diskutieren. Im Schlussteil werde ich dann abwägen ob eine Reform der ODA überhaupt noch Sinn macht oder ob man eher einen radikalen Schlussstrich unter diese Ära der
Entwicklungszusammenarbeit ziehen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte
- technische Zusammenarbeit
- weitere Massnahmen, die in der Kritik stehen
- Kredite
- Reformvorschläge
- Qualitätsstandards
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich kritisch mit der Official Development Assistance (ODA) und deren Bedeutung für die Finanzierung von Entwicklungspolitik. Der Autor hinterfragt die Relevanz des 0,7%-Zieles, das seit den 70er Jahren von den DAC-Mitgliedsstaaten angestrebt wird, aber nur von wenigen Ländern erreicht wird. Der Text analysiert die Geschichte der ODA, untersucht verschiedene Kritikpunkte an der aktuellen Definition und Bemessungsgrundlage, und diskutiert mögliche Reformen oder Alternativen zur ODA.
- Entwicklung und Geschichte der ODA
- Kritik an der Definition und Bemessungsgrundlage der ODA
- Relevanz des 0,7%-Zieles
- Mögliche Reformen und Alternativen zur ODA
- Die Rolle von Nichtregierungsorganisationen (NROs) in der Entwicklungszusammenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in das Thema ODA ein und stellt die zentrale Fragestellung des Textes vor: Ist die ODA noch zeitgemäß und sinnvoll? Das Kapitel "Geschichte" beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der ODA, insbesondere die Festlegung des 0,7%-Zieles und die aktuelle Situation der ODA-Quote in verschiedenen Ländern. Die Kapitel "technische Zusammenarbeit", "weitere Massnahmen, die in der Kritik stehen" und "Kredite" diskutieren verschiedene Ausgaben, die bisher zur ODA gezählt werden, und hinterfragen deren Sinnhaftigkeit und Effektivität. Das Kapitel "Reformvorschläge" beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen zur Reform der ODA und der Erweiterung bzw. Anpassung des ODA-Begriffs.
Schlüsselwörter
ODA, Entwicklungszusammenarbeit, 0,7%-Ziel, DAC-Mitgliedsstaaten, technische Zusammenarbeit, Kredite, Reformvorschläge, Nichtregierungsorganisationen (NROs), Entwicklungshilfe, Bruttonationaleinkommen (BNE), Kritik, Effektivität, Qualität, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung ODA?
ODA steht für Official Development Assistance (Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) und bezeichnet staatliche Mittel, die zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern eingesetzt werden.
Was besagt das 0,7%-Ziel?
Das Ziel sieht vor, dass Industrieländer 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens (BNE) für öffentliche Entwicklungshilfe aufwenden sollen. Dieses Ziel wurde bereits in den 1970er Jahren formuliert.
Warum steht die aktuelle ODA-Definition in der Kritik?
Kritiker bemängeln, dass zu viele Ausgaben (wie bestimmte Kredite oder inländische Flüchtlingskosten) eingerechnet werden, die nicht direkt der Armutsbekämpfung vor Ort dienen.
Welche Reformvorschläge gibt es für die ODA?
Vorschläge reichen von einer strengeren Eingrenzung der Kriterien durch NROs bis hin zu einer Erweiterung des Begriffs durch offizielle Stellen, um neue Formen der Finanzierung einzuschließen.
Welche Rolle spielen Nichtregierungsorganisationen (NROs)?
NROs fordern oft höhere Qualitätsstandards und Transparenz bei der Vergabe von ODA-Mitteln, um sicherzustellen, dass die Hilfe effektiv bei den Zielgruppen ankommt.
- Citar trabajo
- Jan Schmutzler (Autor), 2015, ODA Quo Vadis. Official Development Assistance unter Veränderungsdruck, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295758