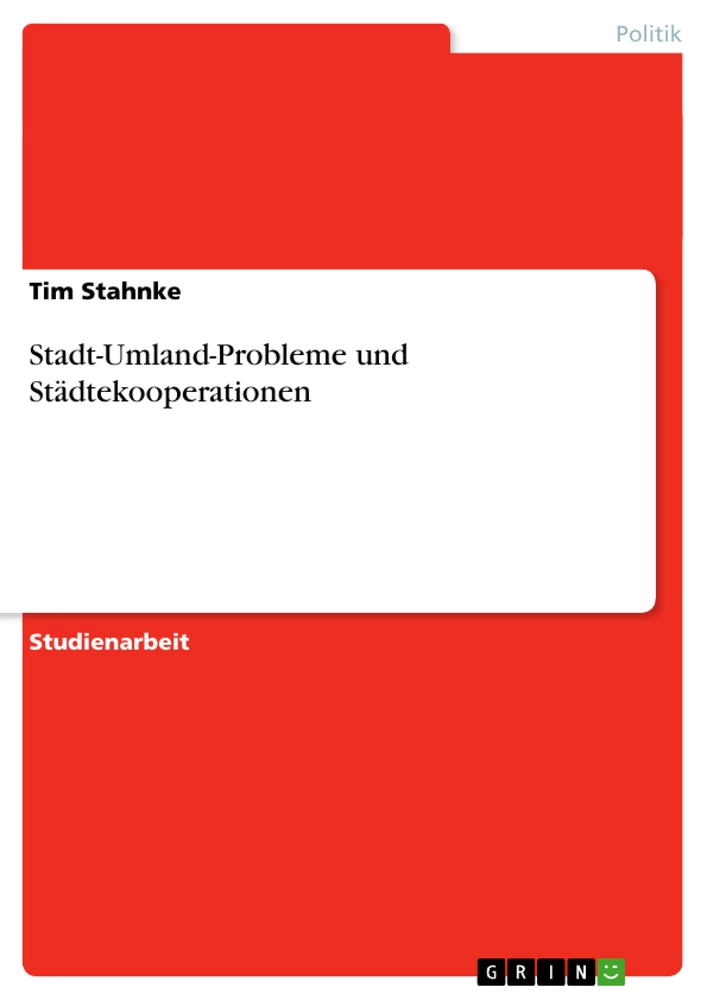Die Stadt und ihr Umland – eine Schicksalsgemeinschaft. Gegenseitige Abhängigkeiten aber auch Vorurteile haben dieses Verhältnis vielerorts zu einer „Hassliebe“ werden lassen. Die Stadt benötigt das Umland als Ressourcenbereitsteller, das Umland die Stadt wegen der Infrastruktur und dem Arbeitsmarkt. Die Stadt und ihr Umland waren, sind und werden immer untrennbar miteinander verbunden bleiben. Seit einigen Jahrzehnten verschärfen sich allerdings die Probleme im Stadt-Umland-Verhältnis. Als Hauptursache, wird zum einen die „Stadtflucht“ der Bevölkerung und die daraus resultierende Suburbanisierung des Umlandes ausgemacht. Die Stadt als Wohnraum wird immer unbeliebter, die Bevölkerungszahlen der Städte stagnieren oder nehmen leicht ab, die des Umlandes steigen an. Im ersten Teil dieser Hausarbeit wird zunächst die Suburbanisierung als Ursache der Stadt-Umland-Problematik dargestellt und ihre Folgen auf die Sozialstruktur sowie auf die finanzielle Situation der Städte und des Umlandes erläutert. Die Gründe für die Suburbanisierung, also dem Fortzug der Stadtbevölkerung und die Verlagerung von Betrieben und Firmen weg von der Stadt hinein ins Umland, werden im zweiten Abschnitt dieses ersten Teils der Arbeit beleuchtet. Das heutige Konfliktpotenzial, das auf Grund dieser Entwicklung der Stadt-Umland-Problematik entstanden ist, wird dann im dritten Abschnitt erläutert.
Der zweite Teil dieser Hausarbeit beschäftigt sich mit Lösungsansätzen zur Bewältigung der zuvor dargestellten Stadt-Umland-Problematik. Vor allem der neu geschaffene gemeinsame europäische Binnenmarkt, in dem heute fast ausschließlich die großen europäischen Regionen miteinander konkurrieren, verstärkt den Druck eine Lösung dieser Problematik zu finden. Schließlich will man auch zukünftig im europäischen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben. Im ersten Abschnitt des zweiten Teils dieser Hausarbeit werden deshalb die unterschiedlichen Kooperationsansätzen zwischen Stadt und Umland dargestellt. Aus der Palette der verschiedensten Ansätze in Deutschland werden dann die Zweckverbände und die Mehrzweckverbände, als die am bewährtesten Kooperationsansätze, herausgestellt und ihre Gestalt, ihre Aufgabenpaletten sowie die Arbeitsweisen anhand von Beispielen näher erläutert. Anhand des Beispieles des „Verbandes Region Stuttgart“ soll schließlich im dritten Teil dieser Hausarbeit die Konstruktion eines Mehrzweckverbandes in einem klassischen Ballungsraum beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stadt-Umland-Problematik
- Suburbanisierung als Ursache
- Gründe für die Suburbanisierung
- Konfliktpotenzial zwischen Stadt und Umland
- Konfliktlösungsansätze – Städtekooperationen
- Formen interkommunaler Zusammenarbeit
- Zweckverbände
- Mehrzweckverbände
- Der Verband Region Stuttgart
- Formen interkommunaler Zusammenarbeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Stadt-Umland-Problematik, die durch die wechselseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Kernstädten und ihrem Umland gekennzeichnet ist. Die Arbeit beleuchtet die Suburbanisierung als Ursache der Problematik und analysiert die Gründe für den Wegzug von Bevölkerung und Betrieben aus den Städten. Darüber hinaus werden die daraus resultierenden Konflikte zwischen Stadt und Umland untersucht und mögliche Lösungsansätze, insbesondere im Kontext der Städtekooperationen, vorgestellt.
- Suburbanisierung und ihre Auswirkungen auf die Sozialstruktur und die finanzielle Situation von Städten und Umland
- Gründe für den Wegzug von Bevölkerung und Unternehmen aus den Städten, wie z.B. hohe Grundstückspreise, Platzmangel und veränderte Betriebsformen
- Konflikte zwischen Stadt und Umland, die aus der Suburbanisierung entstehen, wie z.B. Segregationsprozesse und Ungleichverteilung der Kosten
- Formen interkommunaler Zusammenarbeit, wie z.B. Zweckverbände und Mehrzweckverbände, als Lösungsansätze für die Stadt-Umland-Problematik
- Der "Verband Region Stuttgart" als Beispiel für einen Mehrzweckverband in einem Ballungsraum
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Stadt-Umland-Problematik ein und erläutert die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Stadt und Umland. Das erste Kapitel beleuchtet die Suburbanisierung als Ursache der Problematik, beschreibt die Folgen für die Sozialstruktur und die finanzielle Situation der Städte und des Umlandes und analysiert die Gründe für den Wegzug von Bevölkerung und Betrieben aus den Städten.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Konfliktlösungsansätzen und fokussiert auf die interkommunale Zusammenarbeit. Es stellt verschiedene Formen von Kooperationsansätzen vor und hebt dabei Zweckverbände und Mehrzweckverbände als bewährte Modelle hervor.
Das dritte Kapitel analysiert den "Verband Region Stuttgart" als Beispiel für einen Mehrzweckverband in einem Ballungsraum. Es beschreibt den Aufbau des Verbandes, die ihm übertragenen Aufgaben und seine Arbeitsweise auf der horizontalen und vertikalen Ebene. Außerdem werden Grenzen und Probleme des Verbandes im Kontext seiner Arbeit aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Stadt-Umland-Problematik, Suburbanisierung, Konfliktpotenzial, Städtekooperationen, Zweckverbände, Mehrzweckverbände und der "Verband Region Stuttgart". Darüber hinaus werden weitere wichtige Themen wie die Segregationsprozesse, die finanzielle Situation von Städten und Umland, die interkommunale Zusammenarbeit und die Aufgaben und Arbeitsweisen eines Mehrzweckverbandes behandelt.
- Citar trabajo
- Tim Stahnke (Autor), 2004, Stadt-Umland-Probleme und Städtekooperationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29576