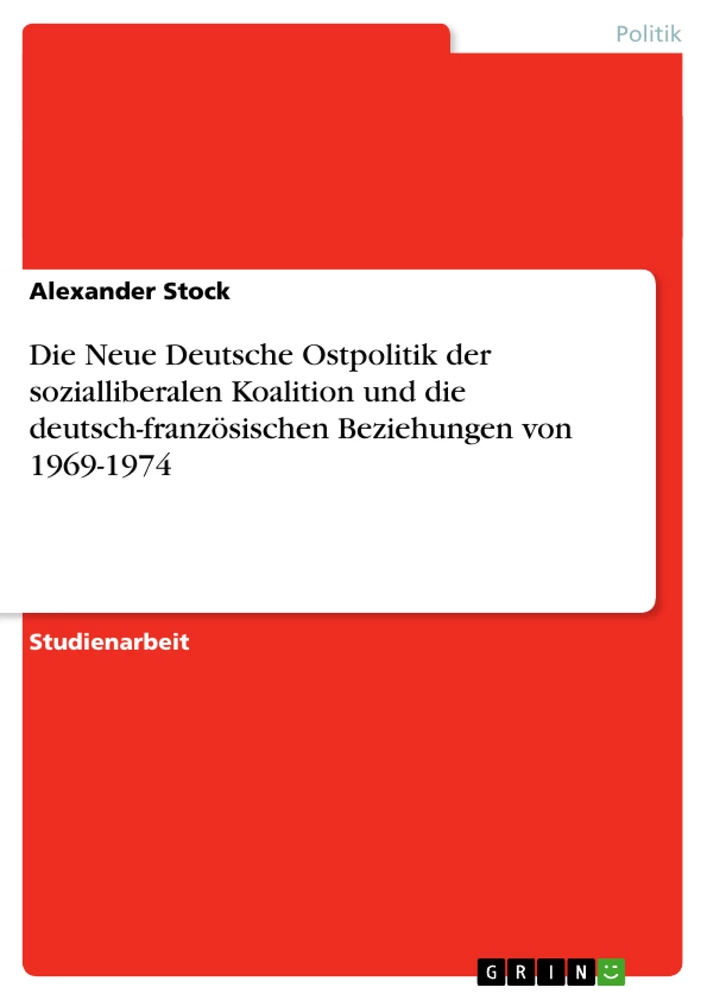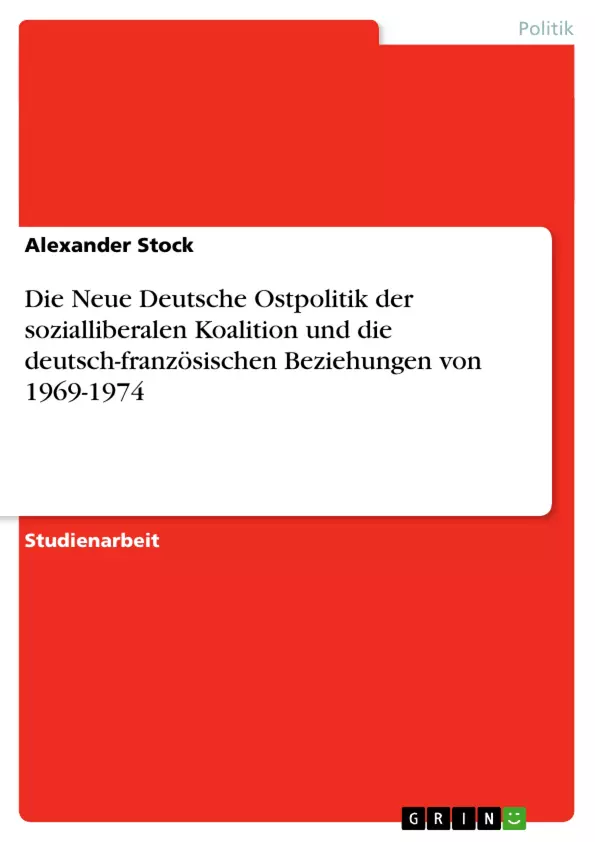In der Hauptseminararbeit „Die Neue deutsche Ostpolitik der sozialliberalen Koalition und die deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1969-1974“ wird analysiert, welche internationalen und nationalen Gründe und Hintergründe für die ‚Neue Ostpolitik’ der Regierung Brandt bestanden und welche neuen politischen Aspekte die außenpolitische Arbeit der sozialliberalen Koalition in Deutschland und ihr französisches Pendant in der ‚Ära Brandt-Pompidou’ kennzeichneten.
Dabei richtet sich das Hauptaugenmerk einmal auf das Verhältnis zwischen der Außenpolitik der deutschen Regierungen bis 1969 und der von SPD-FDP bestimmten Außenpolitik vom Regierungswechsel 1969 bis zum Übergang zu Helmut Schmidt im Jahre 1974, und zweitens auf die Frage, wie die westdeutsche Ostpolitik und die damit verbundenen Fragen vom Nachbarland Frankreich aufgenommen wurden.
Zuerst geht die Arbeit auf die Rahmenbedingungen und zu Grunde liegenden Gegebenheiten ein, mit denen sich die Bundesrepublik bezüglich der Außenpolitik konfrontiert sah und welche eigenen Akzente bis 1969 selber gesetzt wurden. Der Übergang von einer internationalen Konfrontationspolitik zu einer Entspannungspolitik wird hervorgehoben und die Frage geklärt, ob die Regierung Brandt außenpolitischen Neuorientierungen und Umbrüchen unterworfen war oder sich doch eher in einer außenpolitischen Kontinuität befand.
Darauf folgt eine genauere Betrachtung der Außenpolitik Brandts und seines Außenministers Scheel. Es wird die Frage gestellt, welche Relevanz und Bedeutung ihre außenpolitisch gesteckten Ziele hatten, welche Notwendigkeiten einer Ostpolitik bestanden und wie sich die Politik in den internationalen Kontext einordnen lässt.
Um die Abläufe und das Ergebnis dieser Brandt’schen Außenpolitik mitsamt den Reaktionen aus Paris ersichtlicher erscheinen zu lassen, soll in einzelnen Kapiteln genauer auf die Verträge von Moskau und Warschau sowie den Grundlagenvertrag und das Viermächteabkommen eingegangen werden. Neben den wichtigsten Ergebnissen und Hintergründen kann besonders in diesen Unterkapiteln deutlich gemacht werden, in welcher Weise Frankreich die eigenen Interessen berührt sah, welche Konsequenzen die Ostpolitik aus französischer Sicht mit sich zogen und inwiefern die deutsche Politik befürwortet, gefürchtet oder abgelehnt wurde.
Abschließend wird der Blick auf die Auswirkungen der Ostpolitik nach 1974 geworfen und ein Fazit der deutsch-französischen Beziehungen zwischen 1969-1974 formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übergang von der Konfrontationspolitik zur Entspannungspolitik vor 1969
- Vorfeld und Rahmenbedingungen
- Die Ostpolitik de Gaulles vor 1969
- Die „Neue“ deutsche Ostpolitik der Regierung Brandt / Scheel und die deutsch-französischen Beziehungen
- Hintergründe der „Neuen“ deutschen Ostpolitik und französische Positionen
- Moskauer Vertrag von 1970
- Warschauer Vertrag von 1970
- Viermächteabkommen von 1971
- Grundlagenvertrag von 1972 und französisch-ostdeutsche Beziehungen
- Auswirkungen der „Neuen Ostpolitik“
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gründe und Hintergründe für die „Neue Ostpolitik“ der Regierung Brandt sowie die neuen politischen Aspekte, die die Außenpolitik der sozialliberalen Koalition in Deutschland und Frankreich in der „Ära Brandt-Pompidou“ prägten. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen der deutschen Außenpolitik bis 1969 und der von SPD und FDP bestimmten Politik von 1969 bis 1974. Die Arbeit untersucht zudem, wie die westdeutsche Ostpolitik und ihre damit verbundenen Fragen von Frankreich aufgenommen wurden.
- Die Entwicklung der deutschen Außenpolitik von der Konfrontations- zur Entspannungspolitik.
- Die „Neue Ostpolitik“ der Regierung Brandt und ihre Hintergründe.
- Die französischen Positionen zur neuen westdeutschen Politikorientierung.
- Die Auswirkungen der „Neuen Ostpolitik“ auf die deutsch-französischen Beziehungen.
- Die Reaktionen Frankreichs auf die Verträge von Moskau, Warschau, den Grundlagenvertrag und das Viermächteabkommen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des Vorfeldes und der Rahmenbedingungen, denen sich die Bundesrepublik in Bezug auf ihre Außenpolitik gegenüber sah. Dabei werden die außenpolitischen Ziele Adenauers, Erhardts und Kiesingers kurz beleuchtet, um zu untersuchen, ob die Regierung Brandt einem außenpolitischen Wandel unterworfen war oder eher eine Kontinuität fortsetzte.
Kapitel 2 beleuchtet den langsamen Übergang von der internationalen Konfrontationspolitik zu einer Entspannungspolitik. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Ostpolitik de Gaulles vor 1969 als Beispiel für Entspannungsbemühungen.
Kapitel 3 befasst sich mit der Außenpolitik Brandts und Scheels und untersucht die Relevanz ihrer außenpolitischen Ziele, die Hintergründe und Notwendigkeiten einer Ostpolitik und die Einordnung der Politik in den internationalen Kontext. Dabei spielen die französischen Positionen zur neuen westdeutschen Politikorientierung eine zentrale Rolle.
Die Kapitel 4 bis 5 werden sich detailliert mit den Verträgen von Moskau, Warschau sowie dem Grundlagenvertrag und dem Viermächteabkommen auseinandersetzen. Sie analysieren die wichtigsten Ergebnisse, Hintergründe und französischen Reaktionen auf die deutsche Ostpolitik, die Auswirkungen der Politik auf französische Interessen und die Bewertung der deutschen Politik durch Frankreich.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die „Neue Ostpolitik“ der sozialliberalen Koalition in Deutschland, die deutsch-französischen Beziehungen in der „Ära Brandt-Pompidou“ und die französischen Reaktionen auf die neue deutsche Außenpolitik. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Entspannungspolitik, Konfrontationspolitik, Westintegration, Hallstein-Doktrin, Moskauer Vertrag, Warschauer Vertrag, Viermächteabkommen, Grundlagenvertrag, deutsch-französisches Bündnis.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der "Neuen Ostpolitik" unter Willy Brandt?
Es war der Übergang von einer Politik der Konfrontation hin zur Entspannungspolitik gegenüber den osteuropäischen Staaten.
Wie reagierte Frankreich auf die deutsche Ostpolitik?
Frankreich sah eigene Interessen berührt und reagierte mit einer Mischung aus Befürwortung, Sorge um das Machtgleichgewicht und Skepsis.
Welche Verträge waren zentral für die Ostpolitik?
Die wichtigsten Abkommen waren der Moskauer Vertrag (1970), der Warschauer Vertrag (1970), das Viermächteabkommen (1971) und der Grundlagenvertrag (1972).
Was bedeutete die Hallstein-Doktrin vor 1969?
Sie war Teil der Konfrontationspolitik und besagte, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR durch Drittstaaten als unfreundlicher Akt gegenüber der BRD galt.
Wer prägte die deutsch-französischen Beziehungen in dieser Ära?
Die Ära wurde maßgeblich durch die Zusammenarbeit zwischen Bundeskanzler Willy Brandt und dem französischen Präsidenten Georges Pompidou geprägt.
- Quote paper
- Alexander Stock (Author), 2004, Die Neue Deutsche Ostpolitik der sozialliberalen Koalition und die deutsch-französischen Beziehungen von 1969-1974, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29580