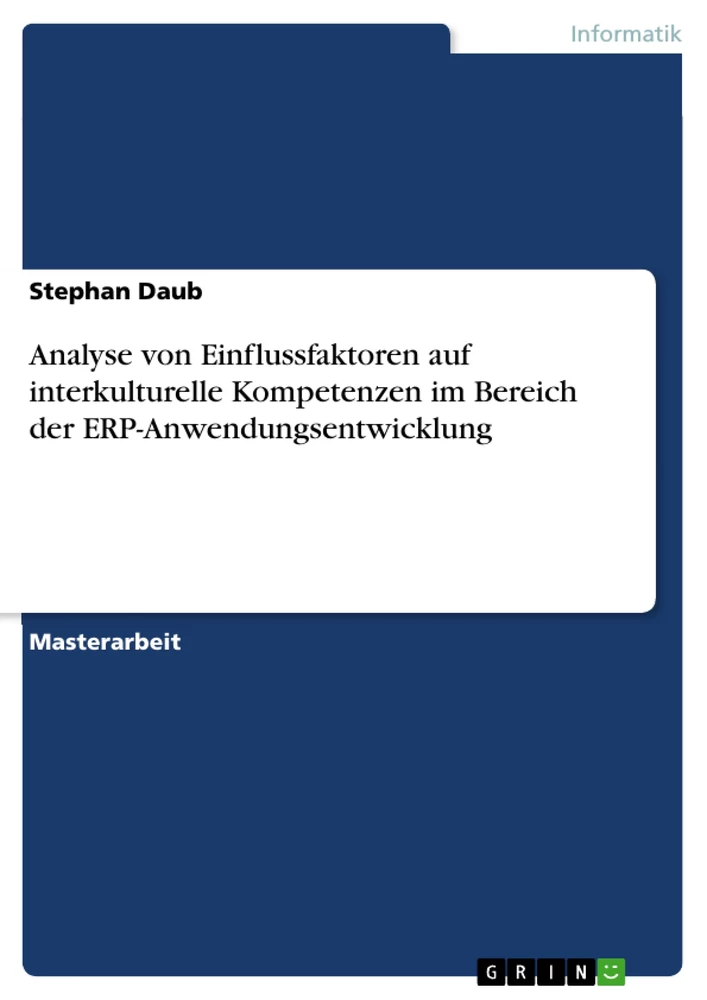International operierende Unternehmen und andere Institutionen sind aufgrund der wirtschaftlichen Vernetzung und des daraus resultierenden Handlungsdruckes gezwungen, sich der Herausforderung des organisationalen Wandels zu stellen. Die Analyse der Kompetenzprofile der Mitarbeiter ist dabei für den Erfolg der Veränderungsmaßnahme von entscheidender Bedeutung. Insbesondere in den Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche, die zugleich Wachstumstreiber für viele andere Industrien darstellen, kann die Analyse von Kompetenzprofilen und gezielte Förderung der Mitarbeiterkompetenzen die Veränderungsprozesse positiv beeinflussen. Im Rahmen von global organisierten Entwicklungsteams werden neben den notwendigen Fachkompetenzen vor allem auch Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der interkulturellen Zusammenarbeit benötigt. Vor allem in den Fachabteilungen Entwicklung, Beratung, Service und Support müssen interkulturelle Aspekte beim täglichen Kontakt mit Kunden und Kollegen besonders berücksichtigt werden.
Die vorliegende Arbeit stellt zunächst die zugrundeliegende Begriffswelt vor und zeigt die verschiedenen Sichtweisen auf Kompetenz und den Kompetenzerwerb auf. Speziell wird dann der Begriff der interkulturellen Kompetenz erläutert, wichtige Kulturmodelle analysiert und das Handlungsfeld der Interkulturalität aus der Sicht der Unternehmen definiert. Vertiefend wird danach auf die Herausforderungen im Rahmen der global verteilten und organisierten Entwicklung von ERP-Anwendungen eingegangen.
Aufbauend auf dieser Literaturarbeit werden zwei Forschungsfragen formuliert, die im Rahmen einer repräsentativen Umfrage bearbeitet werden. Die varianzanalytische Auswertung liefert dabei vertiefende Ergebnisse und Antworten. Er werden darüber hinaus zusätzliche Daten erhoben und interpretiert, die es erlauben, Rückschlüsse auf die interkulturellen Bemühungen innerhalb der Unternehmen zu ziehen, und den Prozess des interkulturellen Kompetenzerwerbs in global verteilten Entwicklungsteams zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit
- Motivation
- Reorganisation und Kompetenz
- Ausgangslage
- Modelle für Veränderungen
- Zwischenfazit
- Dimensionen der Kompetenz
- Historische Entwicklung
- Definition und Einordnung
- Konzepte
- Behavioristischer Ansatz
- Generische Skills und Schlüsselqualifikationen
- Kognitiver Ansatz
- Zusammenfassung
- Nutzen für Unternehmen
- Kompetenz - Baustein der strategischen Führung
- Kompetenzfalle
- Kompetenz - Fähigkeit oder Qualifikation?
- Soft Skills und Hard Skills
- Kompetenzmessung
- Zusammenfassung und Zwischenfazit
- Interkulturelle Aspekte der Kompetenz
- Interkulturalität und Globalisierung
- Interkulturelle Modelle
- Kulturdimensionen nach Hofstede
- Erläuterungen
- Kritik
- Kulturdimensionen nach Trompenaars
- Erläuterungen
- Kritik
- Kulturmodell nach Hall
- Erläuterungen
- Kritik
- Weitere Kulturmodelle
- GLOBE-Studie
- Erweitertes Hofstede-Modell
- Jenseits von Hofstede
- Weitere Kulturmodelle
- Zwischenfazit
- Interkulturalität aus Sicht der Unternehmen
- Interkulturelle Kompetenz
- Kompetenzen im Rahmen globaler und verteilter Softwareentwicklung
- Arbeiten im globalen Team
- Umgang mit Distanz und Zeit
- Tätigkeitsfelder der ERP-Anwendungsentwicklung
- Kompetenzfelder der ERP-Anwendungsentwicklung
- Interkulturelle Anwendungsentwicklung
- Forschungsfragestellungen
- Methodik
- Nullhypothesen
- Studiendesign
- Ausgangslage und Studienmaterial
- Untersuchungsinstrument
- Aufbau
- Gütekriterien
- Datenerfassung und Datenanalyse
- Datenerfassung
- Aufbau der Webseite
- Umfragewerkzeug und IT-Backend
- Einbindung von Google-Analytics
- Anreicherung des Datenmodells
- Datenübernahme in Excel
- Verarbeitung in SPSS
- Datenanalyse
- Plausibilitätsprüfung der Datensätze
- Datenanreicherung (Berechnung der Kultur-Indizes)
- Befragungsergebnisse und Diskussion
- Charakterisierung der Stichprobe
- Kulturelle und geografische Verteilung
- Interkulturelle Kompetenz in der IT-Branche
- Einflussfaktoren auf interkulturelle Kompetenzen
- Kompetenzerwerb in global verteilten Entwicklungsteams
- Herausforderungen der interkulturellen Zusammenarbeit
- Analyse von Kulturmodellen und deren Relevanz für die IT-Industrie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen im Bereich der ERP-Anwendungsentwicklung. Sie analysiert die Einflussfaktoren auf interkulturelle Kompetenzen und untersucht, ob Lebensalter und Dauer der Berufstätigkeit einen Einfluss auf die interkulturellen Profile von Mitarbeitern in der IT-Branche haben. Die Arbeit befasst sich außerdem mit dem Kompetenzerwerb in global verteilten Entwicklungsteams und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der interkulturellen Zusammenarbeit in diesem Kontext verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Motivation der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Dimensionen der Kompetenz im Allgemeinen betrachtet, bevor im nächsten Kapitel die interkulturellen Aspekte der Kompetenz im Fokus stehen. Dabei werden verschiedene Kulturmodelle vorgestellt und analysiert. Die Arbeit befasst sich anschließend mit der Bedeutung von interkulturellen Kompetenzen in der ERP-Anwendungsentwicklung und den Herausforderungen der globalen Zusammenarbeit. Im Methodenteil wird das Studiendesign, das Untersuchungsinstrument und die Datenerhebung und -analyse vorgestellt. Abschließend werden die Ergebnisse der Befragung und deren Diskussion präsentiert.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, ERP-Anwendungsentwicklung, IT-Branche, Globalisierung, Kulturmodelle, Kompetenzentwicklung, Entwicklungsteams, Veränderungsprozesse, Kompetenzprofile, Soft Skills, Hard Skills, Forschungsfragestellungen, Datenanalyse, Varianzanalyse, Befragungsergebnisse.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist interkulturelle Kompetenz in der ERP-Entwicklung wichtig?
Da ERP-Projekte oft global verteilt sind, müssen Entwickler und Berater effektiv mit internationalen Kollegen und Kunden zusammenarbeiten, um Missverständnisse und Zeitverluste zu vermeiden.
Welche Kulturmodelle werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht unter anderem die Modelle von Hofstede, Trompenaars, Hall sowie die GLOBE-Studie.
Haben Alter und Berufserfahrung Einfluss auf die interkulturelle Kompetenz?
Dies ist eine der zentralen Forschungsfragen, die mittels einer varianzanalytischen Auswertung einer Umfrage untersucht werden.
Was sind die größten Herausforderungen in globalen IT-Teams?
Dazu gehören der Umgang mit räumlicher Distanz, unterschiedlichen Zeitzonen und verschiedenen Kommunikationsstilen.
Wie können Unternehmen den Erwerb interkultureller Kompetenz fördern?
Durch gezielte Trainings, die Analyse von Kompetenzprofilen und die Schaffung einer Unternehmenskultur, die Vielfalt wertschätzt.
- Quote paper
- Stephan Daub (Author), 2012, Analyse von Einflussfaktoren auf interkulturelle Kompetenzen im Bereich der ERP-Anwendungsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295816