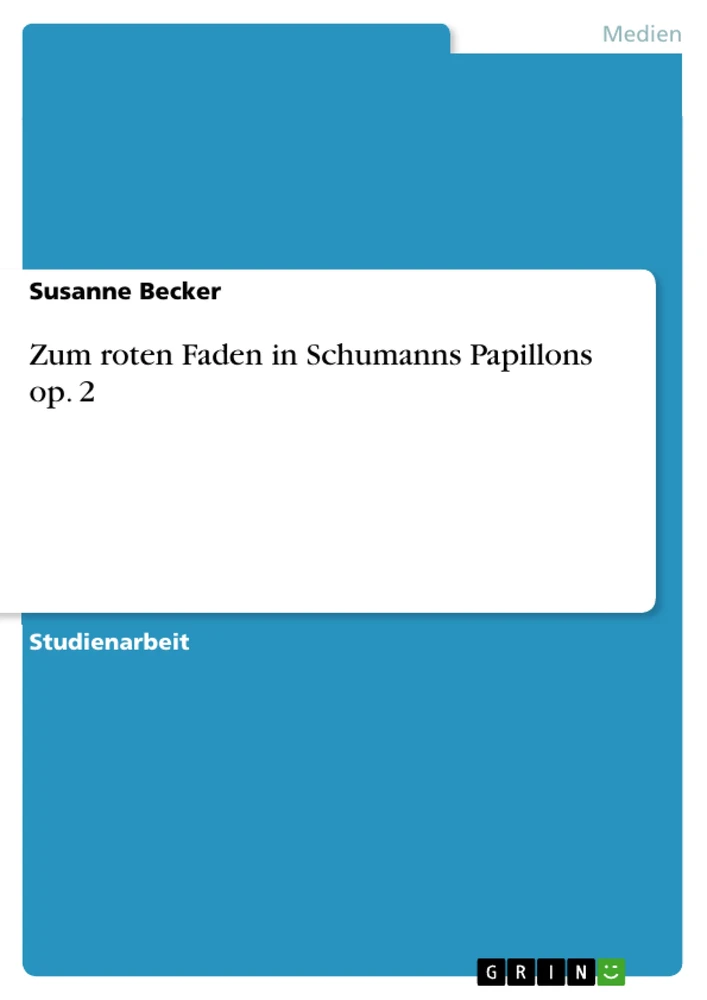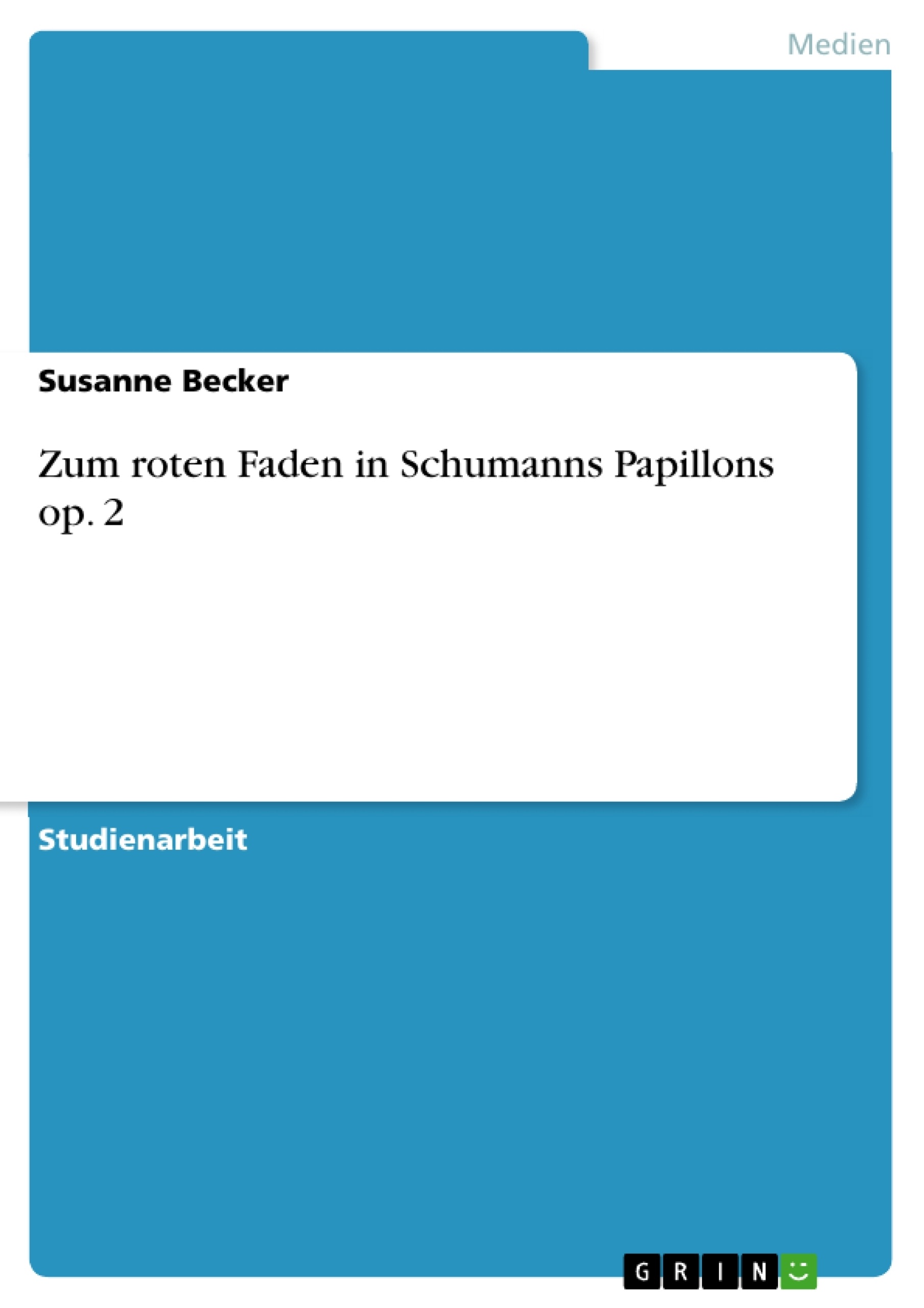Den beim Publikum und in der Klavierpädagogik durchaus beliebten zwölfteiligen Klavierzyklus Papillons op. 2 komponierte Robert Schumann in seiner Jugendzeit von 1829 bis 1832 (vgl. Loos 2005: 9). Doch was hält die „stark kontrastierenden Stücke mit raschen Szenenwechseln“ (vgl. Tadday 2006: 125) zusammen? Gibt es einen roten Faden, der sich durch das Werk zieht und die ihm zugeschriebene Bezeichnung „Zyklus“ rechtfertigt? Oder handelt es sich viel mehr um eine Reihe voneinander unabhängiger Tanz-und Charakterstücke (vgl. Jensen 1998: 141)?
Zur Untersuchung dieser vielschichtigen Frage prüft die vorliegende Arbeit zunächst die Entstehungsgeschichte der Papillons, um zu enthüllen, inwieweit das Werk nach einer bestimmten Leitlinie komponiert wurde. Danach rückt der Notentext in den Fokus, anhand dessen eine kurze tonart- und charakterbezogene Analyse Aufschluss über eventuelle Zusammenhänge geben soll, bevor das Programm von op.
2, das auf den ersten Blick alles andere als offensichtlich ist, behandelt wird. Liegt hier der Kern des Zyklus? Um diese Frage beantworten zu können, ist eine detailliertere Analyse der Papillons nötig, die musikalische Aspekte mit programmatischen
verbindet und ihre Übereinstimmung bewertet. Schließlich erfolgt ein Abgleich mit typischen Schumannschen Stilistiken. Sind sie auch in op. 2 leitende Prinzipien?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Entstehung
- 2 Tonart- und charakterbezogene Analyse
- 3 Programm
- 4 Musikalisch-programmatische Analyse
- 5 Weitere mögliche Leitgedanken
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Robert Schumanns Klavierzyklus „Papillons“ op. 2 und untersucht die Frage nach einem roten Faden, der sich durch das Werk zieht. Die Arbeit analysiert die Entstehungsgeschichte, die Tonarten und Charaktere der einzelnen Stücke sowie das Programm des Zyklus, das auf Jean Pauls Roman „Flegeljahre“ zurückgeht.
- Entstehungsgeschichte der Papillons
- Tonale und charakterliche Analyse der Stücke
- Programmatische Verbindung zu Jean Pauls „Flegeljahre“
- Musikalische Analyse im Kontext des programmatischen Bezugs
- Schumannsche Stilistiken und deren Einfluss auf die Papillons
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem roten Faden in Schumanns „Papillons“ op. 2.
- Kapitel 1 beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Zyklus und zeigt auf, dass die einzelnen Stücke zwar teilweise aus bereits vorhandenen Motiven entstanden sind, aber kein durchdachtes Gesamtkonzept zu Beginn vorhanden war.
- Kapitel 2 analysiert die Tonarten und Charaktere der einzelnen Stücke und stellt fest, dass eine deutliche Instabilität vorherrscht und kein klarer tonaler Zusammenhang erkennbar ist.
- Kapitel 3 diskutiert das Programm des Zyklus, das auf den Maskenball in Jean Pauls „Flegeljahre“ zurückgeht. Es wird gezeigt, dass Schumann das Programm nicht konsequent umgesetzt hat und es dem Zuhörer ohne entsprechende Vorkenntnisse schwerfällt, den Bezug zur Musik zu verstehen.
- Kapitel 4 bietet eine detaillierte musikalisch-programmatische Analyse der einzelnen Papillons und zeigt die Verbindung zu den entsprechenden Textstellen aus den „Flegeljahren“ auf. Es werden intertextuelle Zitate und stilistische Elemente beleuchtet.
- Kapitel 5 behandelt weitere mögliche Leitgedanken, die Schumanns Kompositionsweise beeinflussen könnten. Es wird der Einfluss von Jean Pauls Schreibstil und die Bedeutung intertextueller Zitate untersucht.
Schlüsselwörter
Robert Schumann, Papillons op. 2, Jean Paul, Flegeljahre, Walzerkette, Maskenball, intertextuelle Zitate, stilistische Elemente, Kontraste, Zyklus, musikalische Poesie
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „rote Faden“ in Schumanns Papillons op. 2?
Die Arbeit untersucht, ob die Papillons ein zusammenhängender Zyklus oder eine Reihe unabhängiger Stücke sind, wobei der Bezug zu Jean Pauls Roman „Flegeljahre“ eine zentrale Rolle spielt.
Welcher literarische Text diente als Vorlage für das Werk?
Das Programm des Klavierzyklus geht auf die Szene des Maskenballs in Jean Pauls Roman „Flegeljahre“ zurück.
Gibt es einen klaren tonalen Zusammenhang zwischen den Stücken?
Die Analyse zeigt eine deutliche tonale Instabilität; ein klarer, durchgehender tonaler Zusammenhang ist über die zwölf Stücke hinweg kaum erkennbar.
Wie setzt Schumann das Programm musikalisch um?
Die Arbeit analysiert intertextuelle Zitate und musikalische Poesie, stellt aber fest, dass Schumann das Programm nicht immer konsequent oder offensichtlich umgesetzt hat.
Wann entstanden die Papillons?
Robert Schumann komponierte diesen frühen Klavierzyklus in der Zeit von 1829 bis 1832.
- Citar trabajo
- Susanne Becker (Autor), 2014, Zum roten Faden in Schumanns Papillons op. 2, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295871