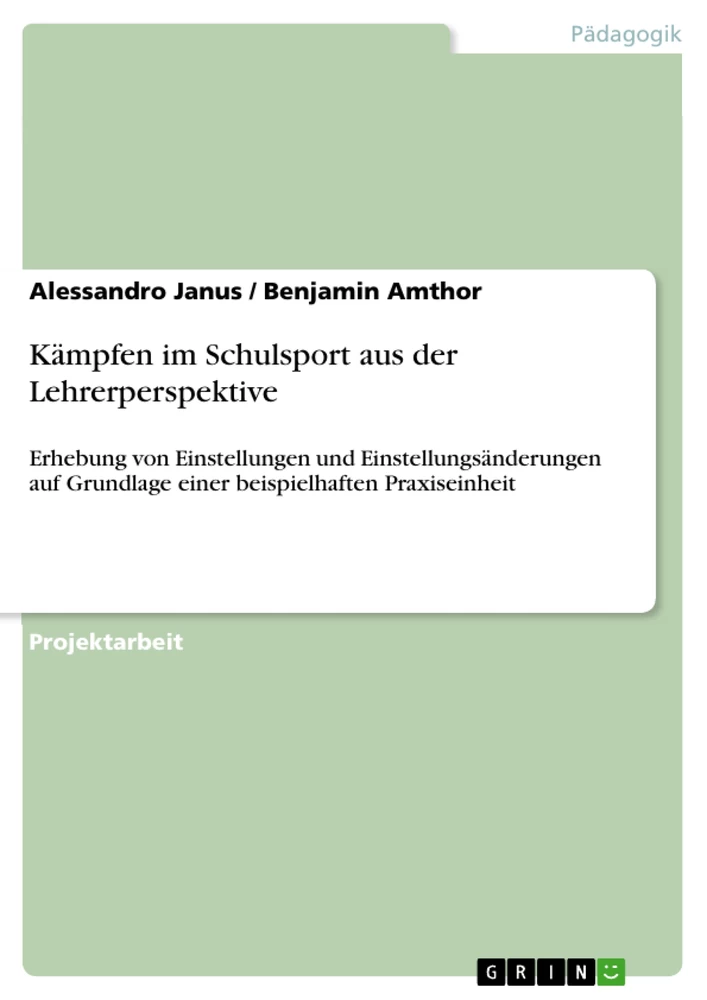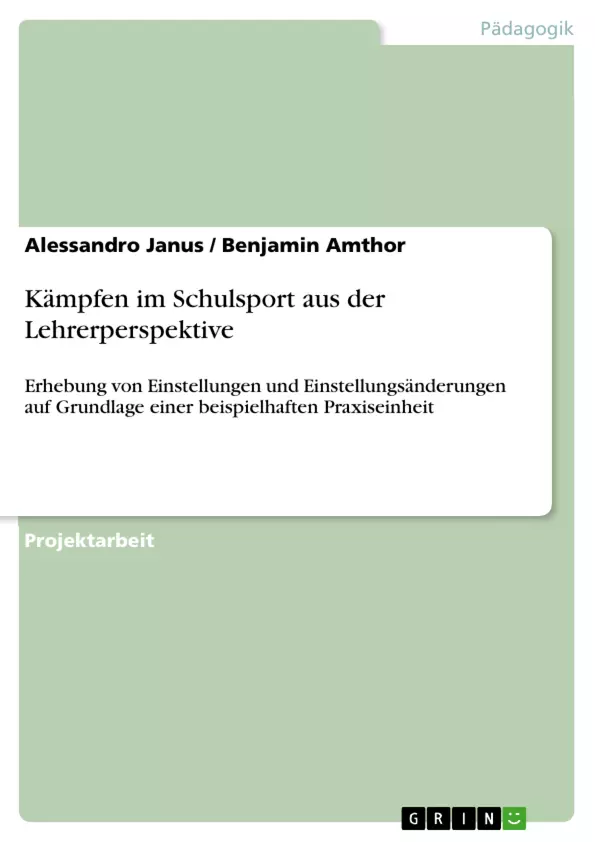Zu den elementaren motorischen Fertigkeiten gehören neben dem Gehen, Laufen, Springen, Werfen, etc. auch das Schieben, Ziehen, Schlagen, Stoßen, Treten u. a. Die Letzteren finden besonders in kampforientierten Sportarten ihre Anwendung. Weil die Aneignung dieser elementaren Fertigkeiten bereits im Kleinkind-, Vorschul- und Grundschulalter stattfindet, sollte den Zweikampfsportarten im Schulsport zunehmende Beachtung entgegengebracht werden. In der sportpädagogischen und sportdidaktischen Diskussion steht man dem Thema Kämpfen aktuell offener gegenüber als zu früheren Zeiten (vgl. Kuhn, 2008). Vielen pädagogischen Bemühungen ist es zu verdanken, dass das Phänomen Kampf in seiner vielfältig wirksamen und erzieherischen Weise in den Schulsport integriert werden konnte. Der vorrangig mehrperspektivische Ansatz des Sportunterrichts in Deutschland erlaubt zudem den gesonderten Zugang zur Sache, obwohl dem Zweikampf – bspw. im Fußball wie auch im Boxen – ein angebliches Gewaltpotenzial inhärent zu seien scheint und auch oft unterstellt wird . Durch die Kommission Sport wurde der Auswahl an kampfsportlichen Inhalten Grenzen gesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung (Alessandro Janus)
- Problem- und Zielstellung (Alessandro Janus)
- Fragestellung und Arbeitshypothesen (Benjamin Amthor)
- Forschungsmethodisches Vorgehen (Benjamin Amthor)
- Theoretische Aufarbeitung des Problemfeldes
- Das Urphänomen Kämpfen (Benjamin Amthor)
- Das Besondere am Zweikämpfen (Benjamin Amthor)
- Kampfsport - gewaltfördernd oder gewaltpräventiv?
- Kampsport – sicher und gesund
- Die Sinnhaftigkeit von Zweikämpfen im Kontext Schule (Benjamin Amthor)
- Dokumentenanalyse (Alessandro Janus)
- Kampfbetonte Übungen in den Lehrplänen
- Lehrpläne Sachsens
- Lehrpläne Niedersachsens
- Einstellungen (Alessandro Janus)
- Untersuchungsmethodik
- Untersuchungsdesign (Benjamin Amthor)
- Untersuchungsmethoden
- Fragebogen (Benjamin Amthor)
- Praxiseinheit (Alessandro Janus)
- Ergebnisse
- Befragung von Lehrerin W. (Benjamin Amthor)
- Befragung von Lehrer U. (Alessandro Janus)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit befasst sich mit der Integration von Kampfsport und Zweikampfübungen im Schulsport aus der Lehrerperspektive. Ziel ist es, die Einstellungen und Einstellungsänderungen von Lehrkräften gegenüber dem Thema Kämpfen zu erforschen, indem eine beispielhafte Praxiseinheit analysiert wird. Die Arbeit untersucht dabei die Frage, inwieweit der Kampfsport im Schulsport tatsächlich wie erwartet stattfindet, und welche Faktoren die Implementierung von kampfsportlichen Inhalten beeinflussen.
- Einstellungen und Einstellungsänderungen von Lehrkräften gegenüber dem Thema Kämpfen
- Die Rolle von Kampfsport im Schulsport: Gewaltprävention, Förderung von motorischen Fähigkeiten und sozialer Kompetenz
- Analyse der Lehrpläne und des aktuellen Stands der Implementierung von kampfsportlichen Inhalten im Schulsport
- Herausforderungen und Chancen der Integration von Zweikampfübungen in den Sportunterricht
- Die Bedeutung von Kompetenzen und Erfahrungen der Lehrkräfte für die erfolgreiche Umsetzung von kampfsportlichen Inhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Problem- und Zielstellung der Arbeit, die sich mit der Erhebung von Einstellungen und Einstellungsänderungen von Lehrkräften gegenüber dem Thema Kämpfen im Schulsport beschäftigt. Es werden zudem die Fragestellung und Arbeitshypothesen sowie das methodische Vorgehen der Studie vorgestellt.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der theoretischen Aufarbeitung des Problemfeldes. Es werden die Ursprünge des Kämpfens, die Besonderheiten von Zweikämpfen und die Sinnhaftigkeit von Zweikämpfen im Kontext Schule beleuchtet. Darüber hinaus wird die Dokumentenanalyse von Lehrplänen in Sachsen und Niedersachsen vorgestellt, die Aufschluss über die Integration von kampfsportlichen Inhalten im Schulsport gibt.
Das dritte Kapitel beschreibt die Untersuchungsmethodik der Studie, die auf einem Fragebogen und einer Praxiseinheit basiert. Die Ergebnisse der Befragung von zwei Lehrkräften werden im vierten Kapitel präsentiert und analysiert.
Schlüsselwörter
Schulsport, Kampfsport, Zweikampfübungen, Einstellungen, Einstellungsänderungen, Lehrkräfte, Gewaltprävention, motorische Fähigkeiten, soziale Kompetenz, Lehrpläne, Schulpraxis, Kompetenzentwicklung, Erfahrungsaustausch.
Häufig gestellte Fragen
Warum sollte „Kämpfen“ im Schulsport unterrichtet werden?
Es fördert elementare motorische Fertigkeiten wie Schieben und Ziehen sowie soziale Kompetenzen und Fairness im direkten Zweikampf.
Ist Kampfsport im Schulsport gewaltfördernd?
Im Gegenteil: Pädagogisch begleitetes Kämpfen wirkt oft gewaltpräventiv, da Schüler lernen, Aggressionen zu kontrollieren und Regeln einzuhalten.
Welche Rolle spielt die Lehrerperspektive bei diesem Thema?
Die Einstellung der Lehrkraft und deren eigene Kompetenz im Kampfsport entscheiden maßgeblich darüber, ob und wie sicher Kämpfen im Unterricht umgesetzt wird.
Was sagen die Lehrpläne in Sachsen und Niedersachsen dazu?
Die Lehrpläne enthalten zunehmend kampfbetonte Übungen als festen Bestandteil des mehrperspektivischen Sportunterrichts.
Ist Kämpfen im Sportunterricht sicher?
Durch klare Regeln, geeignete Schutzausrüstung (z.B. Matten) und methodischen Aufbau gilt das Kämpfen als sicher und gesundheitsfördernd.
- Quote paper
- Alessandro Janus (Author), Benjamin Amthor (Author), 2014, Kämpfen im Schulsport aus der Lehrerperspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295958