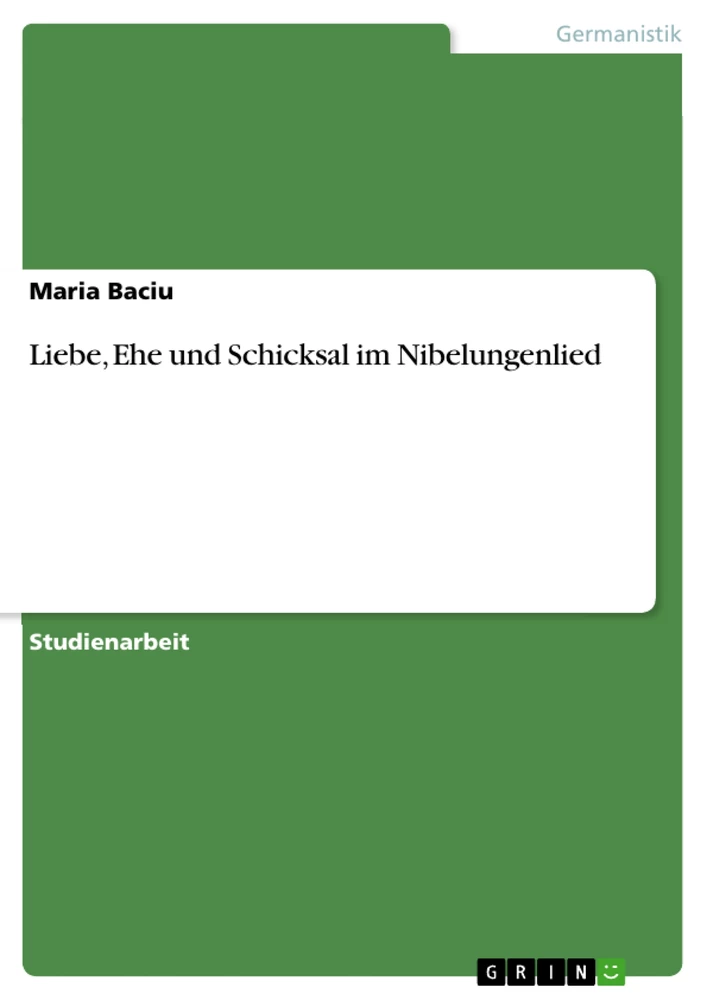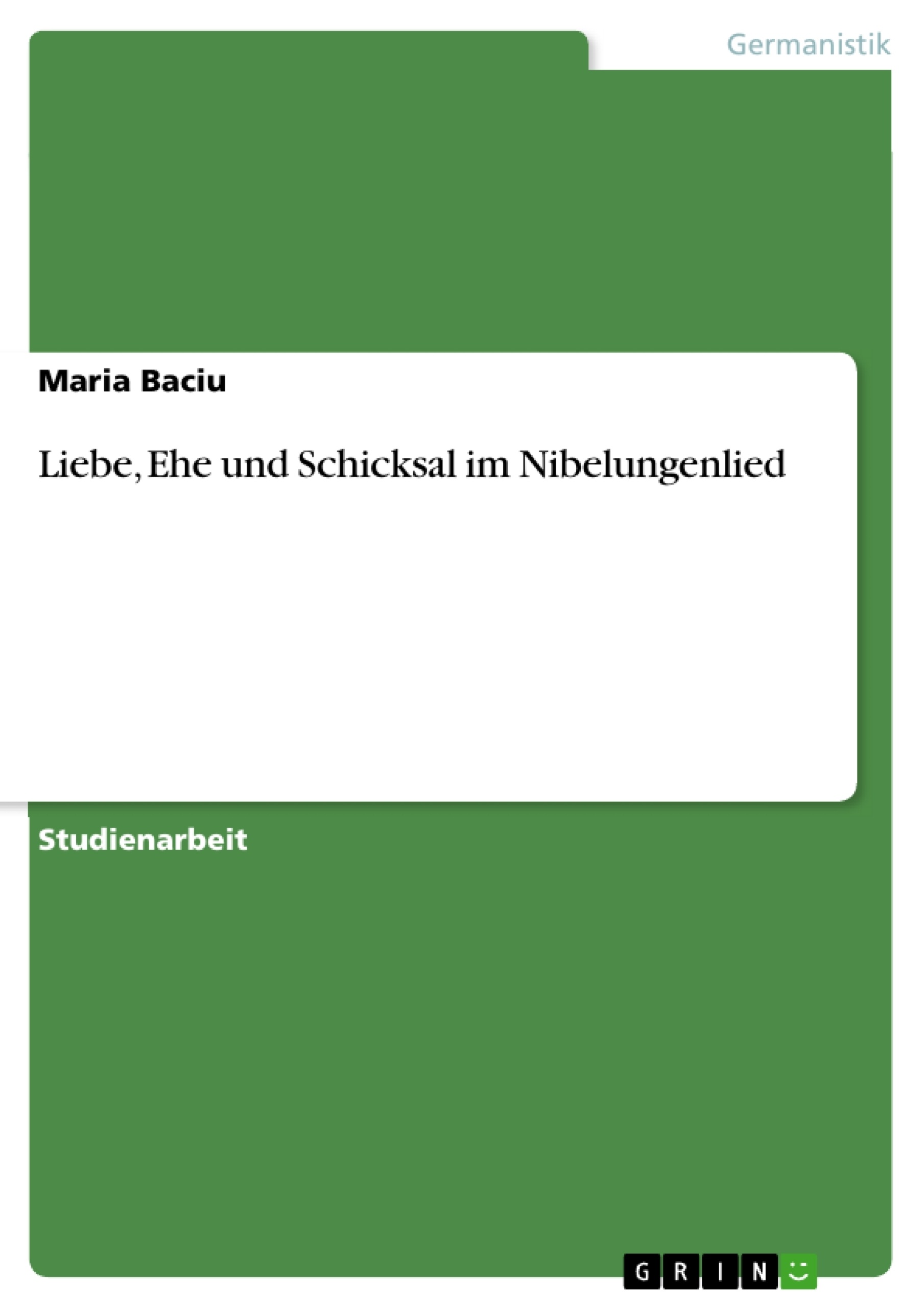Mit gutem Recht wird das Nibelungenlied in den 1960er und 1970er Jahren als „Frauenbiographie“ bzw. „Frauentragödie“ gedeutet. Betrachtet man die Situation der Frau, so wie sie in der mittelalterlichen Gesellschaft verankert war, begegnen einem zahlreiche sich überlappende Äußerungs- und Darstellungsmodi, die aber in der einen oder anderen Form auf dieselbe Grundidee zurückzuführen sind: Gemäß des mittelalterlichen Vorstellungshorizonts waren Geschlechterverhältnisse dermaßen ausgelegt, dass die Rolle der Frau nur durch jene des Mannes bestimmt wurde und dadurch eine deutliche Abwertung und Ausgrenzung bis hin zur Reduzierung auf den Objektstatus erfuhr. Sichtbar werden diese Verhältnisse auch anhand der mysogynen Perspektive des Dichters.
Das Thema ist von besonderer Aktualität und nimmt in der Weltliteratur eine wichtige Stellung ein. Die eingeschränkte Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Ursachen ihres wenn auch nur kurzzeitig abweichenden Verhaltens bis die Ordnung wieder hergestellt wird, ist das Phänomen, das in vorliegender Arbeit untersucht werden soll.
In dieser Hinsicht gibt das Nibelungenlied Auskunft über damalige Vorgänge und Praktiken sowie über historische und kulturelle Wandlungsprozesse. Die Verknüpfung des Mythischen mit dem Historischen, des Wahren und des Märchenhaften, bedingen sowohl Charakterzüge der Gestalten wie auch ihre vielfältige Dimension. Das Epos vermittelt eine klare Darstellung der frühen Feudalgesellschaft - Lebensbedingungen, Beziehungen zwischen Feudalherren und Lehnsmännern, und selbstverständlich auch deren typische und deviante Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung der beiden devianten Weiblichkeitsbilder und in der Bestimmung der Relevanz ihrer Andersartigkeit für den tragischen Ausgang der Geschichte.
- Citar trabajo
- Maria Baciu (Autor), 2014, Liebe, Ehe und Schicksal im Nibelungenlied, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296162