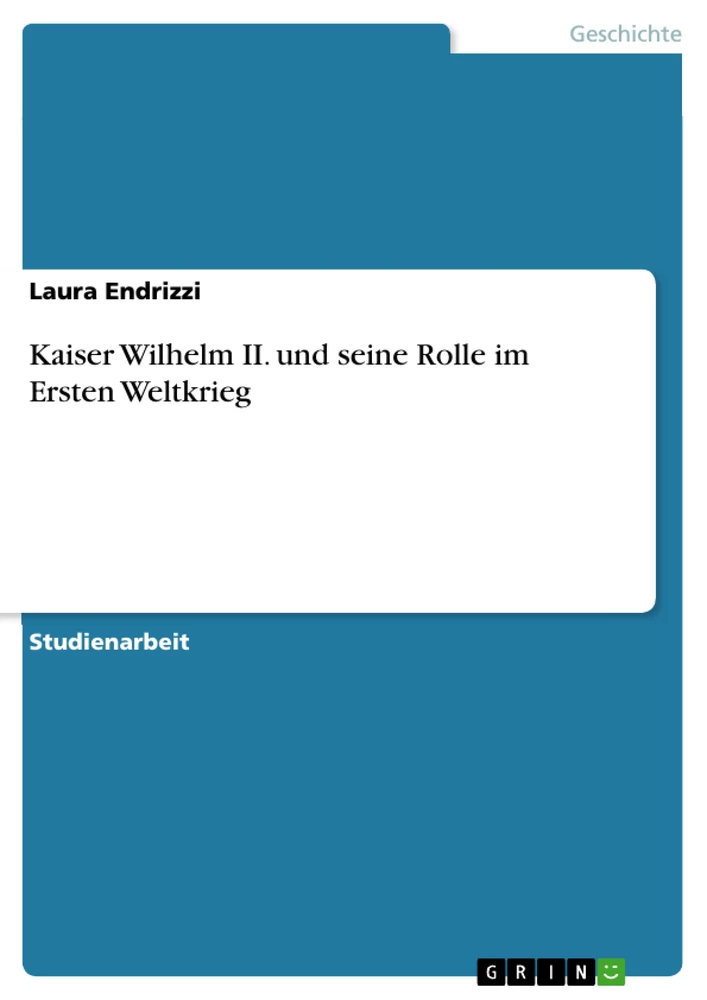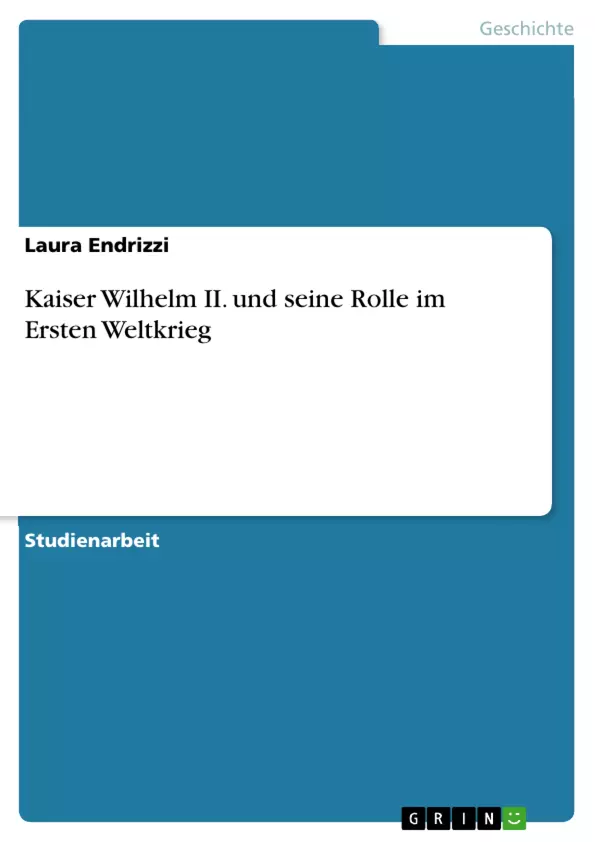Im Jahre 1913 feierte Wilhelm II. das fünfundzwanzigste Jubiläum seiner Krönung zum preußischen König und deutschen Kaiser. Er ließ sich von seinem Volk als Friedenskaiser feiern, denn seit seinem Amtsantritt hatte Deutschland keinen Krieg mehr geführt. Allerdings hielt Wilhelm II. einen Krieg der europäischen Großmächte für unausweichlich und hatte zu dieser Zeit auch schon Kriegspläne geschmiedet. Schon 1912 hatte er mit seinem Generalstab das Jahr 1914 als wahrscheinlichen Kriegsbeginn ins Auge gefasst. John Röhl schreibt dazu: „In dem von ihm am 8. Dezember 1912 einberufenen ‚Kriegsrat‘ plädierten der Kaiser und v. Moltke für ein ‚sofortiges Losschlagen‘ und akzeptierten das von Tirpitz verlangte ‚Hinausschieben des großen Kampfes um 1 ½ Jahre‘ nur ‚ungern‘“.
Als sich die Ereignisse nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand überschlugen, versuchte Wilhelm II. auf diplomatischem Wege, die Krise auf Österreich und Serbien beschränkt zu halten und den Ausbruch eines großen Krieges zu vermeiden. Er versuchte, die russische Mobilmachung zu verhindern, indem er sich telegrafisch an Zar Nikolaus II. wendete. Er erschien sehr deprimiert, als ihm dies nicht gelang.
Inhaltsverzeichnis
- Kriegsvorbereitungen und Ausbruch des Krieges.
- Der Kaiser als Oberster Kriegsherr..
- Machtverlust zugunsten der Obersten Heeresleitung
- Ansehen des Kaisers beim Volk
- Von der Kriegsmüdigkeit bis zur Abdankung .
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Rolle Kaiser Wilhelm II. im Ersten Weltkrieg. Sie analysiert seine Handlungen und Entscheidungen im Kontext der Kriegsvorbereitungen, des Kriegsverlaufs und des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches.
- Der Kaiser als Oberster Kriegsherr und seine Rolle bei der Kriegsentscheidung
- Der Einfluss des Kaisers auf die deutsche Politik und Gesellschaft während des Krieges
- Der Machtverlust des Kaisers zugunsten der Obersten Heeresleitung
- Die öffentliche Wahrnehmung des Kaisers und sein Ansehen im Volk
- Die Abdankung des Kaisers und die Folgen für Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Kriegsvorbereitungen und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es wird die Rolle des Kaisers bei der Kriegsentscheidung und seine politische Situation im Vorfeld des Krieges beleuchtet.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Rolle des Kaisers als Oberster Kriegsherr. Es untersucht seine militärische Kompetenz und seine Beziehung zum Generalstab.
Das dritte Kapitel beleuchtet den Machtverlust des Kaisers zugunsten der Obersten Heeresleitung. Es wird die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kaiser und Generalstab während des Krieges analysiert.
Schlüsselwörter
Kaiser Wilhelm II., Erster Weltkrieg, Oberster Kriegsherr, Oberste Heeresleitung, Kriegsvorbereitungen, Kriegsverlauf, Abdankung, öffentliche Meinung, Machtverlust, politische Situation, Militär, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte Kaiser Wilhelm II. beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs?
Obwohl er 1914 versuchte, die Krise diplomatisch zu begrenzen, hatte er bereits Jahre zuvor Kriegspläne gebilligt und den Krieg als unausweichlich betrachtet.
Was bedeutet der Titel "Oberster Kriegsherr"?
Es war der offizielle Titel des Kaisers, der ihm den Oberbefehl über das Militär gab, obwohl er im Verlauf des Krieges faktisch Macht an die Oberste Heeresleitung (OHL) verlor.
Warum verlor der Kaiser während des Krieges an Macht?
Aufgrund militärischer Misserfolge und der starken Position von Hindenburg und Ludendorff (OHL) wurde der Kaiser zunehmend zu einer Randfigur in der politischen und militärischen Entscheidungsgewalt.
Wie war das Ansehen des Kaisers im Volk am Ende des Krieges?
Das Ansehen sank massiv durch die Kriegsmüdigkeit, die wirtschaftliche Not und die Wahrnehmung, dass der Kaiser den Bezug zur Realität verloren hatte.
Wann und warum dankte Wilhelm II. ab?
Er dankte im November 1918 ab, als die Niederlage feststand und die Novemberrevolution den Sturz der Monarchie in Deutschland erzwang.
- Quote paper
- Laura Endrizzi (Author), 2011, Kaiser Wilhelm II. und seine Rolle im Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296204