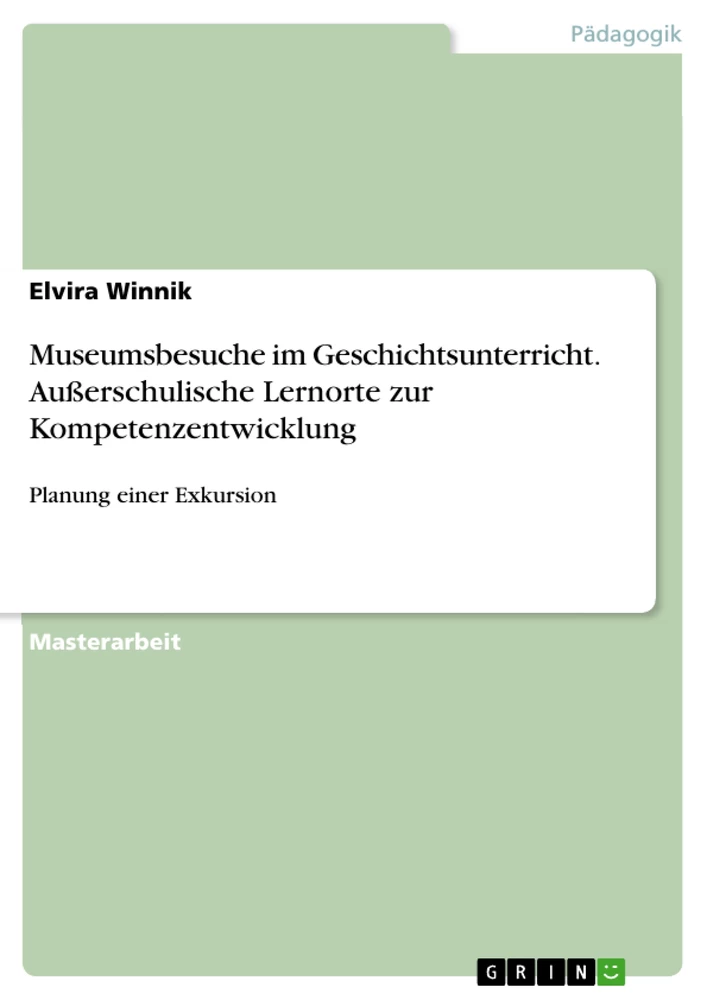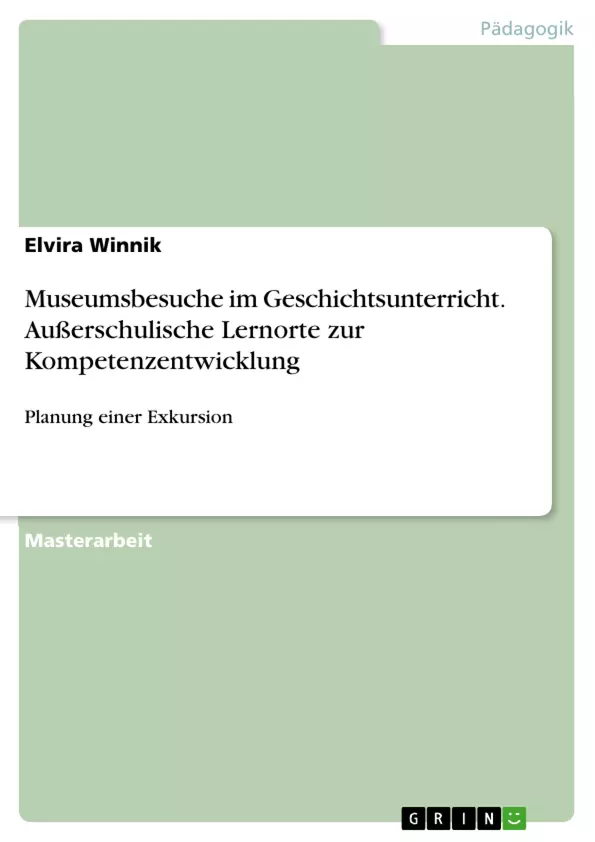Wenn ich mich persönlich an meine Schulzeit erinnere, waren mir außerschulische Lernorte am liebsten. Doch nach der Grundschulzeit wurden sie in Verbindung mit Schule immer seltener. Außerschulische Lernorte wurden nach und nach zur Ausnahme oder in Verbindung mit einer Klassenfahrt aufgesucht. In der Oberstufe meiner Schule wurden Museumsbesuche hingegen wieder öfter vorgenommen und waren Teil der Unterrichtseinheit. Auch innerhalb meines Lehramtsstudiums der Fächer Geschichte und Evangelische Religionslehre begleiteten mich Lernorte außerhalb der Universität. Orte wie das Stadtarchiv Münster, das Landesarchiv Münster, der Besuch einer Synagoge und Mosche sowie ein historischer Stadtrundgang wurden unter Begleitung und Anleitung verschiedener Dozenten aufgesucht und erlebt. Sie alle waren Teil einer Unterrichtseinheit und zeigen auf, dass außerschulisches bzw. außeruniversitäres Lernen in der Praxis ausgeübt wird. Als zukünftige Geschichtslehrerin möchte ich deshalb überprüfen, ob Museumsbesuche unter Berücksichtigung der Vorgaben in den Lehrplänen, in der Unterrichtspraxis des Geschichtsunterrichts ausgebaut werden sollten. Ich möchte überprüfen, ob der Museumsbesuch als ein Erlebnis außerhalb des Lernortes Schule und damit verbunden eine Erweiterung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Fach Geschichte geschaffen werden kann. Aus dieser Idee ist die führende Fragestellung entstanden:
„Kann der außerschulische Lernort Museum zur Kompetenzerweiterung im Geschichtsunterricht beitragen und unter welchen Bedingungen kann das gelingen?“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Reformpädagogik als Begründung für außerschulische Lernorte
- Der außerschulische Lernort Museum
- Definition und Aufgabe des Museums
- Vorteile eines Museumsbesuchs für den Geschichtsunterricht
- Aspekte aus der Lern- und Motivationsforschung
- Gestaltung eines Museumsbesuchs
- Bildungsstandards und Kompetenzen
- Der Lehrplan von Nordrhein-Westfalen
- Empirische Ergebnisse zum Museumsbesuch
- Lehr-Lernforschung in der Geschichtsdidaktik
- Allgemeine Unterrichtsforschung
- Planung eines Museumsbesuches
- Das Bremer Schulmuseum
- Das Modul „Selbstständiges Erkunden“ für den Geschichtsunterricht
- Kompetenzerweiterung durch den Museumsbesuch?
- Sachkompetenz
- Methoden- und Medienkompetenz
- Urteilskompetenz
- Fragenkompetenz
- Handlungskompetenz
- Orientierungskompetenz
- Kulturelle Kompetenz und Museumskompetenz
- Soziale Kompetenz
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Beitrag außerschulischer Lernorte, speziell des Museums, zur Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann der außerschulische Lernort Museum zur Kompetenzerweiterung im Geschichtsunterricht beitragen und unter welchen Bedingungen kann das gelingen? Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit einem Praxisbezug anhand eines konkreten Museumsmoduls.
- Reformpädagogische Grundlagen außerschulischen Lernens
- Definition und didaktische Vorteile des Museums als Lernort
- Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht und deren Bezug zu Bildungsstandards
- Empirische Befunde zum Lernerfolg durch Museumsbesuche
- Analyse eines konkreten Museumsmoduls (Bremer Schulmuseum) hinsichtlich des Kompetenzgewinns
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, außerschulisches Lernen, insbesondere Museumsbesuche im Geschichtsunterricht, zu untersuchen. Sie erläutert die persönliche Erfahrung mit außerschulischen Lernorten und formuliert die zentrale Forschungsfrage: Kann der außerschulische Lernort Museum zur Kompetenzerweiterung im Geschichtsunterricht beitragen und unter welchen Bedingungen kann das gelingen? Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil, der sich mit dem Bremer Schulmuseum befasst.
Die Reformpädagogik als Begründung für außerschulische Lernorte: Dieses Kapitel beleuchtet die reformpädagogischen Ansätze, die außerschulisches Lernen als wichtigen Bestandteil ganzheitlicher Bildung verstehen. Es werden die theoretischen Grundlagen für die Bedeutung von außerschulischen Lernorten im Bildungsprozess dargelegt und als Begründung für die Wahl des Museums als Forschungsgegenstand verwendet. Die Kapitel betont die Notwendigkeit, über den traditionellen Unterricht hinaus zu denken und alternative Lernumgebungen zu nutzen.
Der außerschulische Lernort Museum: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Museums und beschreibt dessen Aufgaben im Bildungskontext. Es werden die spezifischen Vorteile eines Museumsbesuchs für den Geschichtsunterricht herausgearbeitet, beispielsweise die Möglichkeit, authentische Quellen und Artefakte zu betrachten und Geschichte greifbarer zu machen. Zusätzlich werden Aspekte der Lern- und Motivationsforschung einbezogen, um das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern im Museumskontext zu beleuchten und die Gestaltung eines Museumsbesuchs zu optimieren.
Bildungsstandards und Kompetenzen: Dieses Kapitel stellt die Bildungsstandards und Kompetenzen für den Geschichtsunterricht in Nordrhein-Westfalen vor, mit einem Schwerpunkt auf den Kompetenzvorgaben zum „historischen Denken“. Die im Lehrplan definierten Kompetenzen bilden die Grundlage für die spätere Analyse des Bremer Schulmuseumsmoduls und dienen als Maßstab für den Kompetenzgewinn der Schülerinnen und Schüler.
Empirische Ergebnisse zum Museumsbesuch: Dieses Kapitel präsentiert empirische Ergebnisse zur Lehr-Lernforschung in der Geschichtsdidaktik und allgemeinen Unterrichtsforschung im Bezug auf Museumsbesuche. Es werden relevante Studien und Erkenntnisse zusammengefasst, die Aufschluss über den Kompetenzerwerb durch Museumsbesuche geben und die Frage beantworten, wie ein Museumsbesuch von Lehrkräften lernbegünstigend gestaltet werden kann. Diese Ergebnisse bilden die Brücke zum praktischen Teil der Arbeit.
Das Bremer Schulmuseum: Dieses Kapitel beschreibt das Bremer Schulmuseum und fokussiert auf das Modul „Nationalsozialismus“. Die Inhalte des Moduls werden detailliert dargestellt, und es wird untersucht, inwieweit das Modul zur Erweiterung der im Lehrplan definierten Kompetenzen beiträgt. Die Analyse erfolgt exemplarisch und stellt eine subjektive Bewertung dar.
Schlüsselwörter
Außerschulischer Lernort, Museum, Geschichtsunterricht, Kompetenzentwicklung, Bildungsstandards, Reformpädagogik, Bremer Schulmuseum, Nationalsozialismus, Lehr-Lernforschung, Kompetenzgewinn, historische Bildung.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Der Beitrag des Museums zum Geschichtsunterricht
Was ist das zentrale Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Beitrag außerschulischer Lernorte, insbesondere von Museen, zur Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann der außerschulische Lernort Museum zur Kompetenzerweiterung im Geschichtsunterricht beitragen und unter welchen Bedingungen kann das gelingen?
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf reformpädagogische Ansätze, die außerschulisches Lernen als wichtigen Bestandteil ganzheitlicher Bildung verstehen. Es werden die didaktischen Vorteile des Museums als Lernort beleuchtet und die Bildungsstandards und Kompetenzen des Geschichtsunterrichts in Nordrhein-Westfalen betrachtet. Die Arbeit bezieht auch Erkenntnisse aus der Lern- und Motivationsforschung und empirische Befunde zur Lehr-Lernforschung im Kontext von Museumsbesuchen mit ein.
Welches Museum wird im praktischen Teil der Arbeit untersucht?
Der praktische Teil der Arbeit analysiert ein konkretes Museumsmodul des Bremer Schulmuseums, fokussiert auf das Modul "Nationalsozialismus". Die Analyse untersucht, inwieweit das Modul zur Erweiterung der im Lehrplan definierten Kompetenzen beiträgt.
Welche Kompetenzen werden im Zusammenhang mit dem Museumsbesuch untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Kompetenzbereiche, die durch einen Museumsbesuch erweitert werden können, darunter Sachkompetenz, Methoden- und Medienkompetenz, Urteilskompetenz, Fragenkompetenz, Handlungskompetenz, Orientierungskompetenz, kulturelle Kompetenz, Museumskompetenz und soziale Kompetenz.
Welche Forschungsmethoden werden angewendet?
Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit einem Praxisbezug. Der praktische Teil beinhaltet eine exemplarische Analyse eines konkreten Museumsmoduls. Die Analyse basiert auf einer subjektiven Bewertung der Autorin.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse des Beitrags von Museumsbesuchen zur Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht. Sie zeigt auf, unter welchen Bedingungen ein Museumsbesuch lernbegünstigend gestaltet werden kann und welche Kompetenzen im Zuge dessen gefördert werden können. Die Ergebnisse basieren auf der Analyse des Bremer Schulmuseums und der Auswertung einschlägiger Literatur.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Geschichtslehrer, Museumspädagogen, Studierende der Geschichtsdidaktik und alle, die sich mit außerschulischem Lernen und Kompetenzentwicklung im Geschichtsunterricht auseinandersetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Außerschulischer Lernort, Museum, Geschichtsunterricht, Kompetenzentwicklung, Bildungsstandards, Reformpädagogik, Bremer Schulmuseum, Nationalsozialismus, Lehr-Lernforschung, Kompetenzgewinn, historische Bildung.
- Citar trabajo
- Elvira Winnik (Autor), 2015, Museumsbesuche im Geschichtsunterricht. Außerschulische Lernorte zur Kompetenzentwicklung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296264