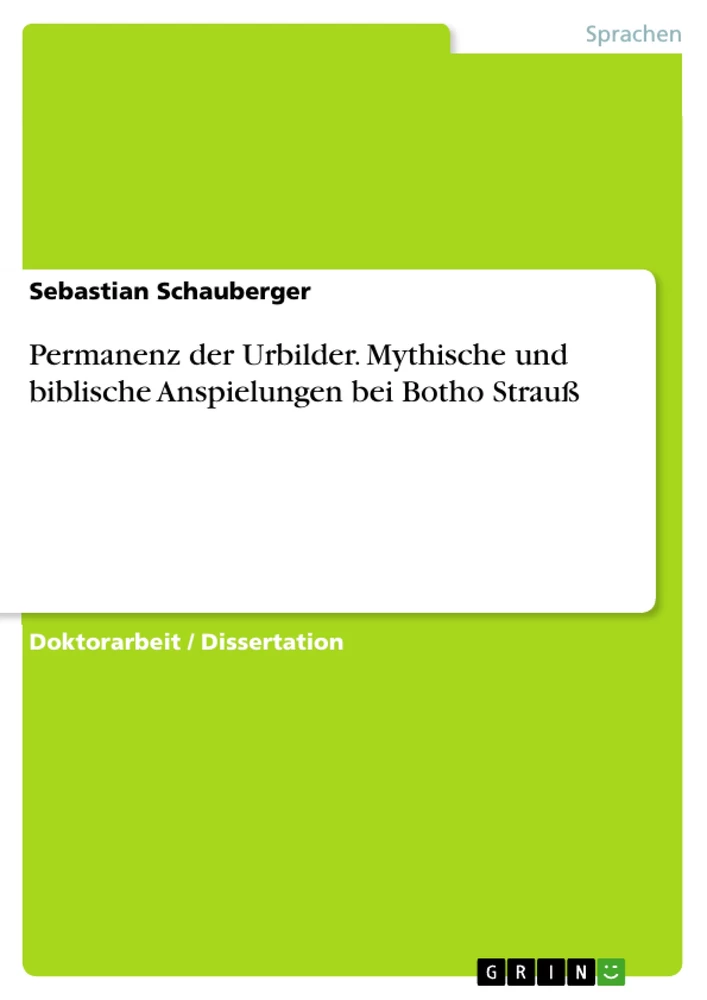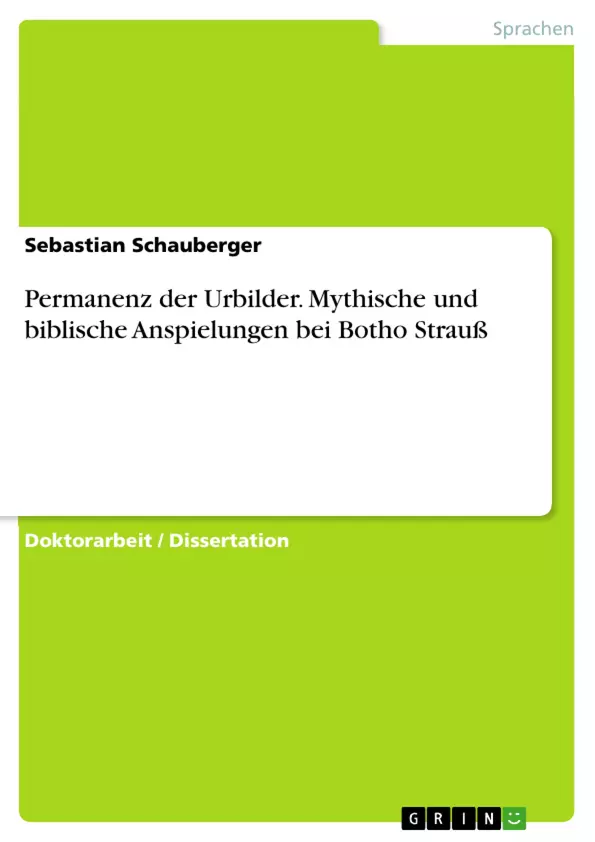Das letzte Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde, nachdem man sich eher überrascht vom Zusammenbruch des Blockdenkens in Deutschland innerhalb eines Jahres wiedervereinigt vorfand und sich nicht nur politisch neu
zurechtzufinden hatte, im öffentlichen Erörtern der geistesgeschichtlichen Situation mehrfach aufgescheucht. In einer der vielen Feuilleton-Debatten, die in diesen Jahren geführt wurden, kam Botho Strauß politisch in den Verruf einer reaktionären und demokratiefeindlichen 'persona non grata', was den Autor und seine Arbeit umso überraschender und ungerechter traf, als er sich im Unterschied zu den öffentlich debattierenden Walser, Handke, Grass oder Sloterdijk kaum selbst am Disput beteiligte. Ausreichend und ausschlaggebend
für das öffentliche Urteil waren wenige aus dem Zusammenhang gerissene Reizworte in der bisher größten öffentlichen Provokation seines Spiegelessays „Anschwellender Bocksgesang“.
Die Debatte hatte ihre Wurzeln jedoch in einem älteren Streit um die Einschätzung der Autoren Botho Strauß und Peter Handke, der 1985 zwischen den Feuilletons der Neuen Züricher Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgetragen wurde. Während man sich 1992/93 eher um eine politische und philosophische Begrifflichkeit, bzw. um die ‚rechte‘
Einschätzung der politischen Provokationen stritt, zeigte die Diskussion von 1985 deutlicher den ästhetischen bzw. kunsttheoretischen Hintergrund der Auseinandersetzung. Die Neue Züricher Zeitung hatte in einer Literaturkritik-Beilage zu einer Kritik der Kritik und einer Revision der ästhetischen Maßstäbe aufgerufen. In seinem Leitartikel „Über das Bedürfnis nach Schönheit“ erklärte Peter Hamm, warum ihm eine neue Reflexion über den Begriff des Schönen und eine Revision der literaturkritischen Maßstäbe geboten schien: [...]
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Form der Anspielungen und ihr Verständnis
- Mythos und Logos
- Mythostheorie und Postmodernediskussion
- Allegorie und Anspielung
- Das Spiel mit griechischer Mythologie
- Bacchus und Pan in "Die Fremdenführerin"
- Medea in "Die Zeit und das Zimmer"
- Diana in "Die Zeit und das Zimmer” und in "Schlußchor"
- Dionysisches in "Kalldewey, Farce"
- Dädalus und Pasiphaë in ”Der Park”
- Biblische Anspielungen
- Das Osterwunder in "Trilogie des Wiedersehens❞
- Berufene, Braut und ‘ekliger Engel' in ”Groß und Klein”
- Das Jeremia-Zitat in "Besucher"
- David und Bathseba in "Schlußchor"
- Die Bibel-Adaptation in "Lotphantasie”
- Offene Struktur und Eindeutigkeit der Anspielungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Dissertation befasst sich mit der Verwendung von mythischen und biblischen Anspielungen im Werk des Autors Botho Strauß. Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung dieser Anspielungen für das Verständnis von Strauß’ Werk aufzuzeigen und ihren Einfluss auf die Form und die Inhalte seiner Texte zu analysieren.
- Die Rolle von Mythos und Bibel in der Literatur
- Die Funktion von Anspielungen in Strauß’ Texten
- Die Bedeutung von mythischen und biblischen Motiven für die Deutung des Werkes
- Der Einfluss von postmodernen Diskursen auf Strauß’ Umgang mit Mythen
- Die Beziehung zwischen Form und Inhalt in Strauß’ Werk
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung bietet eine Einführung in die Thematik und stellt den Kontext der Arbeit dar. Sie beleuchtet die öffentliche Debatte um Strauß’ Werk und seine Rezeption in der Literaturkritik.
Das erste Kapitel analysiert die Form der Anspielungen und ihr Verständnis. Es werden die Konzepte von Mythos und Logos, Mythostheorie und Postmodernediskussion sowie Allegorie und Anspielung erörtert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Anspielungen auf griechische Mythologie in Strauß’ Werken. Es untersucht die Verwendung von Motiven wie Bacchus, Pan, Medea, Diana und Dädalus.
Das dritte Kapitel beleuchtet die biblischen Anspielungen in Strauß’ Texten. Es analysiert die Verwendung von Motiven wie dem Osterwunder, der Berufung, der Braut und dem "ekligen Engel", dem Jeremia-Zitat, David und Bathseba sowie der Bibel-Adaptation.
Das vierte Kapitel untersucht die offene Struktur und die Eindeutigkeit der Anspielungen in Strauß’ Werk.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche dieser Dissertation sind: Botho Strauß, mythische Anspielungen, biblische Anspielungen, Allegorie, Postmoderne, Mythostheorie, Literaturkritik, Form und Inhalt, Deutung, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Mythen im Werk von Botho Strauß?
Strauß nutzt mythische Anspielungen (z.B. Medea, Pan), um zeitlose menschliche Erfahrungen in der modernen, oft entfremdeten Welt darzustellen.
Warum wurde Botho Strauß in den 90er Jahren öffentlich kritisiert?
Besonders sein Essay „Anschwellender Bocksgesang“ löste Debatten aus, da ihm reaktionäre und demokratiefeindliche Tendenzen vorgeworfen wurden.
Wie verwendet Strauß biblische Motive?
Er integriert biblische Zitate und Figuren (z.B. David und Bathseba, Lot), um moralische und existenzielle Fragen in seinen Stücken zu vertiefen.
Was ist der Unterschied zwischen Mythos und Logos bei Strauß?
Die Arbeit untersucht die Spannung zwischen der rationalen Welterklärung (Logos) und der bildhaften, archaischen Kraft des Mythos in seiner Literatur.
Was versteht man unter der "Permanenz der Urbilder"?
Es beschreibt die Idee, dass bestimmte archetypische Geschichten und Bilder der Menschheit über Jahrtausende hinweg ihre Bedeutung behalten.
- Citar trabajo
- Dr. Sebastian Schauberger (Autor), 2000, Permanenz der Urbilder. Mythische und biblische Anspielungen bei Botho Strauß, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296271