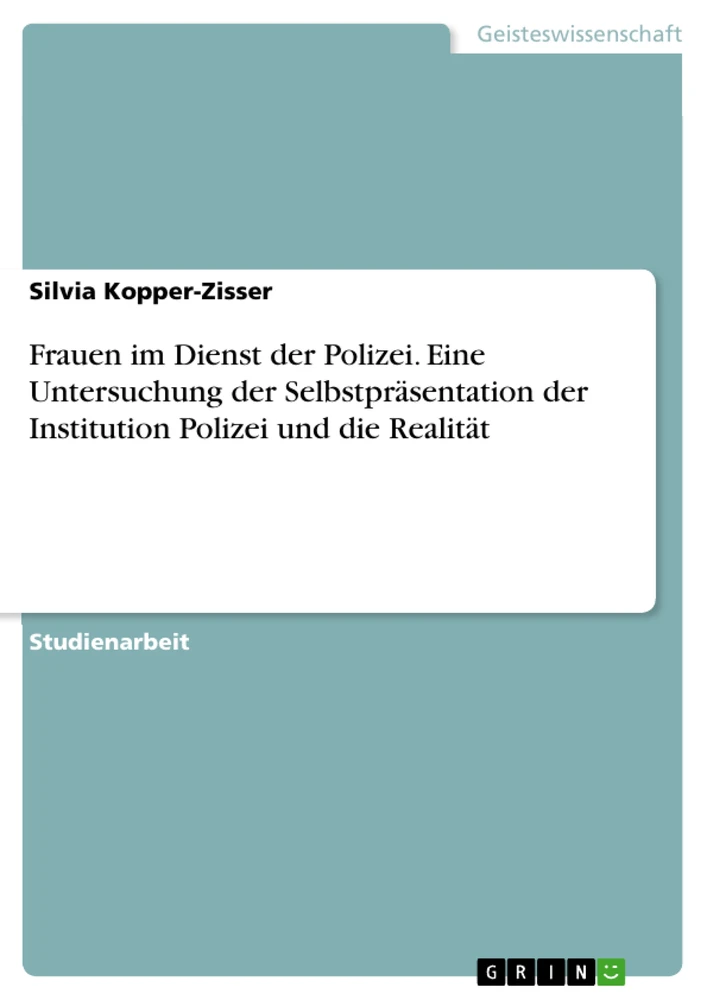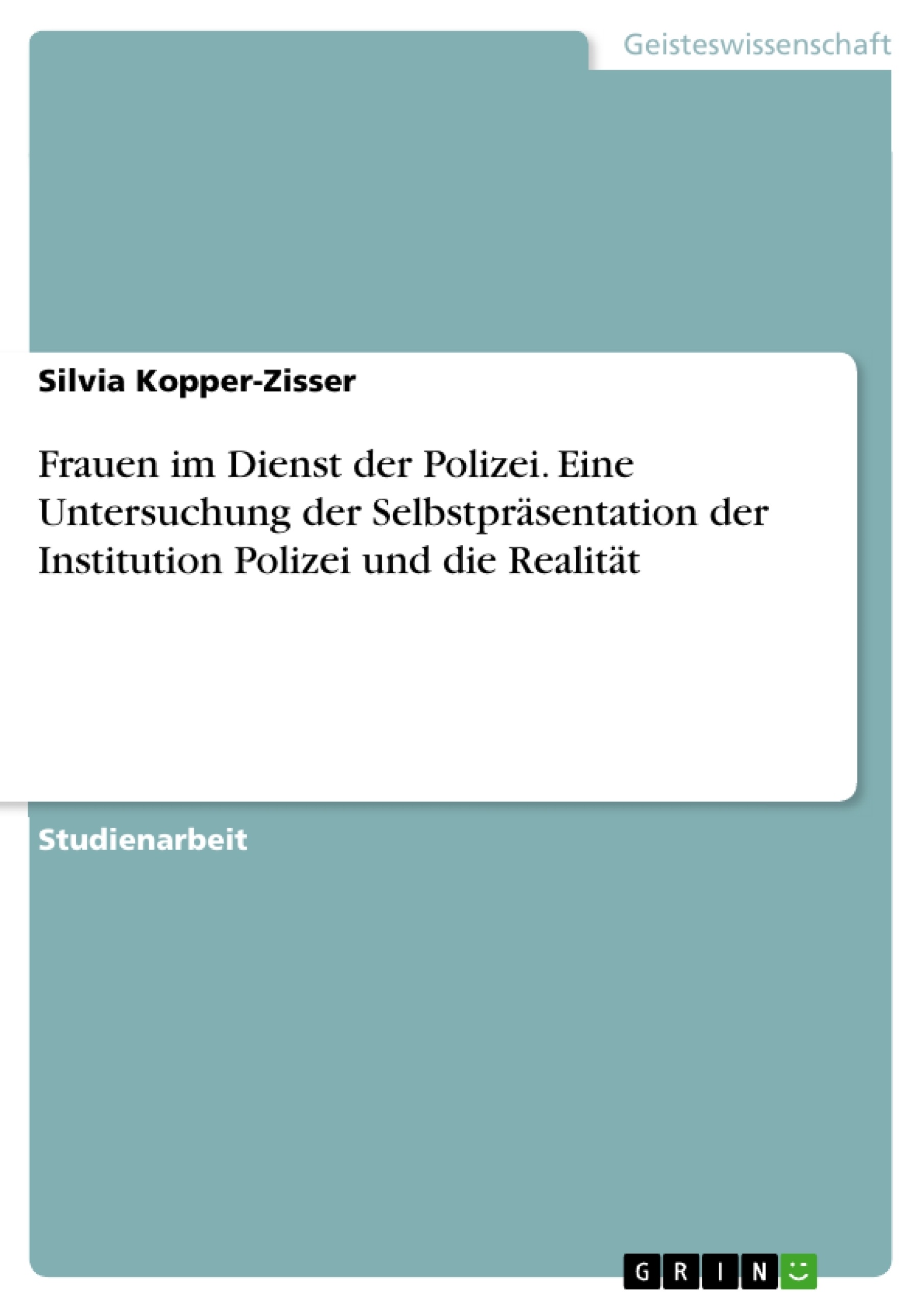Das Bedürfnis nach Sicherheit dominierte seit Menschengedenken die Menschheit. Thomas Hobbes und John Locke gehen in ihren Naturrechtslehren davon aus, dass der Wunsch nach Ordnung und Sicherheit aus Furcht vor Gewalt entsteht. Um zu erreichen, dass die Gesellschaft sich in einem diesbezüglich positiven Zustand befindet, müssen Institutionen geschaffen werden, die über die Einhaltung ihrer zugrunde liegenden Normen wachen. Im Konfliktfall fällt diese Aufgabe den Gerichten oder der Polizei zu. Nach Hobbes erhält der Staat als Souverän seine Legitimation erst dann, wenn jeder Bürger und jede Bürgerin durch einen Gesellschaftsvertrag freiwillig auf einen Teil des eigenen Rechtes verzichtet und somit das Gewaltmonopol den staatlichen Institutionen überlässt, um Frieden soweit als möglich zu garantieren (vgl. Hobbes 2004). Dies müsste gleichfalls bedeuten, dass jedes Mitglied dieses Gesellschaftsvertrages auch eine Repräsentation durch den Staat beanspruchen kann. Daraus lässt sich die Notwendigkeit erschließen, dass die Zusammensetzung der Polizei der gesellschaftlichen Realität des Volkes entsprechen sollte. Der heutzutage herrschende Mainstream, der Ruf nach Gleichberechtigung und Gleichstellung von Mann und Frau, scheint vielversprechend, doch hält er auch, was er verspricht?Dieser Frage folgend führt eine Recherche durch die herrschende Literatur zu einer Untersuchung der Selbstpräsentation der Institution Polizei und dem Versuch, die hinter diesem Selbstbild real herrschenden Tatsachen aufzudecken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Theoretischer Hintergrund
- Geschichtliche Entwicklung der Polizei
- Polizei als Männerdomäne
- Frauen im Dienst der Polizei
- Integration von Frauen in den Polizeidienst
- II. Forschungsdesign
- Forschungsfrage
- Methode
- III. Ergebnisse
- Beschreibung des Bildes
- Interpretation der Bildsegmente - Segmentanalyse
- Folgerungen/Diskussion
- IV. weiterführende Literatur
- V. Bibliographie
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Integration von Frauen in den Polizeidienst. Ziel ist es, die geschichtliche Entwicklung der Polizei als Männerdomäne darzustellen und die Herausforderungen und Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Selbstpräsentation der Polizei und versucht, die realen Gegebenheiten aufzudecken.
- Geschichtliche Entwicklung der Polizei und der Wandel von einer Männerdomäne
- Herausforderungen bei der Integration von Frauen in den Polizeidienst
- Vorurteile und Stereotypen gegenüber Polizistinnen
- Vergleich der männlichen und weiblichen Rollen innerhalb der Polizei
- Reformen und ihre Auswirkungen auf die Gleichstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Notwendigkeit von Institutionen zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in der Gesellschaft, ausgehend von den Theorien von Hobbes und Locke. Sie führt die zentrale Forschungsfrage ein: Hält der Ruf nach Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Polizei, was er verspricht? Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende Untersuchung der Selbstpräsentation der Polizei und der dahinterliegenden Realität.
I. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Polizei, beginnend mit ihrer Entstehung im 16. Jahrhundert bis hin zur modernen, reformierten Exekutive. Es wird die Polizei zunächst als Männerdomäne dargestellt, die historische Entwicklung der weiblichen Beteiligung am Polizeidienst beschrieben und die Herausforderungen, wie Vorurteile und Stereotype, behandelt. Die Reformen von 1984 und 2003 zur Integration von Frauen und die damit verbundenen Veränderungen werden detailliert erläutert. Der Wandel von der "Männerdomäne" hin zu einer mehr gleichberechtigten Institution wird nachvollzogen.
II. Forschungsdesign: (Angenommen, dieses Kapitel enthält eine Forschungsfrage und die angewandte Methode. Da der Text nur Bruchstücke des Kapitels zeigt, wird hier eine allgemeine Zusammenfassung gegeben). Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsfrage und die Methodik, die für die Untersuchung der Integration von Frauen in den Polizeidienst verwendet wurden. Es legt die Grundlage für die Analyse der Ergebnisse und die Beantwortung der Forschungsfrage dar.
III. Ergebnisse: (Angenommen, dieses Kapitel beinhaltet die Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse der Forschung. Da der Text nur Bruchstücke des Kapitels zeigt, wird hier eine allgemeine Zusammenfassung gegeben). Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es enthält wahrscheinlich eine detaillierte Analyse der Daten, die im vorherigen Kapitel beschrieben wurden. Es liefert Beweise für die Thesen und Schlussfolgerungen der Studie, die im nächsten Kapitel diskutiert werden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Integration von Frauen in den Polizeidienst
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Integration von Frauen in den Polizeidienst. Sie beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der Polizei als Männerdomäne und analysiert die Herausforderungen und Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter. Ein Fokus liegt auf der Selbstpräsentation der Polizei im Vergleich zu den realen Gegebenheiten.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Hält der Ruf nach Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Polizei, was er verspricht?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptkapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Forschungsdesign, Ergebnisse und weiterführende Literatur/Bibliographie/Abbildungsverzeichnis/Anhang.
Was wird im Kapitel "Theoretischer Hintergrund" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die geschichtliche Entwicklung der Polizei als Männerdomäne, die Herausforderungen bei der Integration von Frauen (Vorurteile, Stereotype), die Reformen von 1984 und 2003 zur Integration von Frauen und den damit verbundenen Wandel hin zu einer gleichberechtigteren Institution.
Was wird im Kapitel "Forschungsdesign" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und die Forschungsfrage der Arbeit, die zur Untersuchung der Integration von Frauen in den Polizeidienst verwendet wurden. Es bildet die Grundlage für die Analyse der Ergebnisse.
Was wird im Kapitel "Ergebnisse" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, inklusive einer detaillierten Datenanalyse und liefert Beweise für die Thesen und Schlussfolgerungen der Studie.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtliche Entwicklung der Polizei und ihren Wandel von einer Männerdomäne, die Herausforderungen der Integration von Frauen, Vorurteile und Stereotype gegenüber Polizistinnen, den Vergleich männlicher und weiblicher Rollen innerhalb der Polizei und die Auswirkungen von Reformen auf die Gleichstellung.
Welche Methode wurde in der Arbeit verwendet?
Die genaue Methode wird im Kapitel "Forschungsdesign" detailliert beschrieben. Der Text liefert jedoch keine spezifischen Angaben dazu.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die konkreten Schlussfolgerungen werden im Kapitel "Ergebnisse" und der anschließenden Diskussion präsentiert. Der Text bietet nur eine allgemeine Zusammenfassung der Kapitel.
Wo finde ich die Bibliographie und das Literaturverzeichnis?
Die Bibliographie, das Literaturverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis und der Anhang befinden sich am Ende der Arbeit.
- Arbeit zitieren
- BA Silvia Kopper-Zisser (Autor:in), 2013, Frauen im Dienst der Polizei. Eine Untersuchung der Selbstpräsentation der Institution Polizei und die Realität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/296289