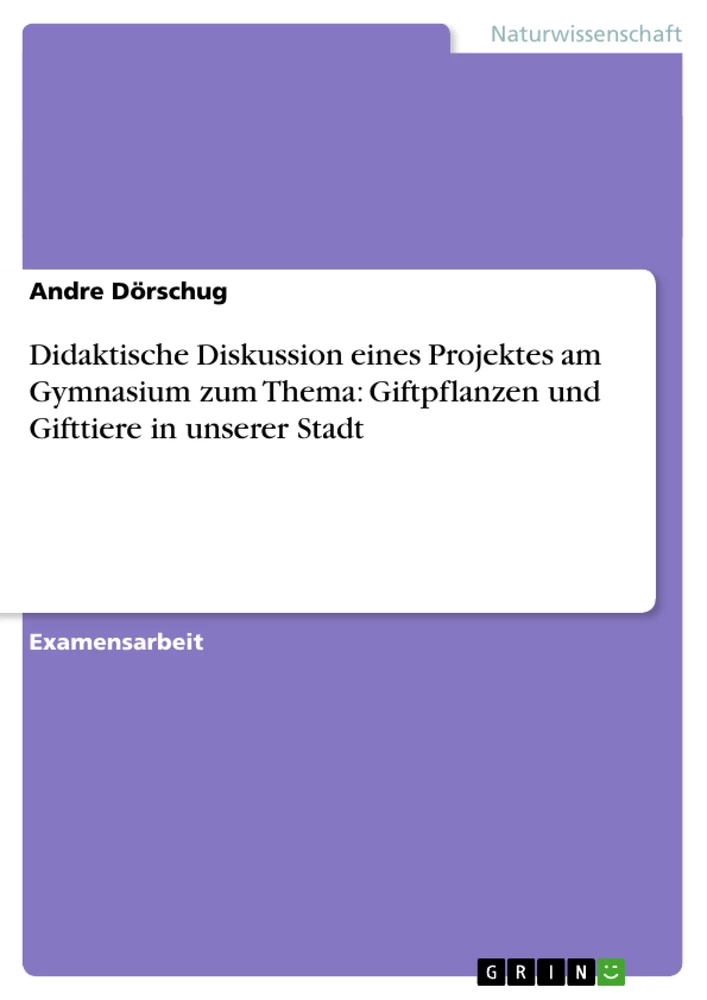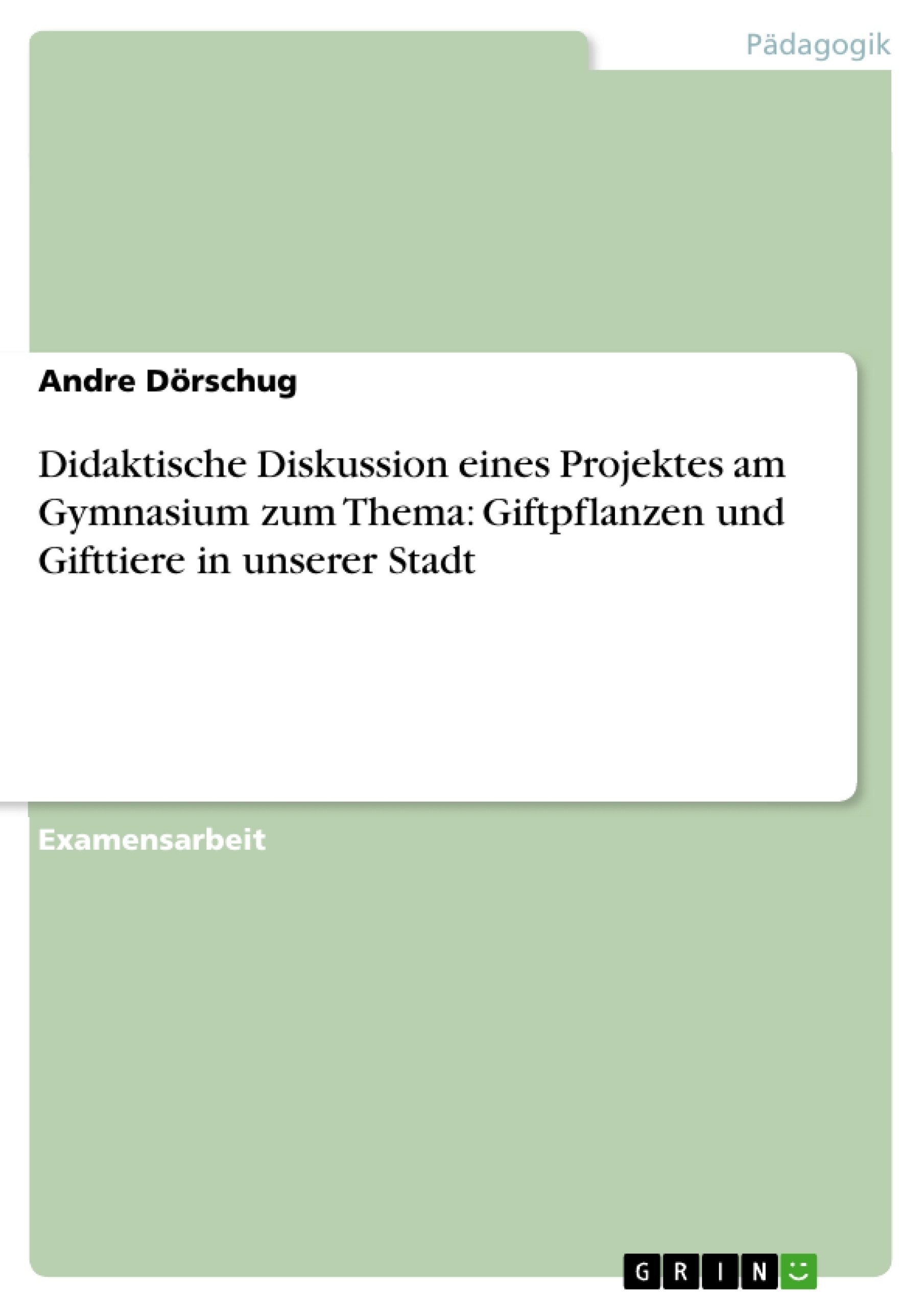Wir sind umgeben von giftigen Pflanzen und Tieren. Ein genauerer Blick in unsere Umgebung zeigt es: Im Garten sehen wir Lorbeer, Lebensbaum und Eibe. Beim Spaziergang in der Natur begegnen wir Fingerhut, Schöllkraut und Zaunrübe. Selbst viele unserer Zimmerpflanzen wie z.B. Weihnachtsstern und Diffenbachia sind giftig. Am Kaffeetisch naschen Wespen von unserem Kuchen, beim Beerensammeln können wir der Kreuzotter begegnen. Gehen wir barfuß über die Wiesen, werden wir manchmal von Bienen gestochen.
Giftige Pflanzen und Tiere werden von vielen Menschen als Übel betrachtet. Wespennester werden ausgebrannt, giftige Pflanzen aus dem Garten verbannt und am Wegrand beim Spaziergang ausgerissen. Die Kreuzotter wird beim Versuch zu fliehen im Heidelbeergebüsch erschlagen.
Viele Menschen glauben dabei, etwas Gutes getan zu haben, indem sie die Welt von diesen giftigen, gefährlichen Lebewesen befreit haben. Die Gleichung, giftig gleich gefährlich, ist nur bedingt richtig. Ohne Zweifel sind Gefahren durch Giftpflanzen und Gifttiere gegeben und müssen beachtet werden. Doch die Gefahren werden in der Bevölkerung überhöht wahrgenommen. Bei den Menschen gibt es viele Ängste und Befürchtungen. In Statistiken über Vergiftungsursachen sind Giftpflanzen und Gifttiere jedoch nur auf den hinteren Rängen zu finden (auch bei Kindern). Ein sehr viel größeres Gefahrenpotential geht von Haushaltsprodukten und Arzneimitteln aus (HESSE 1998).
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Sachanalyse
- Vorbemerkungen
- Zum Begriff „Gift“
- Biologie ausgewählter Giftpflanzen und Gifttiere
- Vorbemerkungen
- Gliederungsprinzipien
- Biologie Giftpflanzen
- Vergiftungen durch Berühren
- Vergiftungen durch Naschen auffallender Samen und Früchte
- Vergiftungen bei Nutzung als Nahrungs-/Heilmittel
- Vergiftungen bei Nutzung als Rauschgift
- Biologie Gifttiere
- Vergiftungen durch Berühren
- Vergiftungen durch Bisse
- Vergiftungen durch Stiche
- Sonderfall: Waldameise
- Didaktische Diskussion
- Vorbemerkungen
- Literatur und Gesetzliches
- Zum Begriff „Gift“ in der Literatur für die Schule
- Inhaltliche Vorgaben
- Sicherheitsvorschriften
- Naturschutzgesetze
- Vorschriften zum außerschulischen Unterricht
- Zielvorgaben
- Unterrichtsprinzipien
- Didaktische Re-Konstruktion
- Projektunterricht in arbeitsteiligen Kleingruppen
- Erprobung an der Schule
- Planung
- Durchführung
- Fazit
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Abschließende Erklärungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die didaktischen Aspekte eines Projekts zum Thema „Giftpflanzen und Gifttiere in unserer Stadt“ am Gymnasium. Ziel ist es, einen praxisorientierten Unterrichtsentwurf zu entwickeln und dessen Umsetzung zu evaluieren. Dabei werden sowohl die sachlichen Inhalte als auch die methodischen Vorgehensweisen kritisch beleuchtet.
- Sachanalyse von Giftpflanzen und -tieren
- Didaktische Aufbereitung des Themas für den Schulunterricht
- Entwicklung eines projektbasierten Unterrichtskonzepts
- Umsetzung und Evaluation des Unterrichtsprojekts
- Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten und rechtlichen Vorgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort wird hier nicht zusammengefasst, da es sich um einführende Bemerkungen handelt.
Einleitung: Die Einleitung wird hier nicht zusammengefasst, da es sich um einführende Bemerkungen handelt.
Sachanalyse: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung von Giftpflanzen und -tieren, kategorisiert nach Vergiftungsmechanismen (Berührung, Verzehr, Nutzung als Heilmittel/Rauschmittel). Es werden verschiedene Arten detailliert beschrieben, inklusive ihrer biologischen Eigenschaften und toxischen Wirkungen. Der Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Fundierung des Themas, um eine solide Basis für die didaktische Aufarbeitung zu schaffen. Die Gliederung nach Vergiftungsmechanismen ermöglicht ein strukturiertes Verständnis der Risiken und der damit verbundenen Gefahren.
Didaktische Diskussion: Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Aufbereitung des Themas für den Schulunterricht. Es werden relevante Literatur, gesetzliche Vorgaben und Sicherheitsaspekte berücksichtigt. Ein detailliertes Konzept für projektbasierten Unterricht in Kleingruppen wird vorgestellt, inklusive Planung, Durchführung und Evaluation. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines praxisorientierten und schülerzentrierten Unterrichtsansatzes, der die Lernenden aktiv in den Prozess der Wissensgewinnung und -verarbeitung einbindet. Die Erprobung des Konzepts an einer Schule wird beschrieben und bewertet.
Schlüsselwörter
Giftpflanzen, Gifttiere, Didaktik, Projektunterricht, Biologieunterricht, Gymnasium, Sicherheitsaspekte, Naturschutz, Risikomanagement, praktischer Unterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Didaktische Aspekte eines Projekts zum Thema „Giftpflanzen und Gifttiere in unserer Stadt“
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Vorschau auf eine Arbeit, die sich mit den didaktischen Aspekten eines Projekts zum Thema „Giftpflanzen und Gifttiere in unserer Stadt“ am Gymnasium befasst. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Evaluierung eines praxisorientierten Unterrichtsentwurfs, der sowohl die sachlichen Inhalte als auch die methodischen Vorgehensweisen kritisch beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in die Kapitel: Vorwort, Einleitung, Sachanalyse (mit Unterkapiteln zu Giftpflanzen und -tieren und deren Vergiftungsmechanismen), Didaktische Diskussion (mit Unterkapiteln zu Literatur, Gesetzlichem, Zielvorgaben und der Erprobung an der Schule), Abbildungsverzeichnis, Literaturverzeichnis und Abschließende Erklärungen.
Worauf konzentriert sich die Sachanalyse?
Die Sachanalyse bietet eine detaillierte Darstellung von Giftpflanzen und -tieren, kategorisiert nach Vergiftungsmechanismen (Berührung, Verzehr, Nutzung als Heilmittel/Rauschmittel). Es werden verschiedene Arten beschrieben, inklusive ihrer biologischen Eigenschaften und toxischen Wirkungen. Der Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Fundierung des Themas.
Was ist der Kern der Didaktischen Diskussion?
Die Didaktische Diskussion behandelt die didaktische Aufbereitung des Themas für den Schulunterricht. Sie berücksichtigt relevante Literatur, gesetzliche Vorgaben und Sicherheitsaspekte. Es wird ein detailliertes Konzept für projektbasierten Unterricht in Kleingruppen vorgestellt, inklusive Planung, Durchführung und Evaluation. Der Fokus liegt auf einem praxisorientierten und schülerzentrierten Ansatz.
Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt?
Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Evaluierung eines praxisorientierten Unterrichtsentwurfs zum Thema „Giftpflanzen und Gifttiere in unserer Stadt“ für das Gymnasium. Es soll ein schülerzentrierter und methodisch fundierter Ansatz geschaffen werden, der die Lernenden aktiv in den Prozess der Wissensgewinnung und -verarbeitung einbindet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Thema?
Schlüsselwörter sind: Giftpflanzen, Gifttiere, Didaktik, Projektunterricht, Biologieunterricht, Gymnasium, Sicherheitsaspekte, Naturschutz, Risikomanagement, praktischer Unterricht.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Lehrkräfte, die Biologieunterricht am Gymnasium geben und an der Entwicklung von praxisorientierten und schülerzentrierten Unterrichtskonzepten interessiert sind. Es ist auch relevant für Personen, die sich wissenschaftlich mit der Didaktik im Biologieunterricht befassen.
- Citar trabajo
- Andre Dörschug (Autor), 2003, Didaktische Diskussion eines Projektes am Gymnasium zum Thema: Giftpflanzen und Gifttiere in unserer Stadt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29678