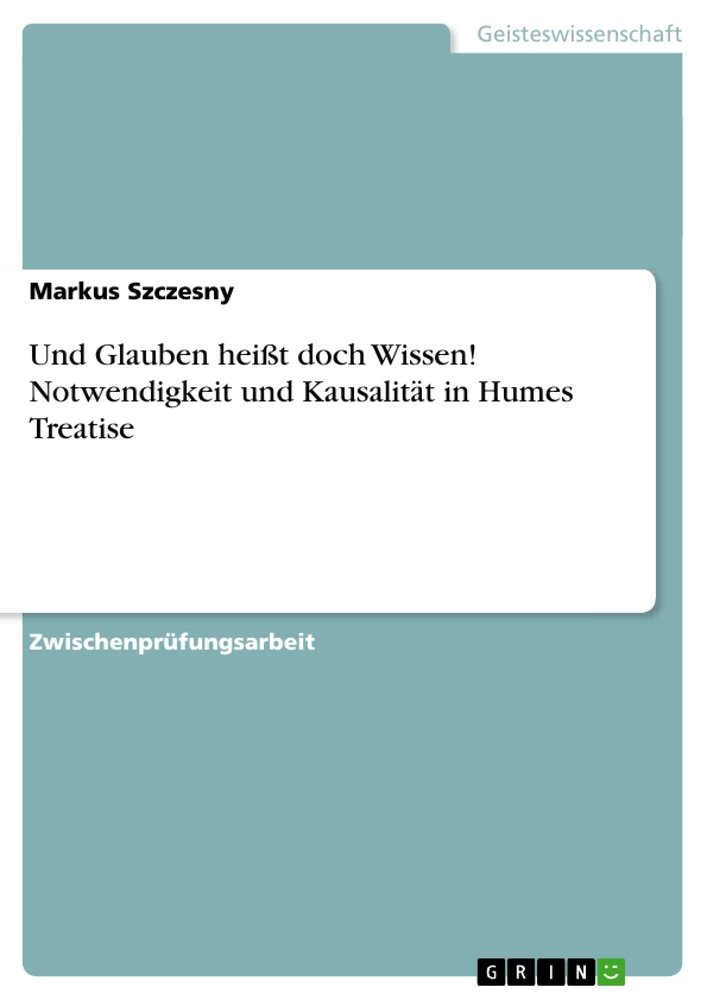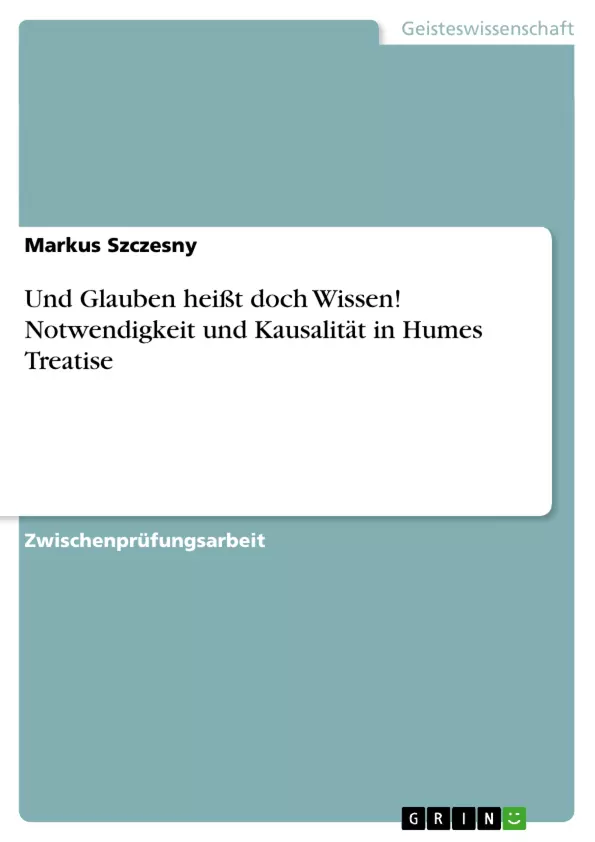„Eine Darstellung der Grundgedanken der Humeschen Philosophie mit dem
Problem der Kausalität zu beginnen, hat eine lange und mittlerweile geradezu
ehrwürdige Tradition, welche sich (mindestens) bis auf Kant zurückführen
läßt.“ (Bong 1998, S. 283)
Tatsächlich gibt Kant in den Prolegomena nicht nur über Humes Hilfe bei der Erweckung
aus seinem „dogmatischen Schlummer“ (Kant 1968b, A12) Auskunft. Desweiteren
ist dort auch zu erfahren, dass Humes Metaphysik Kants Meinung nach
vorrangig der Frage nachging, wie „etwas so beschaffen sein könne, daß, wenn es
gesetzt ist, dadurch auch etwas anderes notwendig gesetzt werden müsse“ (Kant
1968b, A7). Im Vertrauen auf Kants Urteil sollte mit der Frage nach der Notwendigkeit
ein Aspekt der Philosophie Humes angesprochen sein, der allein aufgrund seiner
historischen Präsenz eine Beschäftigung mit dem Thema rechtfertigt.
Das Problem der idea of necessary connexion findet sich originär im 14. Abschnitt des
dritten Teils von Buch I des Treatise of Human Nature ausführlich behandelt. Dort
schlussfolgert Hume bezüglich der Natur der Notwendigkeit:
„There is, then, nothing new either discovered or produc'd in any objects by
their constant conjunction [...]. These ideas, therefore, represent not any thing,
that does or can belong to the objects, which are constantly conjoin'd.“ (S.
164)1
Stattdessen verortet Hume das Kausalitätsprinzip im menschlichen Geist: „the efficacy
of causes lie in the determination of the mind!“ (S. 167)
„Humes Paukenschlag“ (Pätzold 1998, S. 10) ist nicht unmittelbar einsichtig und bedarf
der Ausführung. Deshalb soll hier zunächst die Argumentationsstruktur nachgezeichnet
werden, mit der Hume seine „Kausalitätsskepsis“ (Bonk 1998, S. 283) begründet
(I). Daran anschließend soll geprüft werden, ob Humes Argumentation überzeugen
kann und überzeugt hat (II) und welches Interpretationsspektrum von Humes
Lösung aufgeworfen wird (III).
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass ich aus Gründen der Übersichtlichkeit
und Lesbarkeit das generische Maskulinum als Kollektivbezeichnung verwende.
1 Angaben ohne weiteren Hinweis auf Autor und Erscheinungsjahr verweisen auf: Hume 1978.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die idea of necessity
- I.1. Begriffliche und theoretische Vorentscheidungen
- I.2. Das Wesen der Notwendigkeit
- I.2.1. Gewöhnliche Annahmen
- I.2.2. Gangbare Worte
- I.2.3. Humes negative Antwort
- I.2.4. Humes positive Antwort
- I.3. Zusammenfassung
- I.3.1. Die gewöhnliche Meinung (M1)
- I.3.2. Die falsche philosophische Meinung (M2)
- I.3.3. Die richtige philosophische Meinung (M3)
- II. Zur Überzeugungskraft der humeschen Argumentation
- II.1. Zur Kohärenz der Argumentationsstränge
- II.1.1. M1
- II.1.2. M2
- II.1.3. M3
- II.2. Klärungen und Korrekturen
- II.2.1. Radikaler Reduktionismus
- II.2.2. Naive Auffassungen
- II.2.3. Unstimmigkeiten
- II.3. Kants und Husserls Einwände gegen Hume
- II.3.1. Kant
- II.3.2. Husserl
- II.4. Urteil
- III. Zur Interpretation des humeschen Kausalitätskonzepts
- III.1. Kausalität abschaffen
- III.2. Was bleibt?
- IV. Literaturverzeichnis
- IV.1. Werkausgaben
- IV.2. Aufsätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Humes Auseinandersetzung mit dem Problem der Notwendigkeit und Kausalität im ersten Buch seines „Treatise of Human Nature“. Sie untersucht Humes Argumentation, die die Kausalität nicht in der Welt, sondern im menschlichen Geist verortet, und beleuchtet die Überzeugungskraft seiner Argumentation. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis von Humes Kausalitätskonzept und seinen Implikationen für die Philosophie zu vermitteln.
- Die „idea of necessity“ als zentrales Thema der Arbeit
- Humes Kritik an traditionellen Auffassungen von Notwendigkeit und Kausalität
- Die empirische Grundlage von Humes Philosophie
- Die Rolle des menschlichen Geistes bei der Konstruktion von Kausalität
- Die Interpretation und Relevanz von Humes Kausalitätskonzept
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Problem der Notwendigkeit und Kausalität ein und stellt Humes zentrale These im 14. Abschnitt des dritten Teils von Buch I des „Treatise of Human Nature“ vor: Die Notwendigkeit liegt nicht in den Objekten selbst, sondern im menschlichen Geist.
Kapitel I analysiert Humes begriffliche und theoretische Vorentscheidungen, insbesondere die Unterscheidung zwischen „impressions“ und „ideas“ und die zentrale empirische These, dass jede „idea“ auf einer „impression“ basiert. Anschließend wird Humes Argumentation zum Wesen der Notwendigkeit rekonstruiert.
Kapitel II untersucht die Überzeugungskraft von Humes Argumentation, indem es die Kohärenz der Argumentationsstränge und mögliche Kritikpunkte analysiert. Es werden auch die Einwände von Kant und Husserl gegen Humes Philosophie betrachtet.
Kapitel III befasst sich mit der Interpretation von Humes Kausalitätskonzept. Es wird erörtert, ob Hume die Kausalität abschaffen will, und welche Konsequenzen sich aus seinem Konzept ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen philosophischen Begriffen wie Notwendigkeit, Kausalität, Empirismus, Skeptizismus, Impressionen, Ideen, menschlicher Geist, Kausalitätsprinzip, Hume, Kant, Husserl.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Humes Hauptargument zur Kausalität?
David Hume argumentiert, dass Kausalität keine Eigenschaft der Objekte ist, sondern eine Gewohnheit des menschlichen Geistes, die aus der ständigen Verbindung von Ereignissen resultiert.
Was bedeutet „idea of necessary connexion“?
Es ist die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung zwischen Ursache und Wirkung, für die Hume jedoch keine entsprechende sinnliche Wahrnehmung (impression) findet.
Wie unterschied Hume zwischen „impressions“ und „ideas“?
Impressions sind lebhafte, unmittelbare Sinneswahrnehmungen, während Ideas schwächere Abbilder dieser Wahrnehmungen im Denken sind.
Welche Kritik äußerte Immanuel Kant an Hume?
Kant fühlte sich durch Hume aus dem „dogmatischen Schlummer“ geweckt, sah Kausalität jedoch als eine Kategorie a priori des Verstandes an, nicht bloß als Gewohnheit.
Ist Hume ein radikaler Skeptiker?
Hume wird oft als Kausalitätsskeptiker bezeichnet, da er die rationale Begründbarkeit von Ursache-Wirkungs-Beziehungen in der Außenwelt bestreitet.
- Quote paper
- Magister Artium Markus Szczesny (Author), 2004, Und Glauben heißt doch Wissen! Notwendigkeit und Kausalität in Humes Treatise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29736