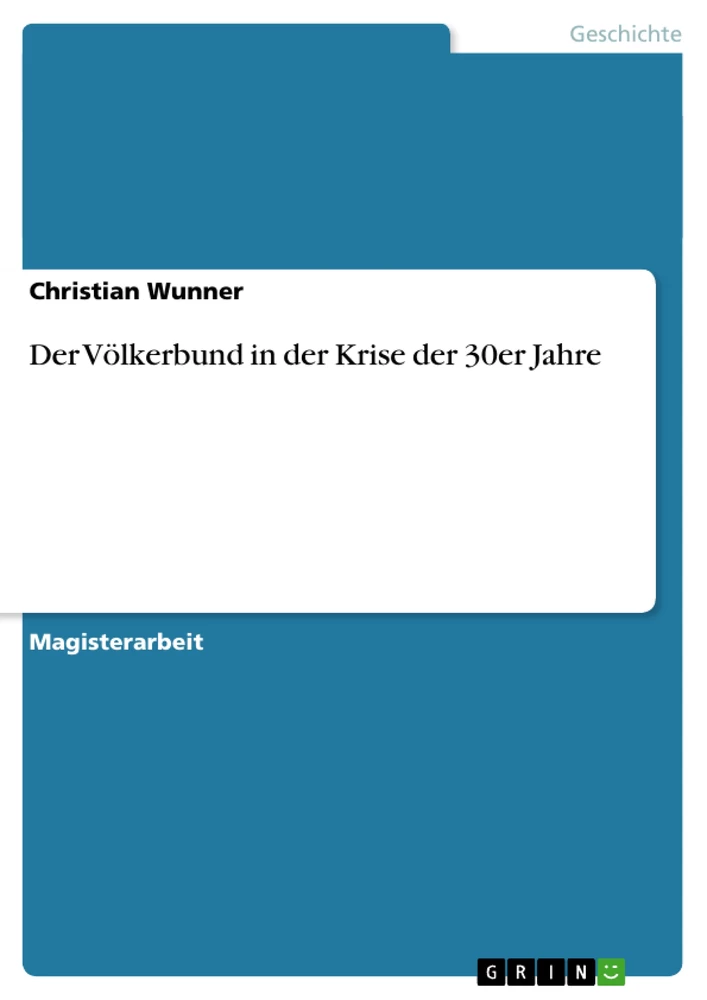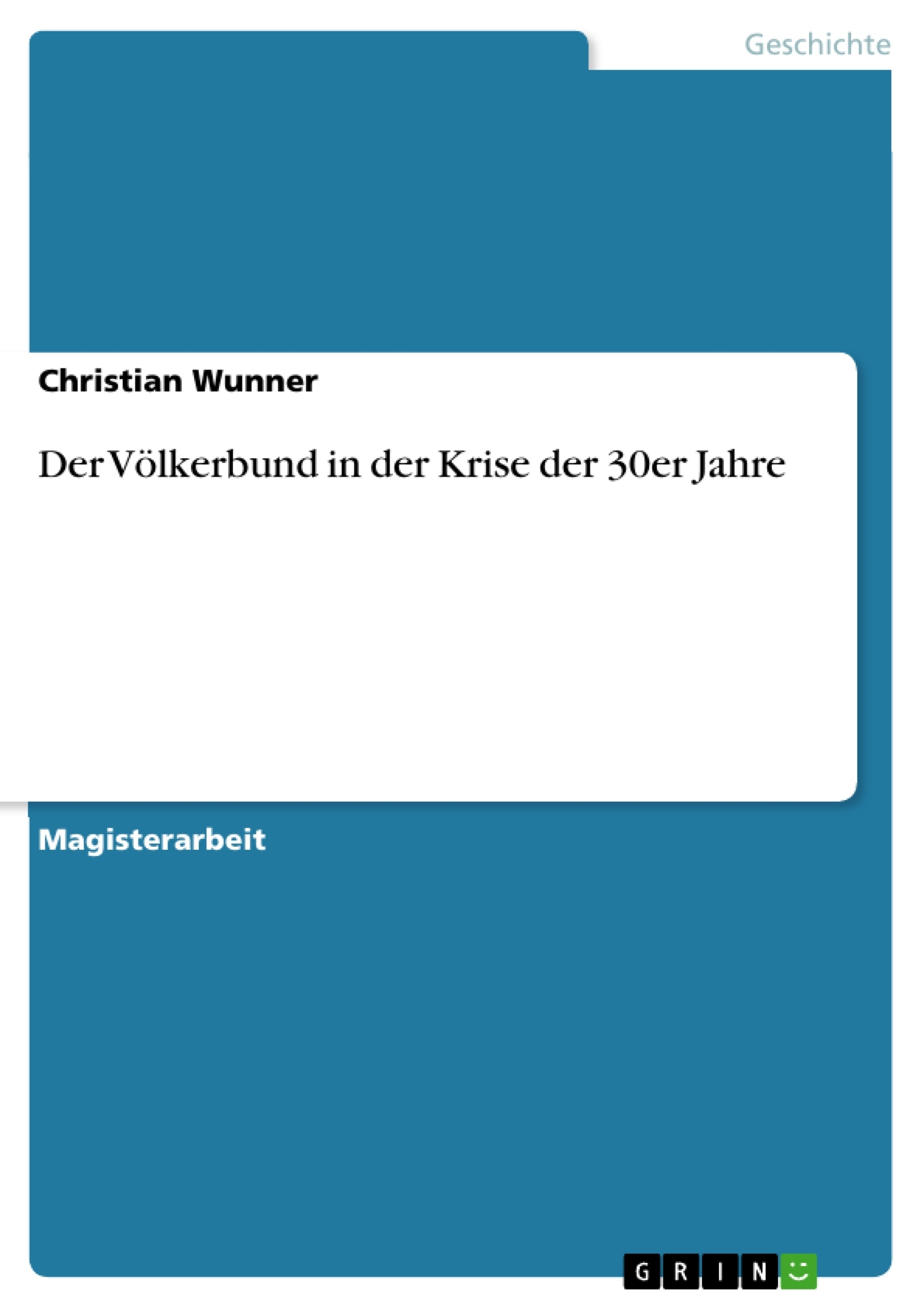Mit der Unterzeichnung der Pariser Vorortverträge 1919/1920 fand der Erste Weltkrieg völkerrechtlich sein Ende. Der Krieg hatte in nur vier Jahren zwischen 1914 und 1918 etwa 8,5 Millionen Opfer1 gefordert.
Dieser bis dahin größte militärische Konflikt der Menschheitsgeschichte stellt eine der wichtigsten Zäsuren in der neuesten Geschichtsschreibung dar. Die durch den Krieg entstandenen schwerwiegenden Folgen sollten das Leben der künftigen Generationen bis zum heutigen Tag beeinflussen.
Das Mächtegleichgewicht in der Welt hatte sich mit dem Ende des Krieges tiefgreifend verändert. Die einstige große Weltmacht, das britische Empire, wurde von den USA zusehends verdrängt. Ehemalige Großmächte, wie Österreich-Ungarn, Rußland und das Deutsche Reich, hatten ihre bedeutende Stellung im internationalen System eingebüßt. Durch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie durch den neu erstarkenden Nationalismus in vielen Staaten Europas wurde neues Konfliktpotential geschaffen, das sowohl innergesellschaftlich als auch nach außen hin zu einer Belastungsprobe für die Staaten und die internationalen Beziehungen wurde.
Die Beschaffenheit der Friedensverträge rief schon bei der Unterzeichnung den Revisionswillen der Verliererstaaten, allen voran Deutschland s, hervor, und auch die „Pariser Left-overs“2, Problematiken, die sich aus dem Krieg ergeben hatten, während der Verhandlungen aber noch nicht gelöst werden konnten, stellten die in Paris geschaffene Nachkriegsordnung immer wieder auf die Probe. „In Europa hatte kein Krieg seit Bismarck (…) die Landkarte so stark verändert, wie es die Friedensschlüsse, die den Ersten Weltkrieg beendeten, zuwege brachten. Der eigentliche „Revolutionär“ im Staatensystem Europas war der Erste Weltkrieg (…). Doch die alten und die neuen Staaten blieben in ihrer Mehrzahl unbefriedigte Staaten.“3 Diese Faktoren, die alle zu den Folgeerscheinungen des Ersten Weltkrieges zählen, sollten dazu beitragen, Europa und den Rest der Welt nur 20 Jahre später in die nächste Katastrophe stürzen.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Die Ausgangssituation in den internationalen Beziehungen 1918/1919
- 1.1 Das „Versailler System“
- 1.1.2 Neue Fronten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
- 1.2 Die Bruchstellen im „Versailler System“
- Kapitel II: Der Völkerbund – Die Rahmenbedingungen eines kollektiven Sicherheitssystems
- 2.1 Die Satzung des Völkerbundes
- 2.2 Die Organe des Völkerbundes
- 2.3 Der Kern der Satzung: Die Artikel 8 – 17 – Kollektive Sicherheit, Abrüstung, Streitschlichtungsverfahren und globaler Geltungsanspruch
- 2.4 Resümee
- Kapitel III: Der Völkerbund in den 20er Jahren
- 3.1 Die „Pariser left-overs“ und die Konkurrenz des Völkerbundes zu den interalliierten Organen Oberster Rat und Botschafterkonferenz
- 3.2 Die „Oberschlesienfrage“
- 3.2.1 Vorgeschichte und Ausgangsbedingungen
- 3.2.2 Abstimmungskampf und Plebiszit
- 3.2.3 Das Ergebnis der Abstimmung
- 3.2.4 Die Überweisung an den Völkerbund – Sensation oder Kalkül?
- 3.2.5 Der Teilungsplan des Völkerbundes
- 3.2.6 Die Konsequenzen der Teilung und die Bewertung der Arbeit des Völkerbundes
- 3.3 Der Korfu-Konflikt
- 3.3.1 Entstehung des Konflikts
- 3.3.2 Die Einschaltung des Völkerbundes durch Griechenland
- 3.3.3 Resümee
- 3.4 Resümee der Aufbauphase
- Kapitel IV: „The halcyon days“ – Tage der Ruhe – Die Phase internationaler Entspannung – Eine Chance für den Völkerbund?
- Kapitel V: Der Völkerbund in der Krise der 30er Jahre
- 5.1 Die Erosion der internationalen Ordnung im Fernen Osten und in Europa
- 5.1.1 Der Übergang zur Krisenphase
- 5.2 Der Mandschureikonflikt 1931 - 1933
- 5.2.1 Das Washingtoner System von 1922
- 5.2.2 Neuralgische Punkte des Washingtoner Systems
- 5.2.3 Die innenpolitische Lage in China und die besonderen Interessen Japans in der Mandschurei
- 5.2.4 Der „Mukden-Zwischenfall“ und die Einschaltung des Völkerbundes
- 5.2.5 Eskalation: Kämpfe in Shanghai, außerordentliche Bundesversammlung und die Gründung des Staates Manschukuo
- 5.2.6 Resümee
- 5.2.7 Die Bedeutung des Konfliktes für den Völkerbund
- 5.3 Internationale Abrüstung
- 5.3.1 Der deutsch-französische Antagonismus in der Abrüstungsfrage
- 5.3.2 Die Genfer Abrüstungskonferenz
- 5.4 Der Chaco-Krieg
- 5.4.1 Ursachen
- 5.4.2 Völkerbundsatzung contra Monroe-Doktrin: Die Problematik konkurrierender Vermittlungsinstanzen
- 5.4.3 Die vier Phasen des Chaco-Krieges
- 5.4.4 Die Schlichtungsbemühungen im Chaco-Konflikt
- 5.4.5 Resümee
- 5.5 Die Volksabstimmung an der Saar - Eine verhinderte Chance?
- 5.5.1 Die Entwicklung der politischen Kultur im Saargebiet bis 1935
- 5.5.2 Der Abstimmungskampf
- 5.5.3 Die Vorbereitung des Plebiszits und das Ergebnis der Abstimmung
- 5.5.4 Resümee
- 5.6 Der italo-abessinische Krieg 1935-1936 und das Scheitern der kollektiven Sicherheitsidee
- 5.6.1 Die Entstehung des Konfliktes und die internationale Lage im Herbst 1935
- 5.6.2 Der Konflikt vor dem Völkerbund
- 5.6.3 Die Wirksamkeit der Völkerbundsanktionen
- 5.6.4 Der Hoare-Laval-Plan
- 5.6.5 Das Ende der Sanktionen
- 5.6.6 Resümee
- Kapitel VI: Der Fall des Völkerbundes und sein Gang in die Bedeutungslosigkeit – Die „Phase des Schattendaseins“
- 6.1 Der Spanische Bürgerkrieg und die Nichtinterventionspolitik 1936-1939
- 6.2 Nichtintervention und Aufgabe des Prinzips der kollektiven Sicherheit
- 6.3 Von Genf nach München – Rückkehr zum Europäischen Konzert
- 6.3.1 Die Untätigkeit des Völkerbundes in den Jahren 1937 – 1939
- 6.4 Der sowjetisch-finnische Krieg und der Ausschluß der Sowjetunion aus dem Völkerbund - Wiederbelebung eines Sterbenden?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Völkerbund in der Krise der 1930er Jahre. Ziel ist es, die Ursachen für sein Scheitern zu analysieren und die Rolle des Völkerbundes im Kontext der sich verschärfenden internationalen Spannungen zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet sowohl strukturelle Schwächen des Völkerbundes als auch das Versagen der Mitgliedsstaaten, die Prinzipien kollektiver Sicherheit zu wahren.
- Das Versailler System und seine Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen
- Die Struktur und Funktionsweise des Völkerbundes
- Der Völkerbund in den 1920er Jahren: Erfolge und Herausforderungen
- Die Krisen der 1930er Jahre und das Scheitern des Völkerbundes (Mandschurei, Abessinien, Spanien)
- Die Verantwortung der Mitgliedsstaaten für das Scheitern des Völkerbundes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Krise des Völkerbundes in den 1930er Jahren. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise und die zentralen Forschungsfragen. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Ursachen für das Scheitern des Völkerbundes, wobei sowohl interne als auch externe Faktoren berücksichtigt werden.
Kapitel I: Die Ausgangssituation in den internationalen Beziehungen 1918/1919: Dieses Kapitel beschreibt die politische und sicherheitspolitische Lage nach dem Ersten Weltkrieg. Es analysiert das „Versailler System“ mit seinen Stärken und Schwächen und beleuchtet die Entstehung neuer Konfliktlinien, die den Grundstein für spätere Krisen legten. Der Fokus liegt auf den strukturellen Problemen des Versailler Systems und dessen Unfähigkeit, langfristigen Frieden zu garantieren.
Kapitel II: Der Völkerbund – Die Rahmenbedingungen eines kollektiven Sicherheitssystems: Dieses Kapitel analysiert die Satzung und die Organisation des Völkerbundes. Es untersucht die zentralen Prinzipien des Völkerbundes, insbesondere die kollektive Sicherheit, Abrüstung und Streitschlichtung, und bewertet deren praktische Umsetzbarkeit. Die Analyse zeigt die Ambivalenzen und Spannungen innerhalb der Satzung auf und legt den Grundstein für das Verständnis der späteren Handlungsunfähigkeit.
Kapitel III: Der Völkerbund in den 20er Jahren: Dieses Kapitel untersucht die Aktivitäten des Völkerbundes in den 1920er Jahren. Es analysiert verschiedene Konflikte, wie die Oberschlesienfrage und den Korfu-Konflikt, um die Stärken und Schwächen des Völkerbundes in der Praxis zu beleuchten. Die Analyse zeigt sowohl Erfolge bei der Konfliktlösung als auch die Grenzen des Einflusses des Völkerbundes auf.
Kapitel IV: „The halcyon days“ – Tage der Ruhe – Die Phase internationaler Entspannung – Eine Chance für den Völkerbund?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Phase relativer internationaler Entspannung in den späten 1920er Jahren und bewertet das Potential des Völkerbundes, diese positive Entwicklung zu festigen und dauerhaften Frieden zu sichern. Es analysiert die Faktoren, die zu dieser Entspannung beitrugen, und untersucht, inwiefern der Völkerbund diese Chance nutzen konnte.
Kapitel V: Der Völkerbund in der Krise der 30er Jahre: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert detailliert die Krisen der 1930er Jahre, die zum Scheitern des Völkerbundes führten. Der Mandschureikonflikt, der Chaco-Krieg, die Saarabstimmung und der Italo-Äthiopische Krieg werden im Detail untersucht, um die Ursachen des Scheiterns der kollektiven Sicherheit aufzuzeigen. Die Analyse der jeweiligen Konflikte zeigt die zunehmende Ohnmacht des Völkerbundes und das Versagen der Mitgliedsstaaten, effektiv zusammenzuarbeiten.
Schlüsselwörter
Völkerbund, Kollektive Sicherheit, Versailler Vertrag, 1930er Jahre, Internationale Beziehungen, Mandschurei, Abessinien, Chaco-Krieg, Abrüstung, Krisenmanagement, Nationalismus, Isolationismus, Appeasement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Völkerbund in der Krise der 1930er Jahre
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Völkerbund in der Krise der 1930er Jahre. Das Hauptziel ist die Analyse der Ursachen für sein Scheitern und die Beleuchtung der Rolle des Völkerbundes im Kontext der zunehmenden internationalen Spannungen. Es werden sowohl strukturelle Schwächen des Völkerbundes als auch das Versagen der Mitgliedsstaaten bei der Wahrung der Prinzipien kollektiver Sicherheit betrachtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Das Versailler System und seine Auswirkungen, die Struktur und Funktionsweise des Völkerbundes, seine Aktivitäten in den 1920er Jahren (Erfolge und Herausforderungen), die Krisen der 1930er Jahre und das Scheitern des Völkerbundes (Mandschurei, Abessinien, Spanien), sowie die Verantwortung der Mitgliedsstaaten für das Scheitern.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Methodik und Forschungsfragen. Kapitel I beleuchtet die politische Lage nach dem Ersten Weltkrieg und das Versailler System. Kapitel II analysiert die Satzung und Organisation des Völkerbundes. Kapitel III untersucht die Aktivitäten des Völkerbundes in den 1920er Jahren. Kapitel IV behandelt die Phase internationaler Entspannung. Kapitel V, der Kern der Arbeit, analysiert detailliert die Krisen der 1930er Jahre (Mandschurei, Chaco-Krieg, Saarabstimmung, Italo-Äthiopischer Krieg) und das Scheitern der kollektiven Sicherheit. Kapitel VI behandelt den Fall des Völkerbundes und seinen Niedergang.
Welche konkreten Konflikte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert detailliert den Mandschureikonflikt, den Chaco-Krieg, die Saarabstimmung, den Italo-Äthiopischen Krieg, den Korfu-Konflikt und die Oberschlesienfrage. Diese Fallstudien dienen der Illustration der Stärken und Schwächen des Völkerbundes und der Ursachen seines Scheiterns.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass das Scheitern des Völkerbundes auf eine Kombination aus internen strukturellen Schwächen und dem Versagen der Mitgliedsstaaten zurückzuführen ist. Die Unfähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit und die Prioritäten nationaler Interessen gegenüber der kollektiven Sicherheit werden als entscheidende Faktoren hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Völkerbund, Kollektive Sicherheit, Versailler Vertrag, 1930er Jahre, Internationale Beziehungen, Mandschurei, Abessinien, Chaco-Krieg, Abrüstung, Krisenmanagement, Nationalismus, Isolationismus, Appeasement.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für internationale Beziehungen, Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Geschichte des Völkerbundes interessieren. Sie bietet eine fundierte Analyse des Scheiterns eines wichtigen internationalen Friedensprojekts.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text der Arbeit, einschließlich des vollständigen Inhaltsverzeichnisses und der detaillierten Kapitelzusammenfassungen, ist in der vorliegenden Quelle enthalten. Die obigen FAQs liefern jedoch bereits eine umfassende Übersicht.
- Quote paper
- Christian Wunner (Author), 2004, Der Völkerbund in der Krise der 30er Jahre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29782