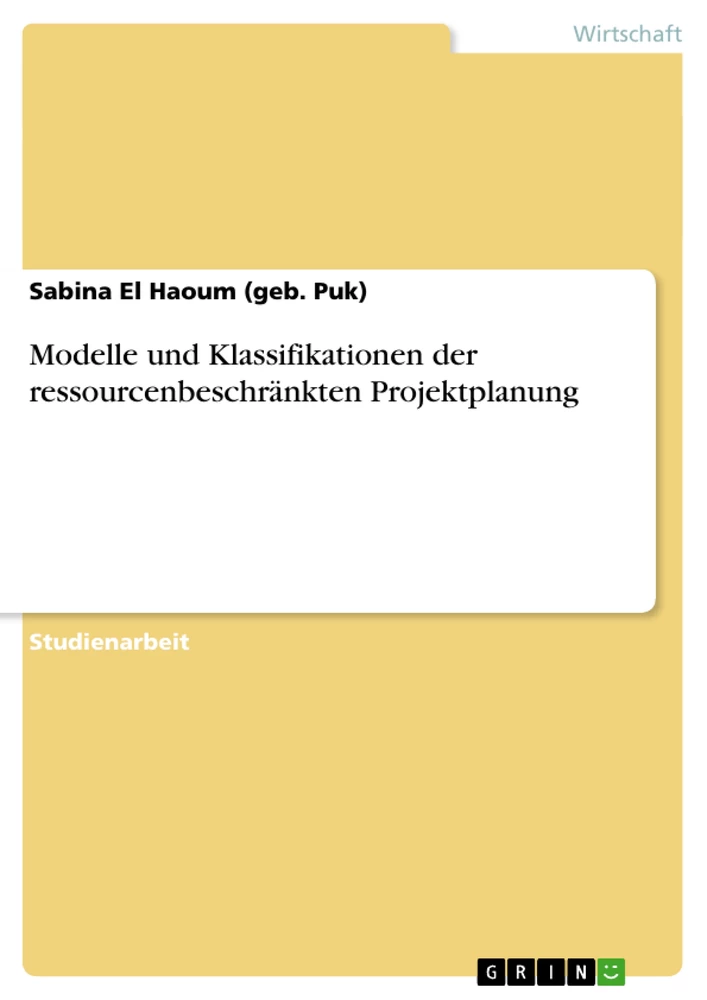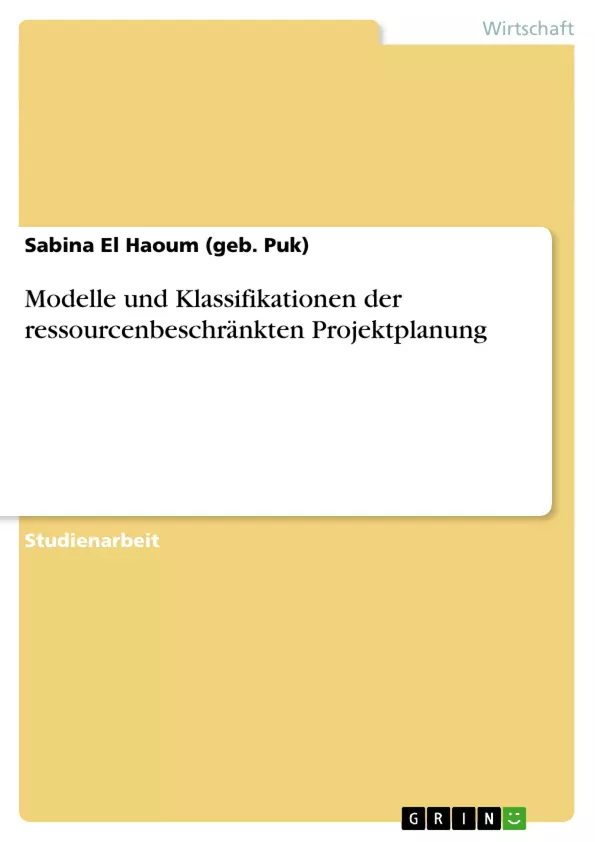Gegenstand der Projektplanung ist die zeitliche Planung von Vorgängen oder Aktivitäten eines Projektes unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen der Problemstellung mit dem Zweck der Optimierung einer vorgegebene Zielfunktion. Praxisrelevante Projektplanungsprobleme beinhalten zumeist Aktivitäten, deren Ausführung mit einem Bedarf an bestimmten Ressourcen(Arbeitern, Maschinen, Werkzeugen usw.) verbunden ist. Gilt es, die begrenzten
Kapazitäten dieser Ressourcen in die zeitliche Planung des Projektes einzubeziehen, spricht man von ressourcenbeschränkter Projektplanung (resource constrained project scheduling).
Die vorliegende Seminararbeit beschreibt die Modellierung ausgewählter grundlegender Probleme der ressourcenbeschränkten Projektplanung. Des Weiteren stellt sie zwei im Bereich der Projektplanung gebräuchliche Klassifikationsschemata vor.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen der Projektplanung
- 2.1 Zeitliche Anordnungsbeziehungen zwischen Aktivitäten
- 2.2 Planungsabhängige Zeitfenster
- 2.3 Ressourcen
- 3 Modellierung
- 3.1 Grundproblem der ressourcenbeschränkten Projektplanung
- 3.2 Berücksichtigung allgemeiner zeitlicher Anordnungsbeziehungen
- 3.3 Variable Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen
- 3.4 Kalendrierung
- 3.4.1 Ressourcenkalender
- 3.4.2 Aktivitätenkalender
- 3.4.3 Anordnungskalender
- 3.4.4 Konzeptionelles Modell
- 4 Klassifikationen
- 4.1 Nutzen von Klassifikationen
- 4.2 Drei-Feld-Klassifikation der Projektplanungsprobleme nach Herroelen u. a.
- 4.2.1 Feld a: Ressourcen
- 4.2.2 Feld β: Aktivitäten
- 4.2.3 Feld γ: Zielfunktion
- 4.3 Drei-Feld-Klassifikation der Projektplanungsprobleme nach Brucker u. a.
- 4.3.1 Feld a: Ressourcen
- 4.3.2 Feld β: Aktivitäten
- 4.3.3 Feld γ: Zielfunktion
- 4.4 Kritik an der Klassifikation nach Brucker u. a.
- 4.4.1 Einführung der Parameter PS und MPS im a-Feld
- 4.4.2 Beschreibung der Aktivitäten
- 4.4.3 Formelschreibweise zur Beschreibung der Zielfunktion
- 5 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Modellierung und Klassifizierung von Problemen der ressourcenbeschränkten Projektplanung. Ziel ist es, ausgewählte grundlegende Probleme zu beschreiben und gängige Klassifizierungsschemata vorzustellen. Die Arbeit bietet einen Überblick über die Modellierung verschiedener Aspekte, einschließlich der Berücksichtigung zeitlicher Abhängigkeiten und variierender Ressourcenverfügbarkeit.
- Modellierung ressourcenbeschränkter Projektplanung
- Berücksichtigung zeitlicher Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten
- Variable Ressourcenverfügbarkeit
- Klassifizierung von Projektplanungsproblemen
- Analyse verschiedener Klassifizierungsschemata
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der ressourcenbeschränkten Projektplanung ein und definiert den Gegenstand der Arbeit. Es wird hervorgehoben, dass praxisrelevante Projektplanungsprobleme die begrenzten Kapazitäten von Ressourcen berücksichtigen müssen. Die Arbeit beschreibt die Modellierung ausgewählter Probleme und stellt zwei Klassifizierungsschemata vor. Der Aufbau der Arbeit wird im Detail skizziert, wobei die einzelnen Kapitel und deren Inhalt kurz vorgestellt werden.
2 Grundlagen der Projektplanung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der ressourcenbeschränkten Projektplanung dar. Es werden zentrale Begriffe wie zeitliche Anordnungsbeziehungen zwischen Aktivitäten, planungsabhängige Zeitfenster und die verschiedenen Arten von Ressourcen (erneuerbar, nicht-erneuerbar) definiert und erklärt. Diese Grundlagen bilden die Basis für die anschließende Modellierung und Klassifizierung.
3 Modellierung: Kapitel 3 befasst sich mit der detaillierten Modellierung verschiedener Aspekte der ressourcenbeschränkten Projektplanung. Es beginnt mit dem Grundproblem und erweitert dieses schrittweise um die Berücksichtigung allgemeiner zeitlicher Anordnungsbeziehungen sowie variabler Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kalendrierung, die verschiedene Kalendertypen (Ressourcen-, Aktivitäten-, und Anordnungskalender) umfasst und in einem konzeptionellen Modell zusammengeführt wird. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung der komplexen Zusammenhänge.
4 Klassifikationen: In diesem Kapitel werden zwei etablierte Klassifizierungsschemata für Projektplanungsprobleme vorgestellt und analysiert: die Drei-Feld-Klassifikation nach Herroelen u.a. und die nach Brucker u.a. Für beide Schemata werden die Felder (Ressourcen, Aktivitäten, Zielfunktion) im Detail erläutert und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Betrachtung der Klassifikation nach Brucker u.a., wobei die Einführung der Parameter PS und MPS im a-Feld sowie die Beschreibung der Aktivitäten und die Formelschreibweise der Zielfunktion im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Ressourcenbeschränkte Projektplanung, Modellierung, Klassifikation, Zeitliche Anordnungsbeziehungen, Ressourcenkalender, Aktivitätenkalender, Anordnungskalender, Herroelen, Brucker, Erneuerbare Ressourcen, Nicht-erneuerbare Ressourcen, Zielfunktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Modellierung und Klassifizierung ressourcenbeschränkter Projektplanung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Modellierung und Klassifizierung von Problemen der ressourcenbeschränkten Projektplanung. Ziel ist es, ausgewählte grundlegende Probleme zu beschreiben und gängige Klassifizierungsschemata vorzustellen. Die Arbeit bietet einen Überblick über die Modellierung verschiedener Aspekte, einschließlich der Berücksichtigung zeitlicher Abhängigkeiten und variierender Ressourcenverfügbarkeit.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Modellierung ressourcenbeschränkter Projektplanung, Berücksichtigung zeitlicher Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten, variable Ressourcenverfügbarkeit, Klassifizierung von Projektplanungsproblemen und die Analyse verschiedener Klassifizierungsschemata (insbesondere die Drei-Feld-Klassifikationen nach Herroelen u.a. und Brucker u.a.).
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Projektplanung, Modellierung, Klassifikationen und Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Kapitel 3 beschreibt die Modellierung verschiedener Aspekte der ressourcenbeschränkten Projektplanung, einschließlich der Kalendrierung. Kapitel 4 stellt und analysiert zwei etablierte Klassifizierungsschemata vor. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die wichtigsten Grundlagen der Projektplanung, die in der Arbeit behandelt werden?
Die Grundlagen der Projektplanung umfassen zentrale Begriffe wie zeitliche Anordnungsbeziehungen zwischen Aktivitäten, planungsabhängige Zeitfenster und verschiedene Arten von Ressourcen (erneuerbar, nicht-erneuerbar). Diese Grundlagen bilden die Basis für die Modellierung und Klassifizierung.
Wie wird die Modellierung ressourcenbeschränkter Projektplanung in der Arbeit dargestellt?
Die Modellierung beginnt mit dem Grundproblem und erweitert dieses schrittweise um die Berücksichtigung allgemeiner zeitlicher Anordnungsbeziehungen sowie variabler Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Kalendrierung mit verschiedenen Kalendertypen (Ressourcen-, Aktivitäten- und Anordnungskalender), die in einem konzeptionellen Modell zusammengeführt werden.
Welche Klassifizierungsschemata werden vorgestellt und analysiert?
Die Arbeit stellt die Drei-Feld-Klassifikationen nach Herroelen u.a. und Brucker u.a. vor. Für beide Schemata werden die Felder (Ressourcen, Aktivitäten, Zielfunktion) detailliert erläutert und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Die Klassifikation nach Brucker u.a. wird kritisch betrachtet, wobei die Einführung der Parameter PS und MPS im a-Feld, die Beschreibung der Aktivitäten und die Formelschreibweise der Zielfunktion im Fokus stehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Ressourcenbeschränkte Projektplanung, Modellierung, Klassifikation, Zeitliche Anordnungsbeziehungen, Ressourcenkalender, Aktivitätenkalender, Anordnungskalender, Herroelen, Brucker, Erneuerbare Ressourcen, Nicht-erneuerbare Ressourcen, Zielfunktion.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist die Beschreibung ausgewählter grundlegender Probleme der ressourcenbeschränkten Projektplanung und die Vorstellung gängiger Klassifizierungsschemata. Es soll ein Überblick über die Modellierung verschiedener Aspekte gegeben werden.
- Citation du texte
- Sabina El Haoum (geb. Puk) (Auteur), 2004, Modelle und Klassifikationen der ressourcenbeschränkten Projektplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29829