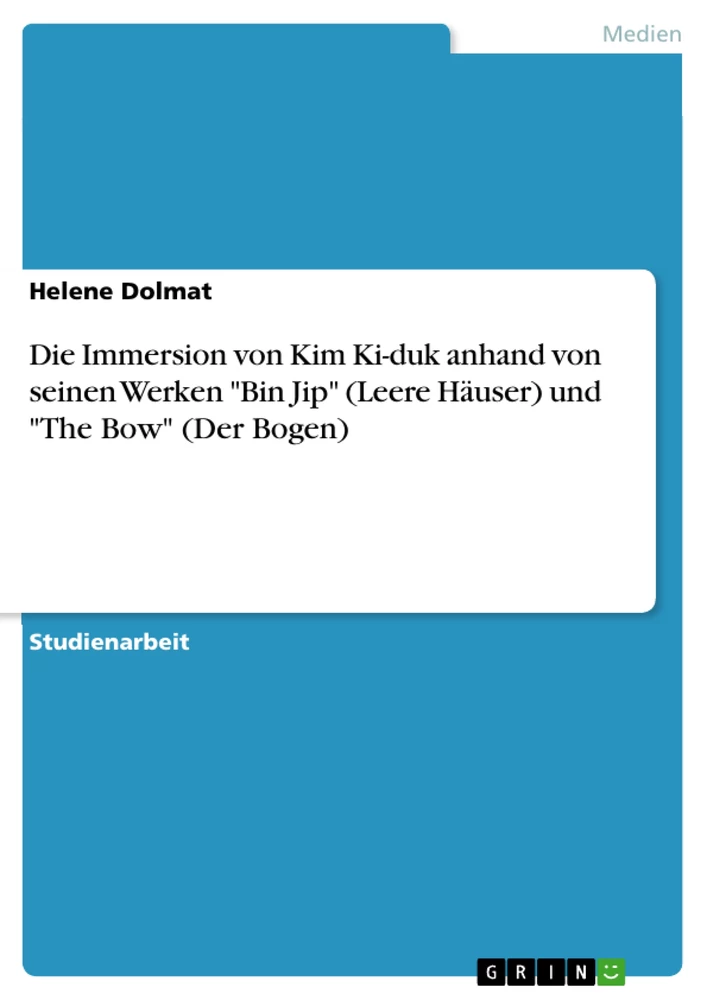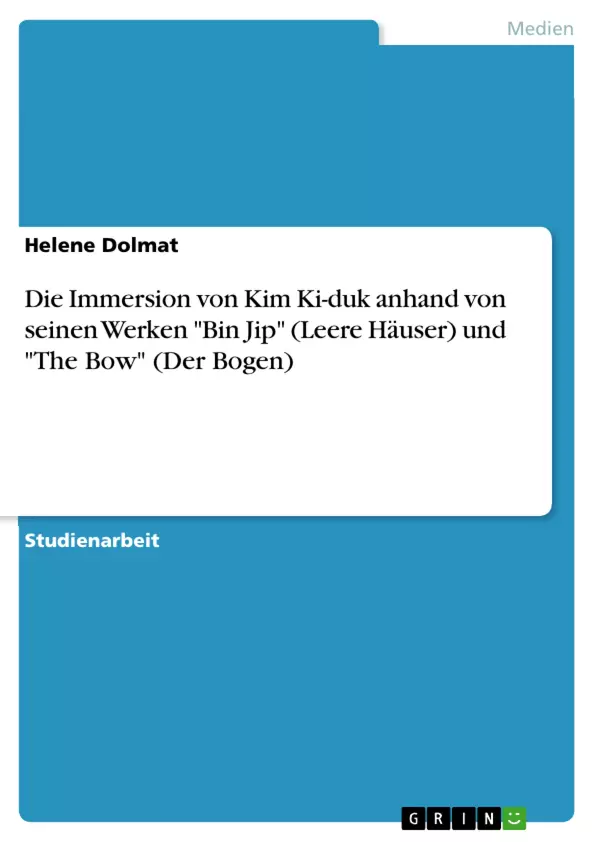Durch seine tiefgreifenden, mit Gewalt befüllten und trotzdem poetischen Filme ist Kim Ki-duk heute einer der umstrittensten Regisseure: Einige erklären ihn für psychisch gestört, die Anderen für einen Genie. Besonders in seiner Heimat, – in Süd-Korea, – wird Kim Ki-duk mit Steinen beworfen: „Wie kann man nur so schlechte Filme machen?“ fragt Mun Il- Pyeong. Eine weitere Aussage von demselben Kritiker lautet, „dass Kim Ki-duk die Norm der Well-Made-Filme hinter sich gelassen hat und die extreme Methode des Automatismus anwendet“ (Seong-Il 2013, S. 165) Ihm wird die „falsche Objektivität“ im Sinne der mit naturalistischer Handschrift dargestellten Begebenheiten und Personen, die keine vom Realismus fordernde organische Eigenschaft des Erzählens innehaben, und „Überschuss an Überschuss“ im Bezug auf seine Kameraeinstellungen von Park Seong-Su zugeschrieben (vgl. ebd. S. 302-310). Trotz aller negativen Kritiken, die auf nationale Vergemeinschaftung (s. Kapitel 2.2) Koreas zurückzuführen sind, wird Kim Ki-duk von der ästhetischer Vergemeinschaftung (ebd.) Europas als talentierter Regisseur sehr geschätzt. Mehrere seiner zahlreichen Filme liefen bei vielen bedeutenden Festivals Europas und sein Pieta gewann den Goldenen Löwen in Venedig in 2012.
Ziel dieser Arbeit ist, Verfolgung von Kim Ki-duks Immersionsmethoden unter Betrachtung von verschiedenen Allegorien der „schweigenden Performanz“ (Seong-Il 2013, S. 157) anhand seiner Filme "Bin Jip" (Leere Häuser) und "The Bow" (Der Bogen).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung der Immersion im Film- und Medienbereich
- Narration und Dramaturgie
- Gesellschaftliche Kontexte: Zugehörigkeit und „Wir-Gefühl“ bei der Medienrezeption
- Religiöse Vergemeinschaftung in Korea
- Kim Ki-duk und die Gemeinschaften
- Ästhetik und Gestaltung
- Moralische Orientierung des Zuschauers - Empathie und Sympathie
- Immersion
- Über Kim Ki-duk
- Bin Jip (Leere Häuser), 2004
- Handlung
- Ästhetik und Gestaltung
- Sozialgesellschaftliche Hintergründe
- Kernidee des Filmes und moralische Orientierungen des Zuschauers
- The Bow (Der Bogen), 2005, als sagenhafte Parabel
- Handlung
- Ästhetik und Gestaltung
- Genre und Problematik im Film
- Deutungen der Hintergründe und Symbolik im Film
- Wortlose Immersion
- Narration und Dramaturgie – Moralische Orientierungen des Zuschauers
- Halbabstraktion als filmische Handschrift von Kim Ki-duk
- Fazit: Immersion durch filmische Handschrift von Kim Ki-duk unter Berücksichtigung von stilistisch-künstlerischen und sozial-kulturellen Aspekten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Facharbeit befasst sich mit den Immersionsmethoden des südkoreanischen Filmregisseurs Kim Ki-duk, insbesondere anhand seiner Werke Bin Jip (Leere Häuser) und The Bow (Der Bogen). Ziel ist es, die einzigartige filmische Handschrift des Regisseurs zu analysieren, die durch die Verwendung von Gewalt, Poesie und „schweigender Performanz“ (Seong-Il 2013, S. 157) gekennzeichnet ist. Im Fokus stehen die Zusammenhänge zwischen Narration, Dramaturgie, Ästhetik und sozial-kulturellen Kontexten, die zur Entstehung der Immersion im Film beitragen.
- Die Rolle von Gewalt und Poesie in Kim Ki-duks Filmen
- Die Bedeutung von „schweigender Performanz“ und visueller Narration
- Die ästhetischen und gestalterischen Elemente, die zur Immersion beitragen
- Der Einfluss von sozial-kulturellen Kontexten auf die Rezeption der Filme
- Die moralische Orientierung des Zuschauers und die Frage der Empathie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Facharbeit ein und stellt Kim Ki-duk als umstrittenen, aber gleichzeitig hoch angesehenen Regisseur vor. Die Entstehung der Immersion im Film- und Medienbereich wird im zweiten Kapitel anhand von Narration, Dramaturgie und gesellschaftlichen Kontexten beleuchtet. Dabei wird auch der Einfluss von religiösen und ästhetischen Gemeinschaften auf die Medienrezeption betrachtet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Regisseur Kim Ki-duk selbst und beleuchtet seine künstlerische Entwicklung und seine ästhetischen Prinzipien. Die Kapitel 4 und 5 beschäftigen sich dann mit den Filmen Bin Jip (Leere Häuser) und The Bow (Der Bogen). In diesen Kapiteln werden die Handlung, die Ästhetik, die sozial-kulturellen Hintergründe und die moralischen Orientierungen des Zuschauers analysiert. Das sechste Kapitel widmet sich der „Halbabstraktion“ als filmische Handschrift von Kim Ki-duk. Schließlich fasst das Fazit die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet die Bedeutung der filmischen Handschrift von Kim Ki-duk für die Entstehung von Immersion.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit befasst sich mit den Themen Immersion, filmische Handschrift, Kim Ki-duk, „schweigende Performanz“, Narration, Dramaturgie, Ästhetik, Gewalt, Poesie, sozial-kulturelle Kontexte, Medienrezeption, Gemeinschaften, Empathie und moralische Orientierung. Die Analyse der Filme Bin Jip (Leere Häuser) und The Bow (Der Bogen) dient als Grundlage für die Untersuchung der Immersionsmethoden des Regisseurs.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Kim Ki-duk ein umstrittener Regisseur?
Seine Filme sind bekannt für eine extreme Mischung aus drastischer Gewalt und poetischer Bildsprache, was besonders in seiner Heimat Südkorea auf starke Ablehnung stieß.
Was versteht man unter "schweigender Performanz" in seinen Filmen?
In Werken wie "Bin Jip" sprechen die Hauptfiguren oft kaum oder gar nicht. Die Handlung und Emotionen werden rein visuell durch Gestik, Mimik und Bildkomposition vermittelt.
Wie erzeugt Kim Ki-duk Immersion beim Zuschauer?
Immersion entsteht durch die ästhetische Gestaltung, die symbolische Tiefe und die moralische Herausforderung des Zuschauers, der sich intensiv in die wortlose Welt der Figuren einfühlen muss.
Worum geht es in dem Film "Bin Jip" (Leere Häuser)?
Der Film handelt von einem jungen Mann, der in Häuser einbricht, wenn die Besitzer weg sind, dort aber nichts stiehlt, sondern dort lebt und Dinge repariert, bis er eine misshandelte Frau trifft.
Welchen Preis gewann Kim Ki-duk 2012?
Er gewann den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig für seinen Film "Pieta".
- Quote paper
- Helene Dolmat (Author), 2014, Die Immersion von Kim Ki-duk anhand von seinen Werken "Bin Jip" (Leere Häuser) und "The Bow" (Der Bogen), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298404