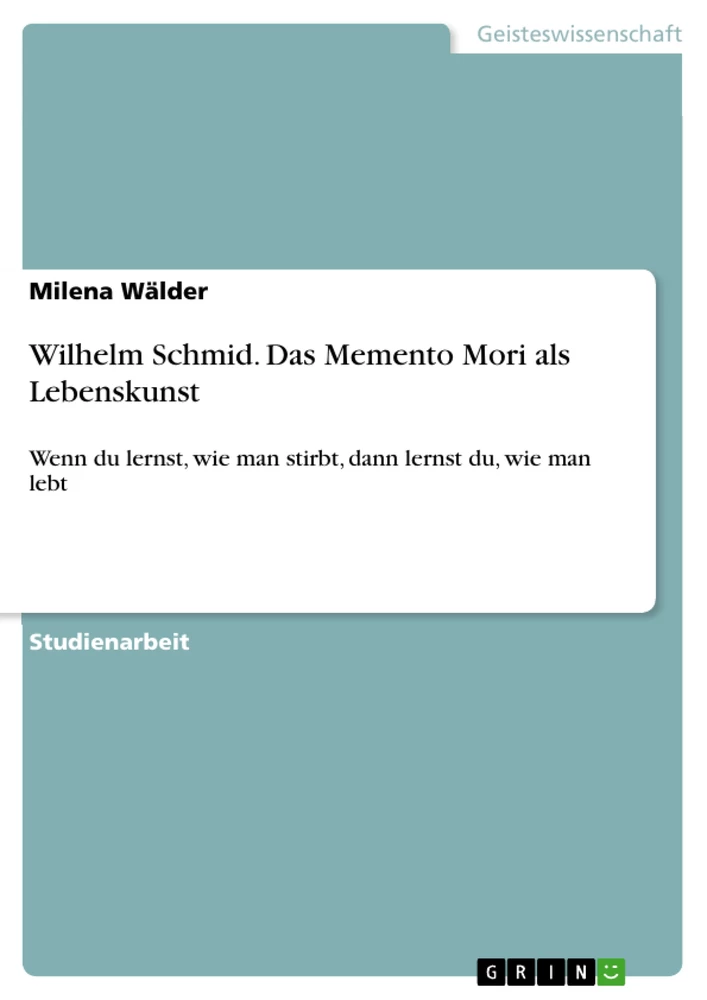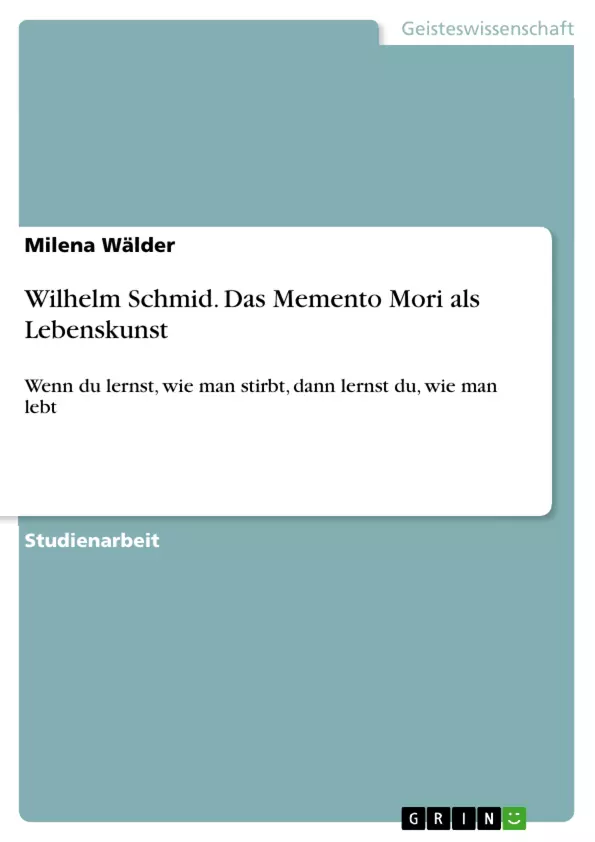Die meisten Menschen treibt die Angst vor dem Sterben um. Davor haben sie mehr Angst als vor dem Tod als Endgültigkeit. Der Tod gilt als größte und letzte Kränkung der Menschheit, er ist das Negativste am Leben. Eine ganz andere Sichtweise vertritt Wilhelm Schmid in seinem Buch „Philosophie der Lebenskunst“ in dem Kapitel „Äußerste Sorge: Vom Leben mit dem Tod“. Wir sollten lernen, den Tod nicht als unseren Todfeind zu betrachten, sagt Schmid: „Nur was irgendwann aufhört, ist auch schön und kostbar.“
In dieser Hausarbeit über „Das Memento Mori als Lebenskunst“, geht es darum herauszufinden, was der Tod in dem Leben eines Menschen bedeutet, warum ihm solch eine Macht zugeschrieben wird, welche nicht selten als überwältigende Angst wahrgenommen wird. Unterschiedliche Meinungen werden aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und interpretiert. Wie wird der Tod in anderen Kulturen verstanden? Es wird beschrieben, wie in der heutigen Hast der Zeit die Gesellschaft mit dem Tod lebt. Kritisch wird auf die Tatsache eingegangen, dass der Tod in unserer Gesellschaft entmenschlicht, zum Verwaltungsakt degradiert wird und einem somit nicht mehr die Möglichkeit bietet, aus ihm zu lernen. Konflikte über die Definition des Begriffs der Euthanasie sowie die Auseinandersetzung mit der Sterbehilfe werden angeschnitten.
Fragen über positive Erfahrungen mit dem Tod werden aufgeworfen. Was bedeutet es, mit jemandem mitzusterben, und welche Bedeutung kann eine solche Erfahrung für ein Leben haben? Und welche besondere Beziehung haben eigentlich alte Menschen zu Neugeborenen?
Die Hauptgrundlage für diese Arbeit bildet das Buch von Wilhelm Schmid „Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung“ (1998), darin das Kapitel: „Äußerste Sorge: Vom Leben mit dem Tod“. Veranschaulicht werden Schmids Beschreibungen durch Zitate aus der Sterbebiografie von Mitch Albom, „Dienstags bei Morrie“. Durch die lebensnahen, ungeschminkten Gespräche zwischen dem todkranken Professor Morrie Schwartz und seinem ehemaligen Studenten Mitch Albom wird das Thema des Todes in den Alltag geholt. Weiter verwendet wird der Text von Klaus Feldmann „Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Leben mit dem Tod.
- Die Verdrängung des Todes.
- Der Tod kommt an deine Grenze.
- Das Memento Mori als Lebenskunstführung.
- Die individuelle Freiheit angesichts des Todes..
- Zu lernen wie man stirbt um zu leben.
- Vom Mitsterben mit anderen......
- Das „gute Sterben“.
- Verfügbarkeit über den eigenen Tod..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Todes im Leben eines Menschen und untersucht, warum ihm eine so große Macht zugeschrieben wird, die oft als überwältigende Angst wahrgenommen wird. Sie analysiert verschiedene Perspektiven auf den Tod und beleuchtet, wie er in unterschiedlichen Kulturen verstanden wird. Die Arbeit beleuchtet kritisch, wie der Tod in der heutigen Gesellschaft entmenschlicht und zum Verwaltungsakt degradiert wird, wodurch die Möglichkeit, aus ihm zu lernen, verloren geht.
- Die Rolle des Todes in der Lebenskunst
- Die Verdrängung des Todes in der modernen Gesellschaft
- Der Einfluss der Zeitwahrnehmung auf die Beziehung zum Tod
- Das Verständnis des Todes in verschiedenen Kulturen
- Die Bedeutung des „guten Sterbens“ und die Auseinandersetzung mit Sterbehilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Das Memento Mori als Lebenskunst“ ein und stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung des Todes im Leben. Das Kapitel „Vom Leben mit dem Tod“ beleuchtet, wie die moderne Gesellschaft den Tod verdrängt und ihn als Störung des Fortschritts betrachtet. Im Kapitel „Die Verdrängung des Todes“ wird die Entmenschlichung des Todes und seine Degradierung zum Verwaltungsakt kritisiert. Das Kapitel „Der Tod kommt an deine Grenze“ beschäftigt sich mit der individuellen Konfrontation mit dem Tod und den damit verbundenen Erfahrungen.
Schlüsselwörter
Memento Mori, Lebenskunst, Tod, Verdrängung, Zeitwahrnehmung, Kultur, Sterbehilfe, Euthanasie, Mitsterben, „gutes Sterben“
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Memento Mori“ als Lebenskunst?
Es bedeutet, das Bewusstsein für die eigene Sterblichkeit zu nutzen, um das Leben bewusster, kostbarer und schöner zu gestalten.
Wie sieht Wilhelm Schmid den Tod?
Schmid plädiert dafür, den Tod nicht als Feind zu sehen, sondern als notwendige Grenze, die dem Leben erst seinen Wert verleiht.
Wird der Tod in unserer Gesellschaft verdrängt?
Ja, die Arbeit kritisiert, dass der Tod oft entmenschlicht und zum Verwaltungsakt degradiert wird, was die Auseinandersetzung mit ihm erschwert.
Was ist ein „gutes Sterben“?
Es beinhaltet die individuelle Freiheit angesichts des Todes und die Möglichkeit, den Sterbeprozess als Teil der Lebensführung zu begreifen.
Welche Rolle spielt das Buch „Dienstags bei Morrie“ in der Analyse?
Es dient als lebensnahes Beispiel für die Gespräche über das Sterben und holt das Thema durch die Biografie von Morrie Schwartz in den Alltag.
- Citation du texte
- Milena Wälder (Auteur), 2012, Wilhelm Schmid. Das Memento Mori als Lebenskunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298562