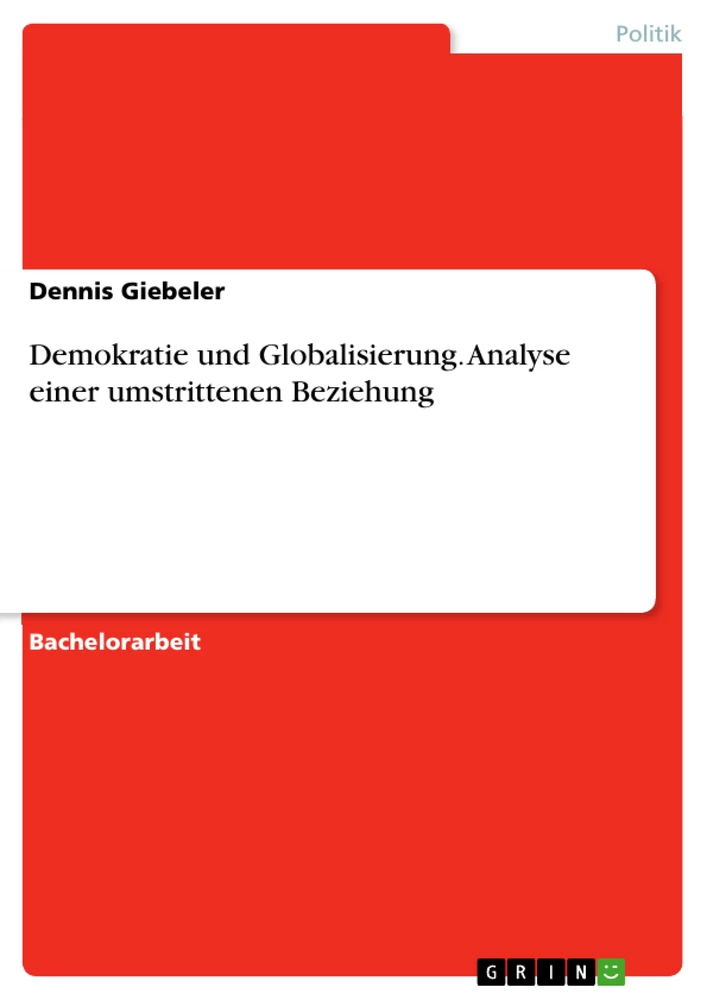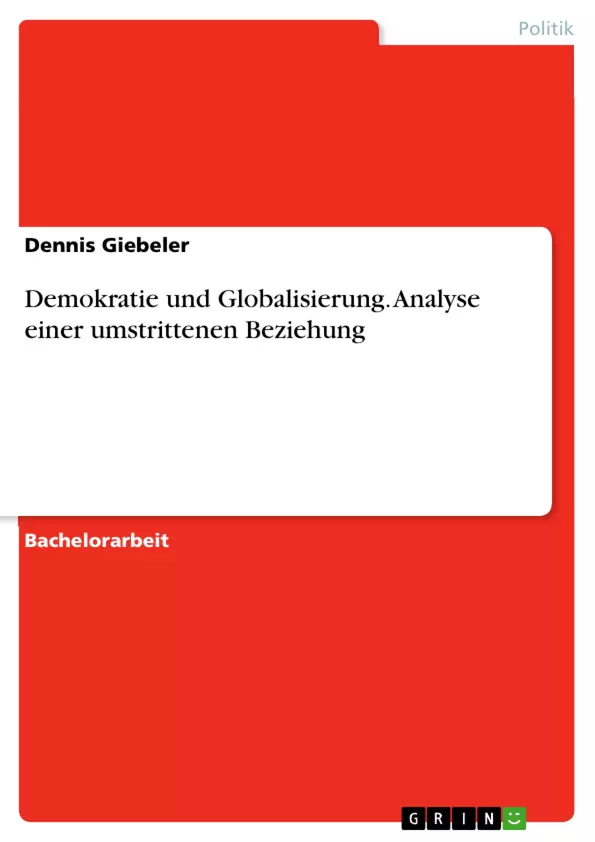Möchte man dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Fukuyama Glauben schenken, nahm die Geschichte 1989 ihr Ende. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung der verhärteten Fronten des Kalten Kriegs konnte sich schließlich ein politischer Systemtyp durchsetzen: Der Kampf zweier konkurrierender Staats- und Gesellschaftsentwürfe fiel deutlich zugunsten demokratischer Prinzipien aus. Sowohl der Faschismus Mitte des 20. Jahrhunderts als auch der Kommunismus erwiesen sich nach Fukuyama als nicht durchsetzungsfähig.
Die Entwicklung der darauffolgenden Jahre und Jahrzehnte schien Fukuyama Recht zu geben. Der Demokratie wird ein Siegeszug bescheinigt, der sich bereits bis zu einer „Dritten Welle“ der Demokratisierung ausgeweitet hat. Gestützt wird diese Entwicklung durch internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, durch Entwicklungsgelder, Nichtregierungsorganisationen (NROs), Medien und Nationalregierungen. In jüngster Zeit scheint die Demokratieentwicklung enger als je zuvor mit Globalisierungsprozessen verknüpft zu sein. Im Rahmen des Arabischen Frühlings entfalten grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation besonders deutlich ihre Wirkung. Die politischen Umbrüche hin zur Demokratie in vielen arabischen Staaten begrenzen sich längst nicht mehr auf den nationalstaatlichen Rahmen, sondern stehen in Interaktion mit Akteuren weltweit.
In starkem Kontrast hierzu stehen Befürchtungen um das Ende der Demokratie. Eine erodierende Steuerbasis, sinkende Wahlbeteiligung, die Ohnmacht politischer Entscheidungsträger angesichts der Komplexität und Unberechenbarkeit der Globalisierung oder die Macht transnationaler Unternehmen werden für eine Krise der Demokratie verantwortlich gemacht. Da sowohl Demokratie als auch Globalisierung von hoher Bedeutung für Gesellschaften und politische Akteure sind, stellt sich die Frage nach deren Beziehung.
Grundsätzliches Ziel dieser Arbeit ist es, den hier skizzierten Konflikt der widersprüchlichen Argumente hinsichtlich des Zusammenhangs von Globalisierung und Demokratie näher zu beleuchten. Dazu sollen in den Kapiteln zwei und drei die beiden höchst kontrovers diskutierten Begrifflichkeiten „Demokratie“ und „Globalisierung“ analysiert werden [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spezifikation des Demokratiebegriffs
- Definitionen des Demokratiebegriffs
- Grundlagen der Indexkonstruktion
- Motivation zur Indexkonstruktion
- Hürden der Indexkonstruktion
- Beispiele geläufiger Demokratieindizes
- Spezifikation des Globalisierungsbegriffs
- Definitionen des Globalisierungsbegriffs
- Operationalisierung des Globalisierungsbegriffs
- Die Beziehung zwischen Demokratie und Globalisierung
- Diskussion theoretischer Argumente
- Argumente eines positiven Zusammenhangs
- Argumente eines negativen Zusammenhangs
- Zwischenfazit
- Quantitativer Ansatz
- Diskussion theoretischer Argumente
- Ergebnisinterpretation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der komplexen Beziehung zwischen Demokratie und Globalisierung. Ziel ist es, die widersprüchlichen Argumente hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen beiden Phänomenen zu beleuchten und zu analysieren. Dabei werden die Begriffe „Demokratie“ und „Globalisierung“ in ihrer jeweiligen Komplexität und Diversität untersucht, um ein umfassendes Verständnis ihrer Interaktion zu gewinnen.
- Analyse der verschiedenen Definitionen und Operationalisierungen von Demokratie und Globalisierung
- Bewertung der theoretischen Argumente für einen positiven oder negativen Zusammenhang zwischen Demokratie und Globalisierung
- Anwendung quantitativer Methoden zur Überprüfung des Zusammenhangs zwischen beiden Phänomenen
- Interpretation der Ergebnisse und Analyse der unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen
- Entwicklung eines Fazits zur vorläufigen Klärung der Beziehung zwischen Globalisierung und Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Hintergrund und die Relevanz des Themas beleuchtet. In Kapitel 2 wird der Demokratiebegriff näher betrachtet, indem verschiedene Definitionen und die Herausforderungen der Indexkonstruktion diskutiert werden. Kapitel 3 widmet sich dem Globalisierungsbegriff und analysiert dessen unterschiedliche Definitionen und Operationalisierungen. In Kapitel 4 werden die theoretischen Argumente für einen positiven oder negativen Zusammenhang zwischen Demokratie und Globalisierung diskutiert. Darüber hinaus werden quantitative Studien zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen beiden Phänomenen vorgestellt. Kapitel 5 analysiert die Ergebnisse der quantitativen Studien und interpretiert die unterschiedlichen Untersuchungsbedingungen. Schließlich wird in Kapitel 6 ein Fazit gezogen, das die vorläufige Klärung der Beziehung zwischen Globalisierung und Demokratie zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Demokratie, Globalisierung, Indexkonstruktion, theoretische Argumente, quantitative Studien, und der Interaktion zwischen beiden Phänomenen. Sie analysiert die verschiedenen Ansätze zur Operationalisierung und Messung der beiden Konzepte und untersucht die unterschiedlichen Perspektiven auf die Beziehung zwischen Demokratie und Globalisierung. Zu den zentralen Themen gehören die Auswirkungen der Globalisierung auf demokratische Prozesse, die Rolle von internationalen Organisationen und die Herausforderungen der Demokratie im globalisierten Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Globalisierung und Demokratie?
Einige Theorien argumentieren, dass Globalisierung durch grenzüberschreitende Kommunikation (z.B. Arabischer Frühling) und internationalen Druck demokratische Prozesse fördert.
Führt Globalisierung zu einer Krise der Demokratie?
Kritiker befürchten eine Erosion der Steuerbasis, Ohnmacht nationaler Entscheider gegenüber transnationalen Unternehmen und sinkende Wahlbeteiligung als negative Folgen.
Was sind Demokratieindizes?
Demokratieindizes sind Instrumente zur Messung des Demokratiegrades eines Staates. Die Arbeit diskutiert die Hürden und die Motivation hinter ihrer Konstruktion.
Was besagt Fukuyamas These vom "Ende der Geschichte"?
Fukuyama behauptete 1989, dass sich nach dem Fall des Kommunismus die liberale Demokratie als endgültige Regierungsform weltweit durchgesetzt habe.
Wie wird Globalisierung in dieser Analyse operationalisiert?
Globalisierung wird nicht nur ökonomisch, sondern auch hinsichtlich Kommunikation, Kooperation und des Einflusses internationaler Organisationen definiert und messbar gemacht.
Welchen Beitrag leisten quantitative Studien zur Klärung der Beziehung?
Quantitative Ansätze versuchen, durch statistische Daten Korrelationen zwischen Globalisierungsprozessen und dem Demokratisierungsgrad von Staaten nachzuweisen.
- Citation du texte
- Dennis Giebeler (Auteur), 2015, Demokratie und Globalisierung. Analyse einer umstrittenen Beziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298568