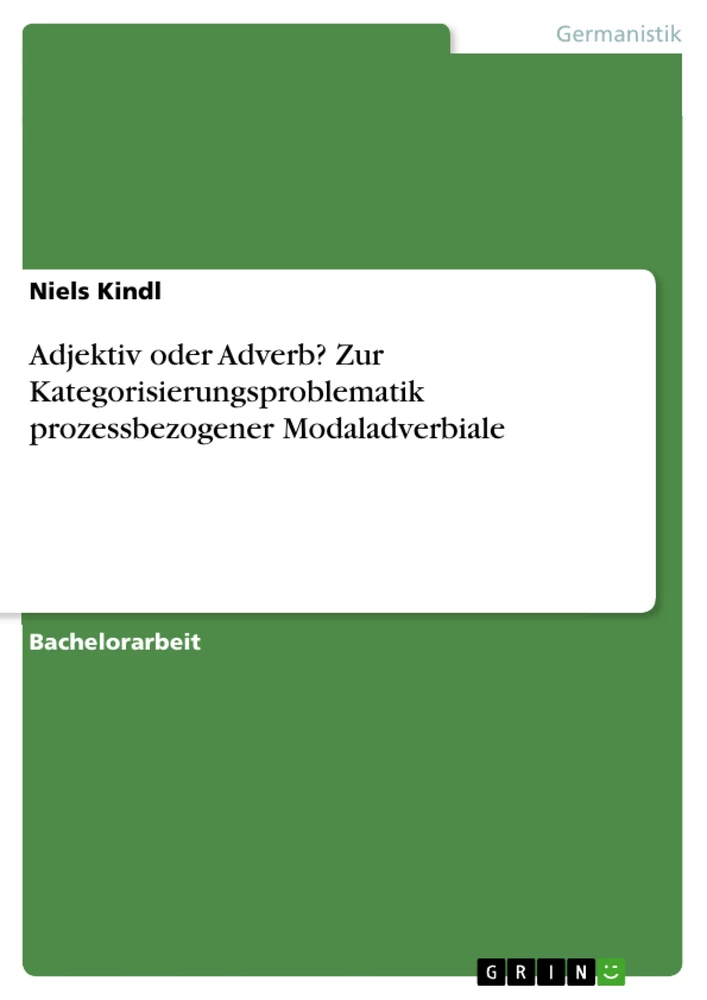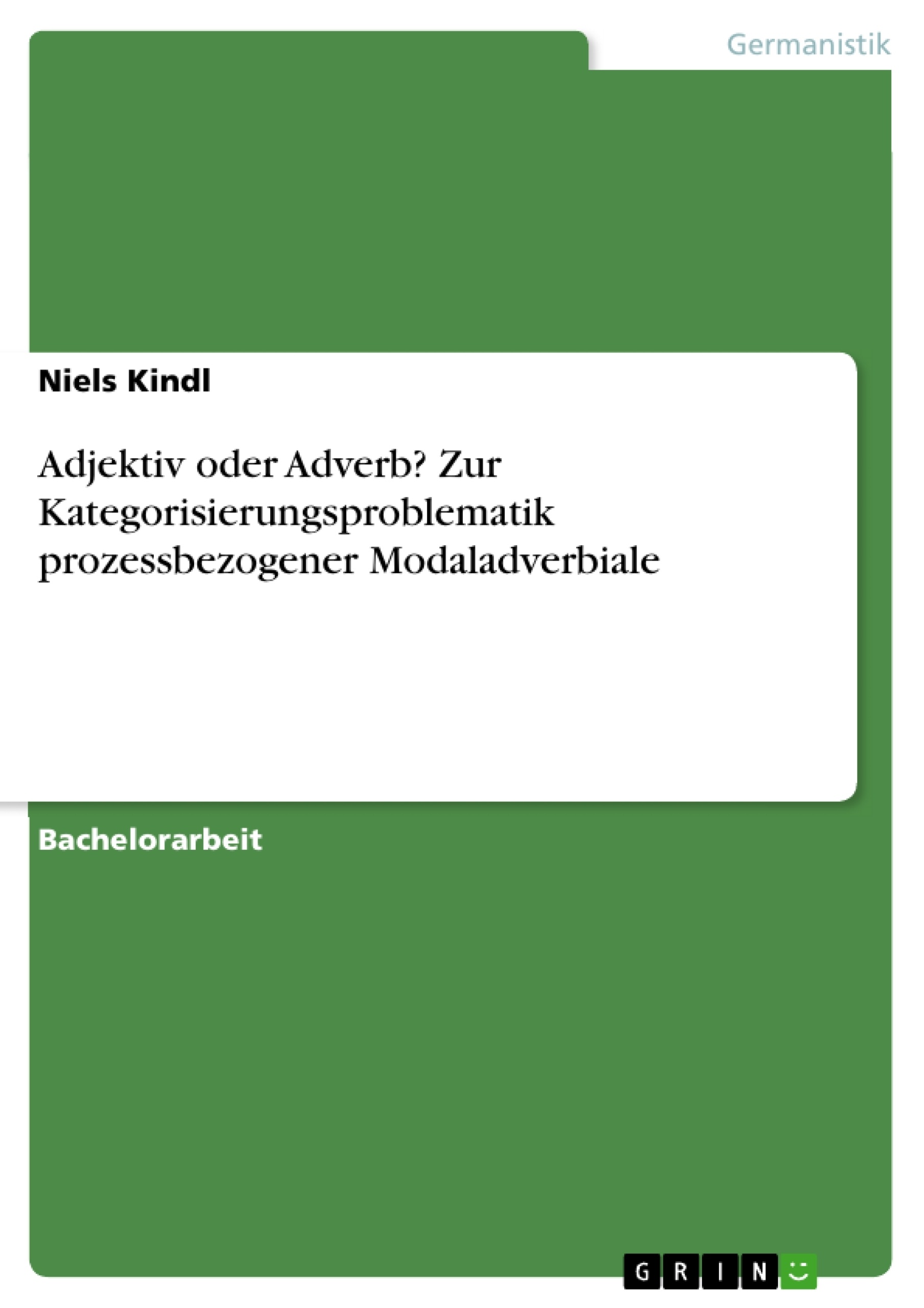In der vorliegenden Arbeit gehe ich der Frage "Adjektiv oder Adverb" bei der Kategorisierung prozessbezogener Modaladverbiale in Sätzen des Typs "Niels läuft schnell" nach und konzentriere mich hierbei besonders auf fünf ausgewählte Gebrauchsgrammatiken des Deutschen. Neben EISENBERGS (2004) Standardwerk "Grundriss der Deutschen Grammatik", der insbesondere für die Lehrerausbildung empfohlenen "Deutschen Grammatik" von GALLMANN und SITTA (2007) und der traditionellen "Deutschen Grammatik – Ein Handbuch für den Ausländerunterricht" von HELBIG und BUSCHA (2005) werde ich auch die vor allem an der Ruhr-Universität Bochum verwendeten Grammatiken von BOETTCHER (2009) und PITTNER / BERMAN (2008) in meine Analyse einbeziehen.
Hierzu zeige ich zunächst die unter den Grammatiken bestehende Terminologie-Problematik auf, die gerade aus didaktischer Sicht von Relevanz ist. Anschließend skizziere ich die historische Entwicklung der Adjektiv/Adverb-Problematik im Alt-, Mittel- und Neuhochdeutschen und gebe einen Überblick über Adverbendungen in anderen europäischen Sprachen. Darauf basierend demonstriere ich Vorschläge, wie die genannten einschlägigen Gebrauchsgrammatiken des heutigen Deutsch "schnell" aus dem Beispielsatz hinsichtlich seiner Wortart klassifizieren, um nachfolgend die bei den jeweiligen Kategorisierungs-„Strategien“ angewendeten fünf Klassifikationskriterien (I) "Flektierbarkeit", (II) "Komparierbarkeit", (III) "Distribution", (IV) "syntaktische Funktion" und (V) "Bedeutung im Satz" hinsichtlich ihrer Eignung in Bezug auf die Fragestellung "Adjektiv oder Adverb" zu evaluieren und kritisch miteinander zu vergleichen.
Daran anknüpfend werde ich den Begriff der ‚Wortart‘ definieren, ausgehend von dieser Definition für eine homogene Wortarteneinteilung plädieren und einen eigenen syntaktisch-motivierten Lösungsansatz vorstellen, der den Distributionsgedanken von HELBIG / BUSCHA (2005) aufgreift und "schnell" als Adverb klassifiziert. Bei dieser Klassifikation orientiere ich mich insbesondere an der strukturalistischen Ausrichtung DE SAUSSURES (2001: 132ff) bezüglich des Wertes sprachlicher Zeichen (valeur) und an der Distributionsanalyse des Amerikanischen Strukturalismus (vgl. HARRIS 1951, 1962). Des Weiteren adaptiere ich BORERS (2005a, 2005b) Konzept einer exo-skeletalen Syntax und argumentiere dafür, dass Wortarten kein Bestandteil des mentalen Lexikons sind, sondern erst durch die syntaktische Struktur des Satzes induziert werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Das Kind beim rechten Namen nennen
- 2.1 Adverbiale Adjektive
- 2.2 Adjektivadverb
- 2.3 Das terminologische Adjektiv-Adverb-Kontinuum
- 3 Historische Entwicklung der Adjektiv/Adverb-Problematik
- 3.1 Althochdeutsch
- 3.2 Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch
- 4 Adverbendungen in anderen europäischen Sprachen
- 5 Die Verortung im Adjektiv-Adverb-Kontinuum: Argumentationsgänge in Grammatiken des Deutschen
- 5.1 Grammatik verstehen - Wort (BOETTCHER)
- 5.2 Deutsche Syntax (PITTNER / BERMAN)
- 5.3 Deutsche Grammatik (GALLMANN / SITTA)
- 5.4 Grundriss der deutschen Grammatik (EISENBERG)
- 5.5 Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht (HELBIG / BUSCHA)
- 6 Ein kritischer Vergleich zwischen den Wortarteneinteilungen zugrundeliegenden Kriterien
- 6.1 Das morphologische Kriterium der Flektierbarkeit
- 6.2 Das morphologische Kriterium der Komparierbarkeit
- 6.3 Das syntaktische Kriterium der Distribution
- 6.4 Das syntaktische Kriterium der Funktion im Satz
- 6.5 Das semantische Kriterium der Bedeutung im Satz
- 7 Adjektiv oder Adverb? Eine syntaktisch motivierte Antwort!
- 7.1 Wie grammatisch sind Wörter?
- 7.2 Wortarten: strukturelle Kategorien - syntaktisch gesteuert
- 8 Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie prozessbezogene Modaladverbiale, wie "schnell" in dem Satz "Niels läuft schnell", in der deutschen Grammatik kategorisiert werden. Sie analysiert, wie verschiedene Grammatiken des Deutschen mit dieser Frage umgehen und welche Kriterien sie dafür verwenden.
- Die Problematik der Terminologie bei der Unterscheidung von Adjektiven und Adverbien
- Die historische Entwicklung der Adjektiv/Adverb-Problematik im Deutschen
- Die Kategorisierung von Adjektiven und Adverbien in verschiedenen Grammatiken des Deutschen
- Die Evaluierung und der Vergleich der verschiedenen Kriterien, die zur Unterscheidung von Adjektiven und Adverbien herangezogen werden
- Der Vorschlag eines syntaktisch motivierten Lösungsansatzes für die Kategorisierung von prozessbezogenen Modaladverbialen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problematik der Kategorisierung von prozessbezogenen Modaladverbialen in der deutschen Grammatik vor und führt die zentralen Fragestellungen der Arbeit aus. Kapitel 2 beleuchtet die terminologische Problematik und erläutert das terminologische Adjektiv-Adverb-Kontinuum. Kapitel 3 zeichnet die historische Entwicklung der Adjektiv/Adverb-Problematik im Alt-, Mittel- und Neuhochdeutschen nach. Kapitel 4 bietet einen Einblick in die Adverbendungen in anderen europäischen Sprachen. Kapitel 5 analysiert verschiedene Grammatiken des Deutschen, wie sie die Verortung von prozessbezogenen Modaladverbialen im Adjektiv-Adverb-Kontinuum beschreiben.
Kapitel 6 unterzieht die Kriterien, die in Grammatiken zur Unterscheidung von Adjektiven und Adverbien verwendet werden, einer kritischen Analyse. Kapitel 7 stellt einen eigenen, syntaktisch motivierten Lösungsansatz vor, der auf der Grundlage der Distributionsanalyse des Amerikanischen Strukturalismus argumentiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Adjektiv, Adverb, prozessbezogenes Modaladverbial, Wortarten, Kategorisierung, Grammatik, Deutsch, Sprachwissenschaft, Strukturalismus, Distributionsanalyse, Syntax, Semantik, Morphologie.
- Citar trabajo
- Niels Kindl (Autor), 2010, Adjektiv oder Adverb? Zur Kategorisierungsproblematik prozessbezogener Modaladverbiale, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298682