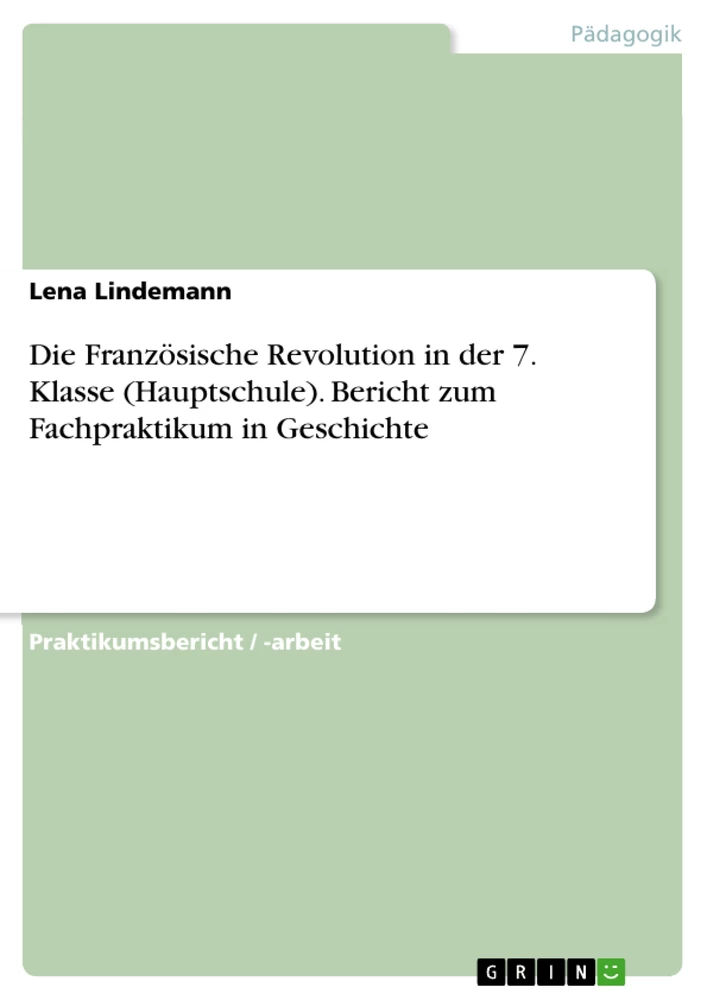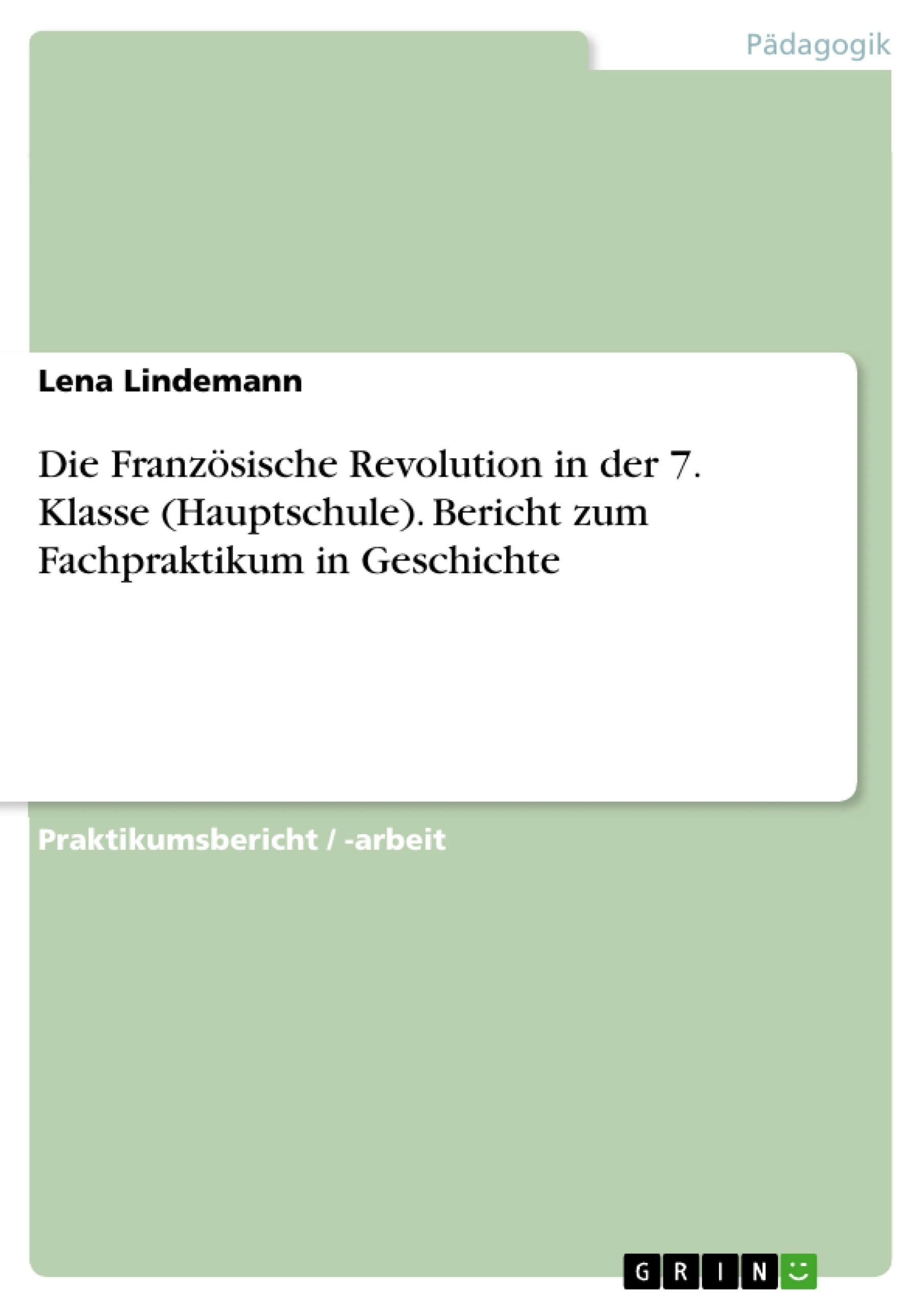In meinem sechswöchigen Fachpraktikum habe ich in zwei 7. Hauptschulklassen die Unterrichtseinheit „Französische Revolution“ unterrichtet.
Die Französische Revolution ist in der Sekundarstufe I nach den curricularen Vorgaben für Niedersachsen in der Jahrgangsstufe 7/8 vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen dieser Unterrichtseinheit erkennen, dass als Folge von Unterdrückung durch ein absolutistisches System, die Menschen nach politischer Teilhabe auf der Basis von Gewaltenteilung und Menschenrechten streben. Darüber hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler die Einsicht gewinnen, dass ungerechte Lebensverhältnisse unterschiedliche Formen von Gewalt hervorrufen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung der Menschenrechtserklärung in der Französischen Revolution vom 26. August 1789 in der Unterrichtseinheit „Die Französische Revolution“
- Sachanalyse
- Tabellarischer Unterrichtsverlauf für den 21.02.2012
- Reflexion der Unterrichtsstunde am 21.02.2012
- Die Hinrichtung König Ludwigs XVI. – Der Wandel von der konstitutionellen Monarchie zur Republik in der Unterrichtseinheit: „Die Französische Revolution“
- Sachanalyse
- Tabellarischer Unterrichtsverlauf für den 13.03.2012
- Reflexion der Unterrichtsstunde am 13.0302012
- ,,Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder“ – Die Zeit der Schreckensherrschaft unter den Jakobinern in der Unterrichtseinheit: „Die Französische Revolution“
- Sachanalyse
- Tabellarische Unterrichtsverlauf für den 06.03.2012
- Reflexion der Unterrichtsstunde am 06.03.2012
- Beobachtung zum Thema: „Das Krisenjahr 1923“- Didaktische Reduktion im Geschichtsunterricht
- Sachanalyse: Die Weimarer Republik - Das Krisenjahr 1923
- „Das Krisenjahr 1923“: Umsetzung der Thematik im Geschichtsunterricht
- „Das Krisenjahr 1923“: Didaktische Analyse
- Bewertung: Die didaktische Reduktion
- Auswertung des Fachpraktikums
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Fachpraktikum befasst sich mit der Vermittlung der Französischen Revolution im Geschichtsunterricht der Hauptschule. Es werden zwei Unterrichtseinheiten im Detail analysiert und reflektiert. Die Zielsetzung des Praktikums liegt darin, die didaktischen Herausforderungen bei der Vermittlung komplexer historischer Prozesse im Kontext der Hauptschule zu untersuchen.
- Die Bedeutung der Menschenrechtserklärung in der Französischen Revolution
- Die Hinrichtung König Ludwigs XVI. und der Wandel zur Republik
- Die Schreckensherrschaft der Jakobiner
- Die didaktische Reduktion im Geschichtsunterricht am Beispiel des Krisenjahres 1923
- Die Analyse von Unterrichtsmethoden und -materialien im Kontext der Hauptschule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Fachpraktikum und die Schule vor, an der es durchgeführt wurde. Die folgenden Kapitel analysieren und reflektieren jeweils eine Unterrichtseinheit zur Französischen Revolution. Die Kapitel befassen sich mit der Bedeutung der Menschenrechtserklärung, der Hinrichtung König Ludwigs XVI. und der Schreckensherrschaft der Jakobiner. Das letzte Kapitel befasst sich mit der didaktischen Reduktion im Geschichtsunterricht am Beispiel des Krisenjahres 1923.
Schlüsselwörter
Französische Revolution, Menschenrechte, Unterrichtseinheit, Didaktik, Hauptschule, Schreckensherrschaft, Jakobiner, Krisenjahr 1923, Weimarer Republik, didaktische Reduktion.
Häufig gestellte Fragen
Für welche Zielgruppe wurde die Unterrichtseinheit zur Französischen Revolution konzipiert?
Die Einheit wurde für zwei 7. Klassen einer Hauptschule im Rahmen eines Fachpraktikums in Niedersachsen entwickelt.
Welche Schwerpunkte werden im Geschichtsunterricht zur Revolution gesetzt?
Zentrale Themen sind die Menschenrechtserklärung von 1789, die Hinrichtung König Ludwigs XVI. und die Schreckensherrschaft der Jakobiner.
Was bedeutet „didaktische Reduktion“ in diesem Kontext?
Es ist die Vereinfachung komplexer historischer Sachverhalte, wie am Beispiel des Krisenjahres 1923 gezeigt, um sie für Hauptschüler verständlich aufzubereiten.
Welches Lernziel verfolgt die Einheit bezüglich der Menschenrechte?
Schüler sollen erkennen, dass Menschen nach politischer Teilhabe und Gewaltenteilung streben, wenn sie durch absolutistische Systeme unterdrückt werden.
Was wird unter dem Satz „Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder“ behandelt?
Dieses Thema widmet sich der Zeit der Schreckensherrschaft unter den Jakobinern und den damit verbundenen Gewaltformen.
- Arbeit zitieren
- Lena Lindemann (Autor:in), 2012, Die Französische Revolution in der 7. Klasse (Hauptschule). Bericht zum Fachpraktikum in Geschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298780