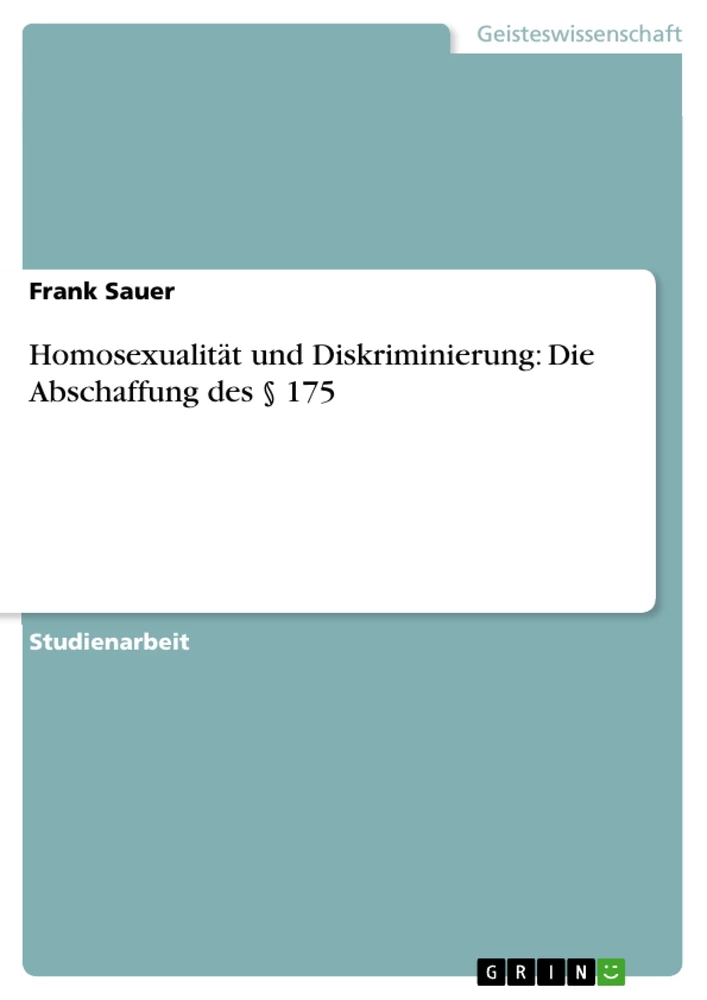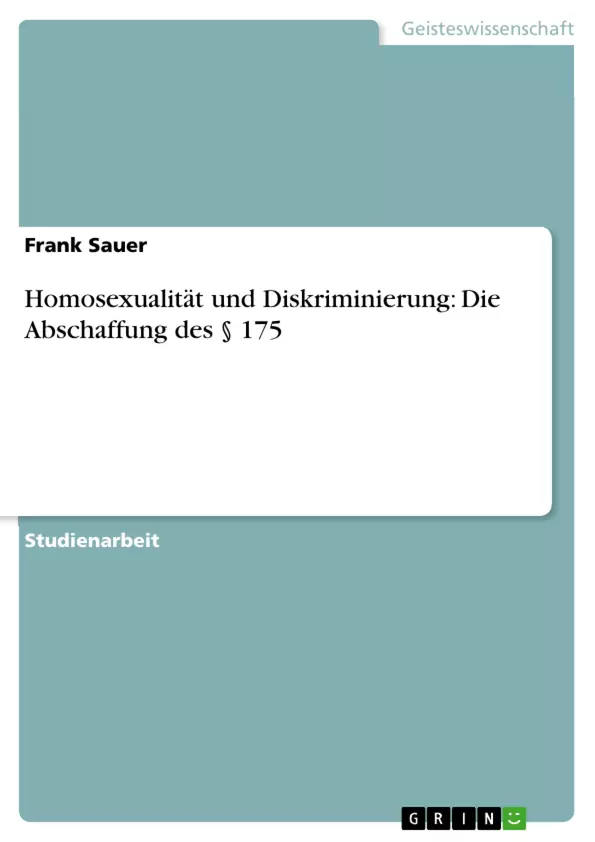Für die meisten homosexuellen Männer und Frauen in der Vergangenheit und in der Gegenwart war und ist ihre sexuelle Orientierung eine das ganze Leben beeinflussende Tatsache. Kein Mensch sucht sich seine sexuelle Orientierung aus. Dies gilt natürlich auch für Heterosexuelle und Bisexuelle. Sexualität gehört zum Menschen. Sie beeinflußt sein ganzes Leben. Die Wahl, die ein Mensch aber trotzdem hat, ist die Wahl einer Lebensweise, die bestimmten Rollenerwartungen entspricht, aber seiner eigenen Orientierung widerspricht, oder einer Lebensweise, die bestimmten Rollenerwartungen widerspricht, aber dafür seiner eigenen Orientierung entspricht. Sollte beides übereinstimmen, ist dies umso besser. Dies dürfte aber in den wenigsten Fällen zutreffen. Sexualität ist in unserer Gesellschaft also mit bestimmten Rollenerwartungen verbunden. Traditionell geht es um Männerrollen und Frauenrollen. Das Abweichen von den traditionellen Rollenerwartungen und Normen wurde und wird teilweise immer noch mit den entsprechenden negativen Sanktionen bedacht. Homosexuelle entsprechen jenen Erwartungen scheinbar nicht. D. h. , sie können das traditionelle Muster von Männerollen und Frauenrollen scheinbar nicht übernehmen, was bedeutet, sich immer gegen vorgegebene Muster abgrenzen zu müssen. Versucht man traditionelle Rollenerwartungen auf homosexuelle Männer und Frauen zu übertragen entstehen Vorurteile wie "homosexuelle Männer sind weibisch", "homosexuelle Frauen benehmen sich übertrieben männlich" usw. Betrachtet man jedoch die Entwicklung in den letzten 200 Jahren, so läßt sich eine Veränderung erkennen. Gerade am § 175 wird dies deutlich. Wurde Homosexualität im 19. Jhd noch gerichtlich verfolgt, so ist sie heute in den Bundesrepublick Deutschland straffrei. D. h. Homosexualität wird nicht mehr gesetzlich sanktioniert, obwohl sie gesellschaftlich noch in vielen Bereichen geächtet ist. Normen haben sich also geändert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Überblick über den "Tatbestand" der Homosexualität in Deutschland
- Wilhelminisches Zeitalter und Weimarer Republik
- NS-Zeit
- Von der Adenauer Ära bis ins wiedervereinigte Deutschland
- Politische Argumentation der Parteien zum 4. StrRG
- Erklärungsversuche und Theorien
- Erklärungsansatz für die Entkriminalisierung der Homosexualität nach der materialistisch-interaktionistischen Kriminologie von Gerlinda Smaus
- Abolitionismus
- Das Eingreifen des Staates in den Bereich der Sexualität
- Schlußwort und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Abschaffung des § 175 und die damit verbundene Veränderung der Sexualnormen im deutschen Strafrecht. Sie beleuchtet den historischen Kontext der staatlichen Kontrolle und Diskriminierung von Homosexualität und analysiert verschiedene Erklärungsansätze für die Entkriminalisierung. Die Leitfrage der Arbeit ist das Interesse des Staates an der Sexualität seiner Bürger und die Rechtfertigung staatlicher Eingriffe in diesen Bereich.
- Historische Entwicklung des § 175 und der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Homosexualität
- Analyse der staatlichen Kontrolle und Diskriminierung von Homosexualität im 19. und 20. Jahrhundert
- Untersuchung verschiedener soziologischer und kriminologischer Erklärungsansätze für die Entkriminalisierung
- Die Rolle politischer Argumentationen in der Debatte um den § 175
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Rollenerwartungen auf die Behandlung von Homosexualität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die lebenslange Bedeutung sexueller Orientierung für Betroffene. Sie verweist auf die Diskrepanz zwischen der gesetzlichen Entkriminalisierung und der gesellschaftlichen Ächtung von Homosexualität und kündigt die Analyse der Entwicklung des § 175 als zentralen Gegenstand der Arbeit an. Der Fokus liegt auf der Frage nach dem staatlichen Interesse an der Regulierung von Sexualität und der damit verbundenen gesellschaftlichen Normen und Rollenerwartungen.
2. Geschichtlicher Überblick über den "Tatbestand" der Homosexualität in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen chronologischen Überblick über die rechtliche Behandlung von Homosexualität in Deutschland, beginnend mit dem wilhelminischen Zeitalter und der Weimarer Republik, über die NS-Zeit bis hin zur Bundesrepublik. Es analysiert die unterschiedlichen Ausprägungen des § 175 in diesen Epochen und die damit verbundenen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Entwicklung zeigt deutlich den Wandel in der gesellschaftlichen und rechtlichen Bewertung von Homosexualität auf.
3. Erklärungsversuche und Theorien: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Erklärungsansätzen für die Entkriminalisierung der Homosexualität. Es präsentiert den materialistisch-interaktionistischen Ansatz von Gerlinda Smaus, den Abolitionismus, und untersucht das generelle Eingreifen des Staates in den Bereich der Sexualität. Es werden unterschiedliche Perspektiven auf die Veränderungen der Sexualnormen im Strafrecht diskutiert und analysiert, um ein umfassenderes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf den theoretischen Grundlagen und deren Anwendung auf den konkreten Fall des § 175.
Schlüsselwörter
Homosexualität, § 175, Diskriminierung, Entkriminalisierung, Sexualnormen, Strafrecht, gesellschaftliche Normen, Rollenerwartungen, materialistisch-interaktionistische Kriminologie, Abolitionismus, staatliche Regulierung von Sexualität.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Entkriminalisierung der Homosexualität in Deutschland – Eine Analyse des § 175"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Abschaffung des § 175 StGB und die damit einhergehende Veränderung der Sexualnormen im deutschen Strafrecht. Im Mittelpunkt steht die Analyse der historischen Entwicklung, die staatliche Kontrolle und Diskriminierung von Homosexualität sowie verschiedene Erklärungsansätze für die Entkriminalisierung.
Welche historischen Phasen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die rechtliche Behandlung von Homosexualität in Deutschland von der wilhelminischen Ära und der Weimarer Republik über die NS-Zeit bis in die Bundesrepublik. Dabei wird der Wandel des § 175 und die gesellschaftlichen Veränderungen in den verschiedenen Epochen analysiert.
Welche Theorien und Erklärungsansätze werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene soziologische und kriminologische Erklärungsansätze für die Entkriminalisierung der Homosexualität. Im Fokus stehen der materialistisch-interaktionistische Ansatz von Gerlinda Smaus, der Abolitionismus und die allgemeine Frage nach dem staatlichen Eingreifen in den Bereich der Sexualität.
Welche Rolle spielt die politische Argumentation?
Die Arbeit analysiert die politischen Argumentationen der Parteien im Zusammenhang mit dem 4. StrRG (4. Strafrechtsreformgesetz) und deren Einfluss auf die Entkriminalisierung der Homosexualität.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die Leitfrage der Arbeit lautet: Welches Interesse hat der Staat an der Sexualität seiner Bürger und wie rechtfertigt sich das staatliche Eingreifen in diesen Bereich?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Überblick über den § 175, ein Kapitel zu Erklärungsansätzen und Theorien sowie ein Schluss-/Fazitkapitel. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Homosexualität, § 175, Diskriminierung, Entkriminalisierung, Sexualnormen, Strafrecht, gesellschaftliche Normen, Rollenerwartungen, materialistisch-interaktionistische Kriminologie, Abolitionismus, staatliche Regulierung von Sexualität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick und enthält neben dem Inhaltsverzeichnis auch eine detaillierte Zielsetzung und Beschreibung der Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste der wichtigsten Schlüsselwörter.
- Citation du texte
- M. A. Frank Sauer (Auteur), 1997, Homosexualität und Diskriminierung: Die Abschaffung des § 175, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2987