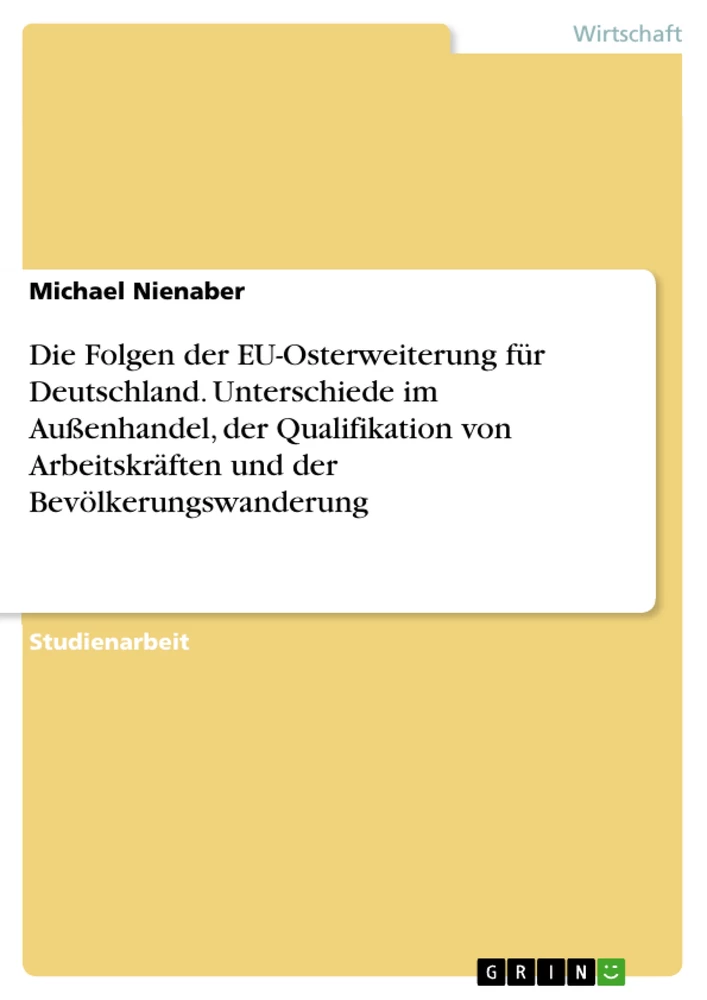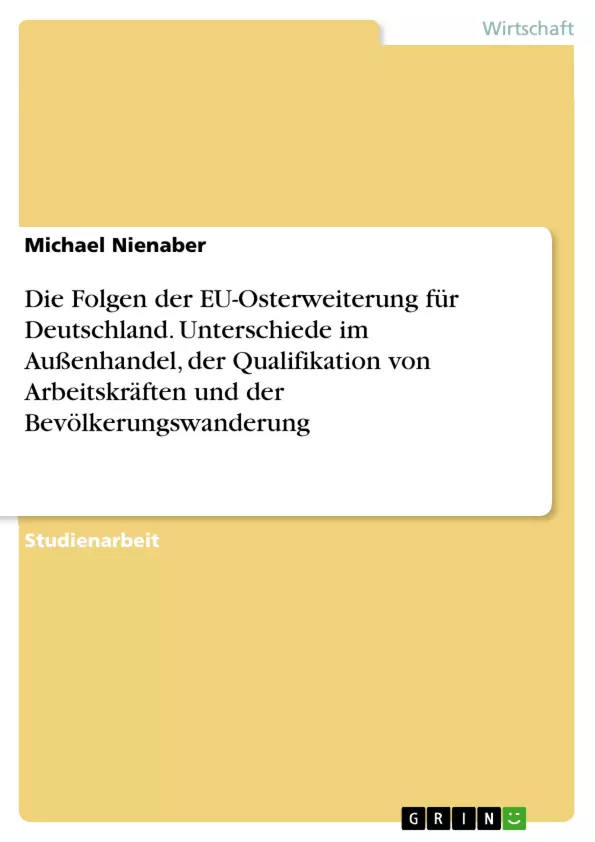Als sich am 1. Mai dieses Jahres die Europäische Union (EU) um zehn neue
Mitgliedsstaaten aus Mittel- und Osteuropa erweiterte, feierten Millionen Europäer die
Überwindung jahrzehntelanger ideologischer Spaltung und die wiedergewonnene Einheit
des aufgrund zweier Weltkriege einst am Boden liegenden Kontinents. Mit dem Beitritt
der neuen Mitgliedsländer Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien,
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern und Malta festigt die EU ihre Position als eine
der stärksten Wirtschaftsmächte der Erde. Mit den 75 Millionen neu hinzugekommenen
Bürgern leben innerhalb der EU fortan 455 Millionen Menschen.
Neben den wirtschaftlichen wie politischen Hoffnungen verbinden sich mit der
EU-Osterweiterung aber auch erhebliche Befürchtungen. Was im großen Rahmen für
die Globalisierung gilt, scheint sich im kleinen auch für die europäische Integration zu
bewahrheiten: Bei beiden Prozessen wird es am Ende Gewinner und Verlierer geben.
Für deutsche Unternehmer und Konzerne versprechen die durch die Osterweiterung
gewonnenen Absatzmärkte zwar glänzende Wachstums- und Gewinnaussichten. Bei
inländischen Arbeitskräften löst die Erweiterung jedoch Angst vor sinkenden Löhnen
und steigender Arbeitslosigkeit aus. Und tatsächlich kann es angesichts der anhaltend
hohen Unterbeschäftigung in Deutschland – wie auch in anderen EU-Ländern – nicht
überraschen, dass nach negativen Konsequenzen der EU-Osterweiterung gefragt wird.
Die vorliegende Seminararbeit unternimmt im Rahmen der Übung
„Wirtschaftspolitik und Strukturwandel“ eine empirische Bestandsaufnahme und
überprüft in diesem Zusammenhang die Folgerungen nach der EU-Osterweiterung für
Deutschland in drei relevanten Aspekten: die Unterschiede im Außenhandel, in der
Qualifikation der Arbeitskräfte sowie in der zu erwartenden Bevölkerungswanderung.
Hierfür soll zunächst kurz auf die grundlegenden, volkswirtschaftlichen Theorien zum
Außenhandel von Ricardo, Heckscher-Ohlin und Leontief eingegangen werden, damit
anschließend die inhärente Logik und die entscheidenden Rahmenbedingungen der EUOsterweiterung
erläutert werden können. Nach der einleitenden Theorien- und
Merkmalsklärung sollen im Hauptteil der vorliegenden Arbeit anhand einer empirischen
Bestandsaufnahme die Konsequenzen der EU-Osterweiterung für Deutschland in den
drei geschilderten Bereichen kurz und prägnant aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Logik und Rahmenbedingungen der EU-Osterweiterung
- Empirische Bestandaufnahme und Folgerungen
- Unterschiede im Außenhandel
- Unterschiede in der Qualifikation der Arbeitskräfte
- Unterschiede in der Bevölkerungsmigration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf Deutschland, insbesondere in Bezug auf den Außenhandel, die Qualifikation der Arbeitskräfte und die Bevölkerungswanderung. Sie untersucht empirisch die Unterschiede in diesen Bereichen und leitet daraus Folgerungen für Deutschland ab. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis für die wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen der EU-Osterweiterung für Deutschland schaffen.
- Analyse der Unterschiede im Außenhandel zwischen Deutschland und den neuen EU-Mitgliedstaaten
- Bewertung der Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die Qualifikation der Arbeitskräfte in Deutschland
- Untersuchung der potenziellen Migration von Arbeitskräften aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland
- Bewertung der Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf die deutsche Wirtschaft
- Diskussion der politischen und sozialen Herausforderungen der EU-Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der EU-Osterweiterung ein und erläutert die Bedeutung der Erweiterung für die europäische Integration. Sie stellt die wirtschaftlichen Hoffnungen und Befürchtungen dar, die mit der Erweiterung verbunden sind. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf Deutschland in den Bereichen Außenhandel, Qualifikation der Arbeitskräfte und Bevölkerungswanderung.
Logik und Rahmenbedingungen der EU-Osterweiterung
Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen der EU-Osterweiterung, die sich auf die Annahme von Wohlstandgewinnen durch Spezialisierung, Arbeitsteilung und Freihandel im Rahmen internationaler Wertschöpfungsketten stützt. Die Arbeit beleuchtet die Theorie der komparativen Kosten von David Ricardo sowie das Heckscher-Ohlin-Theorem und das Leontief-Paradox.
Empirische Bestandaufnahme und Folgerungen
Dieses Kapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der Analyse und die daraus resultierenden Folgerungen für Deutschland. Es untersucht die Unterschiede im Außenhandel, in der Qualifikation der Arbeitskräfte sowie in der zu erwartenden Bevölkerungswanderung zwischen Deutschland und den neuen EU-Mitgliedstaaten.
Schlüsselwörter
EU-Osterweiterung, Außenhandel, Qualifikation der Arbeitskräfte, Bevölkerungsmigration, komparative Kosten, Heckscher-Ohlin-Theorem, Leontief-Paradox, Deutschland, Integration, Globalisierung, Wirtschaft, Strukturwandel.
Häufig gestellte Fragen
Welche wirtschaftlichen Folgen hatte die EU-Osterweiterung für Deutschland?
Sie eröffnete neue Absatzmärkte und Wachstumschancen für Unternehmen, löste aber bei inländischen Arbeitnehmern Ängste vor Lohndumping und steigender Arbeitslosigkeit aus.
Wie beeinflusst die Erweiterung die Qualifikation der Arbeitskräfte?
Es zeigen sich Unterschiede in der Qualifikationsstruktur, die Auswirkungen darauf haben, welche Sektoren in Deutschland durch den Wettbewerb mit dem Osten unter Druck geraten.
Was besagt die Theorie der komparativen Kosten von Ricardo?
Sie besagt, dass Länder durch Spezialisierung auf Produkte, die sie relativ kostengünstiger herstellen können, vom Freihandel profitieren, selbst wenn ein Land in allen Bereichen produktiver ist.
Welche Rolle spielt die Bevölkerungswanderung?
Die Wanderungsbewegungen von Arbeitskräften aus den neuen Mitgliedstaaten nach Deutschland sind ein zentraler Aspekt der wirtschaftlichen und sozialen Integration.
Was ist das Heckscher-Ohlin-Theorem?
Es erklärt den Außenhandel durch unterschiedliche Ausstattungen mit Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital) und besagt, dass Länder jene Güter exportieren, die ihre reichlich vorhandenen Faktoren intensiv nutzen.
- Citation du texte
- Michael Nienaber (Auteur), 2004, Die Folgen der EU-Osterweiterung für Deutschland. Unterschiede im Außenhandel, der Qualifikation von Arbeitskräften und der Bevölkerungswanderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29890