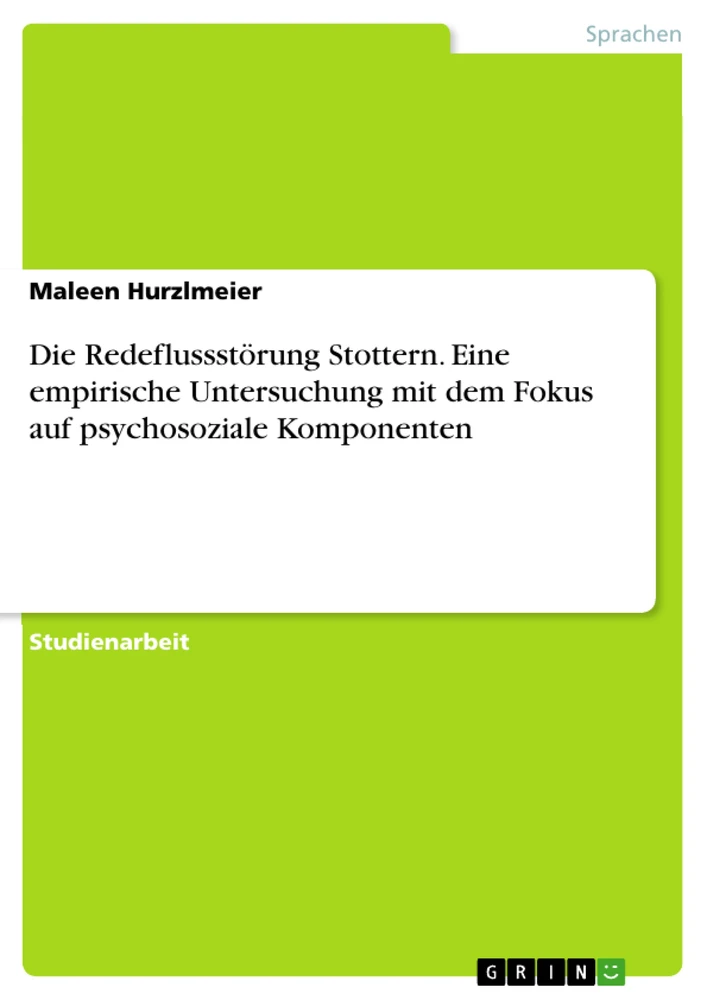Redeflussstörungen begegnen uns meist täglich in den verschiedensten Situationen in Interaktions- und Kommunikationsprozessen mit unseren Gesprächspartnern. Manche dieser Störungen nehmen wir auf Grund ihrer Intensität, sowie deren auffälligen Begleitsymptome bewusst wahr. Was jedoch für Nichtbetroffene unbemerkt bleibt, ist zumeist der Leidensdruck der Betroffenen.
Die hier vorliegende Arbeit hat die Darstellung der theoretischen Grundlagen der Thematik des Stotterns zum Ziel. Unter anderen werden im Rahmen des theoretischen Teils die Symptome und Ursachen des Stotterns aufgezeigt. Insbesondere werden die psychosozialen Einflüsse und Auswirkungen beleuchtet.
Der empirische Teil dieser Arbeit unterliegt einem leitfadengestützten Interview mit Betroffenen des Störungsbildes, sowie einer Angehörigen. Dabei wird der Fokus auf die psychologischen und sozialen Aspekte gerichtet. Ebenso werden noch einmal vorangegangene Hypothesen bzw. Aussagen aus dem theoretischen Teil aufgegriffen. Abschließend wird der Arbeit eine Reflexion nachgestellt. Etwaige Therapiemöglichkeiten werden vorliegend nicht behandelt, es wird lediglich ein kurzer Ausblick auf mögliche therapeutische Verfahren gegeben.
Für die Anfertigung dieser Arbeit wurde eine Auswahl von fachspezifischer Literatur zur Thematik der Redeflussstörung – Stottern getroffen. Außerdem wurde sich bemüht, geeignete Literatur zum empirischen und wissenschaftlichen Arbeiten zu verwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Redeflussstörung Stottern
- Begriffsbestimmung – Abgrenzung zu anderen Sprachstörungen
- Die Symptomatik des Stotterns
- Äußere Symptome
- Innere Symptome
- Die Ätiologie des Stotterns
- Beginn des Stotterns
- Erklärungsansätze des Stotterns
- Empirische Untersuchung – Qualitative Befragung als leitfadengestütztes Interview
- Methodik
- Interviewleitfäden der qualitativen Befragung
- Interviewleitfaden für Probanden
- Interviewleitfaden für die Angehörige
- Ergebnisse des leitfadengestützten Interviews
- Diskussion der Ergebnisse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen der Redeflussstörung Stottern darzustellen. Der theoretische Teil beleuchtet die Symptome und Ursachen des Stotterns, insbesondere die psychosozialen Einflüsse und Auswirkungen. Der empirische Teil fokussiert auf ein leitfadengestütztes Interview mit Betroffenen und einer Angehörigen, wobei die psychologischen und sozialen Aspekte im Vordergrund stehen. Vorangegangene Hypothesen aus dem theoretischen Teil werden aufgegriffen und diskutiert. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion ab. Etwaige Therapiemöglichkeiten werden nicht behandelt, aber ein kurzer Ausblick auf mögliche therapeutische Verfahren wird gegeben.
- Definition und Abgrenzung des Stotterns zu anderen Sprachstörungen
- Symptome des Stotterns: äußere und innere Erscheinungsformen
- Ursachen des Stotterns: biologische, psychologische und soziale Faktoren
- Psychologische und soziale Auswirkungen des Stotterns auf Betroffene
- Empirische Untersuchung: qualitative Befragung von Stotterern und Angehörigen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Redeflussstörung Stottern ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 widmet sich der Begriffsbestimmung des Stotterns und grenzt es von anderen Sprachstörungen ab. Die Symptomatik des Stotterns wird im Detail dargestellt, wobei zwischen äußeren und inneren Symptomen unterschieden wird. Kapitel 3 präsentiert eine qualitative Untersuchung mit leitfadengestützten Interviews mit Stotterern und einer Angehörigen, wobei die methodische Vorgehensweise erläutert und die Ergebnisse der Interviews analysiert werden. Die Diskussion der Ergebnisse setzt sich mit den gewonnenen Erkenntnissen auseinander und stellt Bezüge zum theoretischen Teil der Arbeit her.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Redeflussstörung Stottern und fokussiert auf die Symptome, Ursachen, psychosozialen Auswirkungen sowie die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung mit leitfadengestützten Interviews mit Stotterern und einer Angehörigen. Wichtige Schlüsselbegriffe sind Redeflussstörung, Stottern, Symptomatik, Ätiologie, psychosoziale Einflüsse, qualitative Befragung, leitfadengestütztes Interview, Ergebnisse, Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die typischen Symptome des Stotterns?
Man unterscheidet zwischen äußeren Symptomen (Wiederholungen, Dehnungen, Blockaden) und inneren Symptomen wie Leidensdruck und Sprechangst.
Welche Ursachen liegen dem Stottern zugrunde?
Die Ätiologie ist komplex und umfasst biologische Veranlagungen sowie psychologische und soziale Einflussfaktoren.
Welche psychosozialen Auswirkungen hat Stottern auf Betroffene?
Oft leiden Betroffene unter sozialem Rückzug, gemindertem Selbstwertgefühl und Herausforderungen in Interaktions- und Kommunikationsprozessen.
Wie wurde die empirische Untersuchung in dieser Arbeit durchgeführt?
Es wurden qualitative, leitfadengestützte Interviews mit Stotterern sowie einer Angehörigen geführt, um die individuelle Perspektive zu beleuchten.
Bietet die Arbeit Informationen zu Therapiemöglichkeiten?
Die Arbeit konzentriert sich auf Grundlagen und psychosoziale Aspekte; Therapiemöglichkeiten werden nur in einem kurzen Ausblick angerissen.
- Citation du texte
- Maleen Hurzlmeier (Auteur), 2015, Die Redeflussstörung Stottern. Eine empirische Untersuchung mit dem Fokus auf psychosoziale Komponenten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298989