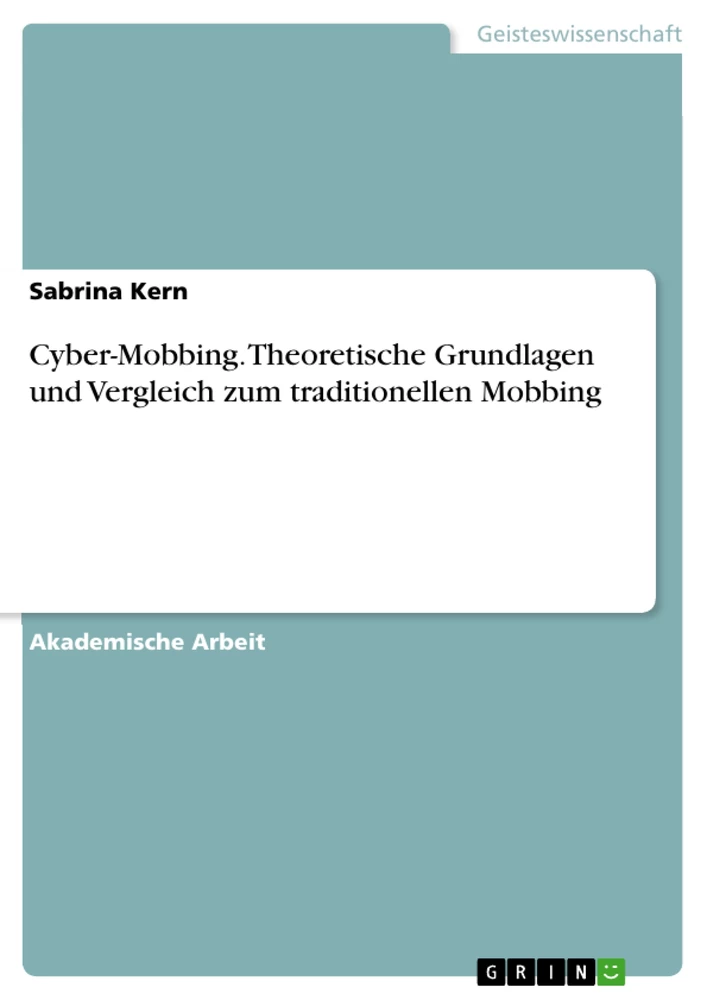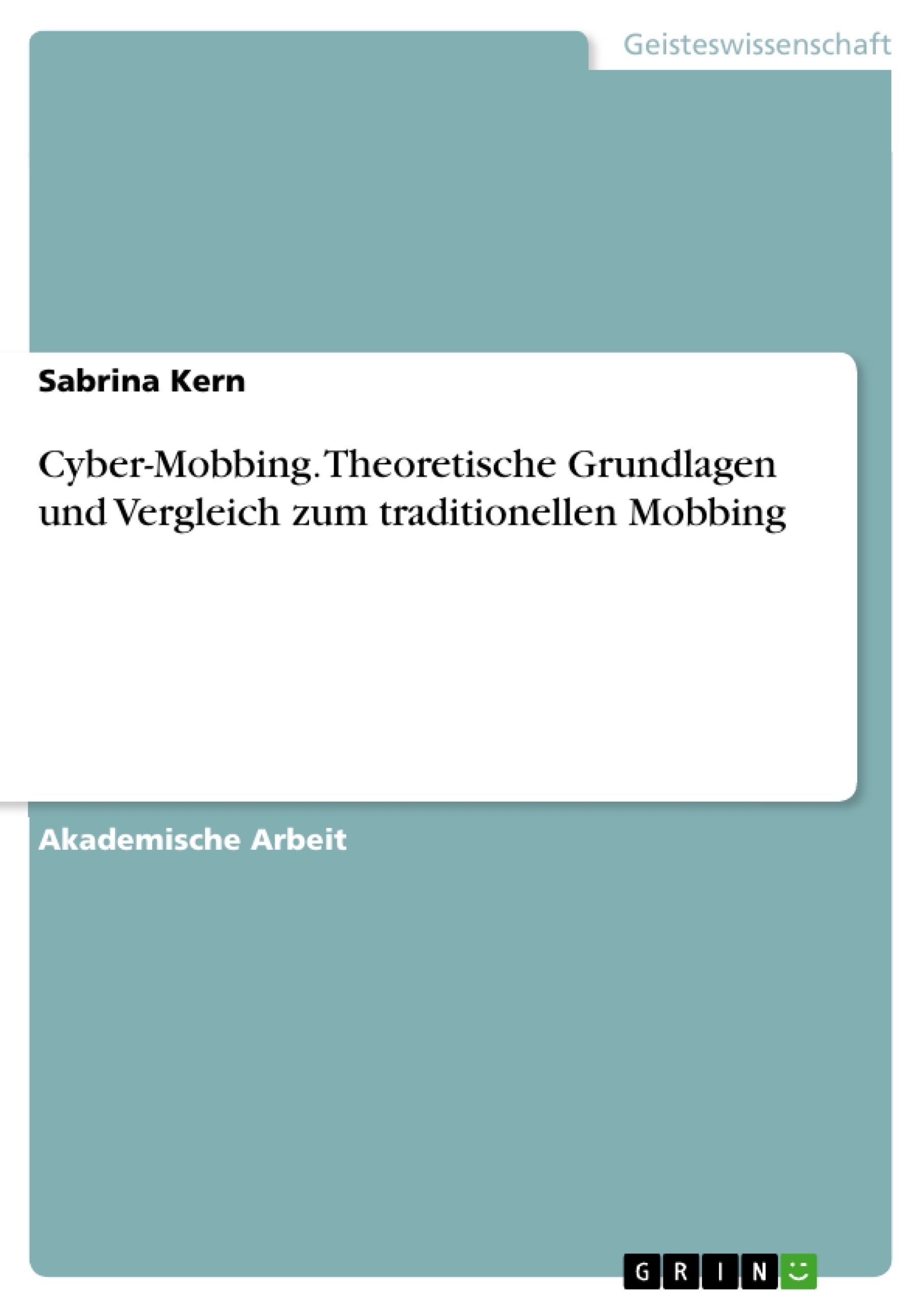Da Cyber-Mobbing ein sehr umfangreiches Themengebiet mit vielen unterschiedlichen Aspekten ist (z. B. Cyber-Mobbing unter Erwachsenen, Cyber-Mobbing von Lehrern durch Schüler, sexuelle Belästigung im Internet etc.), ist es notwendig, das Thema näher einzugrenzen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Cyber-Mobbing unter Kindern und Jugendlichen, weil angloamerikanische Untersuchungen und Studien sich überwiegend auf diese Zielgruppe beschränken.
Befasst man sich mit Cyber-Mobbing, liegt es nahe, zunächst dessen Grundlagen zu erläutern. Dies erfolgt zunächst mit einem Überblick über traditionelles Mobbing. Kapitel 3 zeigt den aktuellen Forschungsbestand über Cyber-Mobbing auf. Zunächst erfolgt eine Begriffsklärung. Anschließend wird ein Überblick über die identifizierten Merkmale gegeben, gefolgt von Angaben zur Häufigkeit des Phänomens. Nach einer Vorstellung der verschiedenen Formen und Methoden von Cyber-Mobbing, wird verdeutlicht wie und wo es stattfinden kann. Bevor auf Wahrnehmung, Reaktionen und Strategien der Opfer eingegangen wird, wird eine Charakteristik der Beteiligten vorgenommen. Das Kapitel schließt mit der Darstellung der Folgen für die Opfer.
- Citar trabajo
- Sabrina Kern (Autor), 2010, Cyber-Mobbing. Theoretische Grundlagen und Vergleich zum traditionellen Mobbing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299014