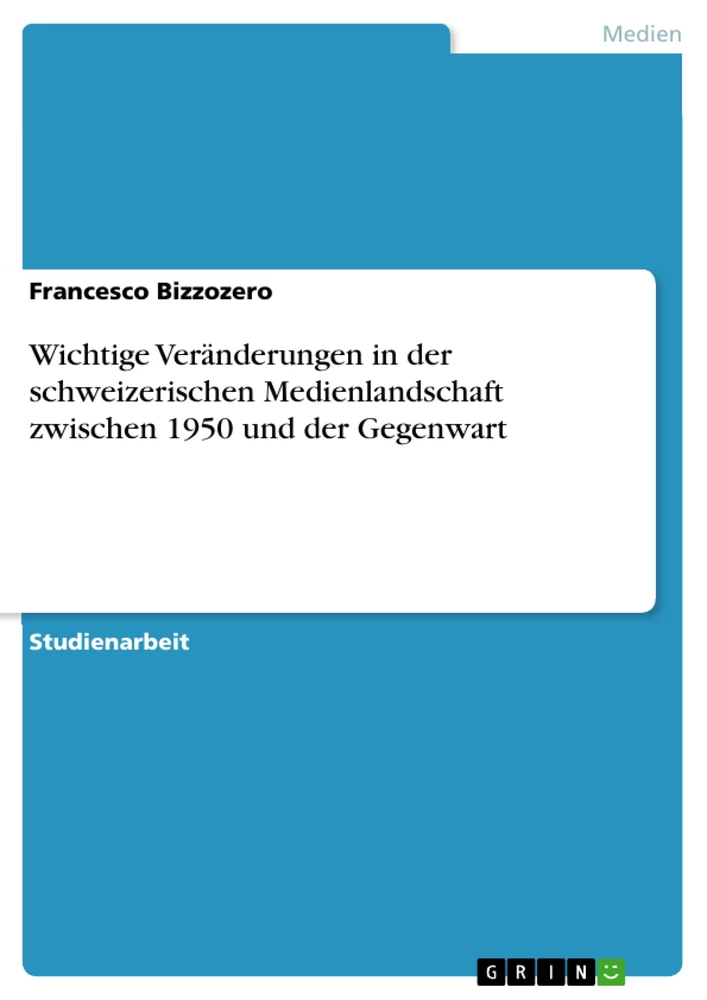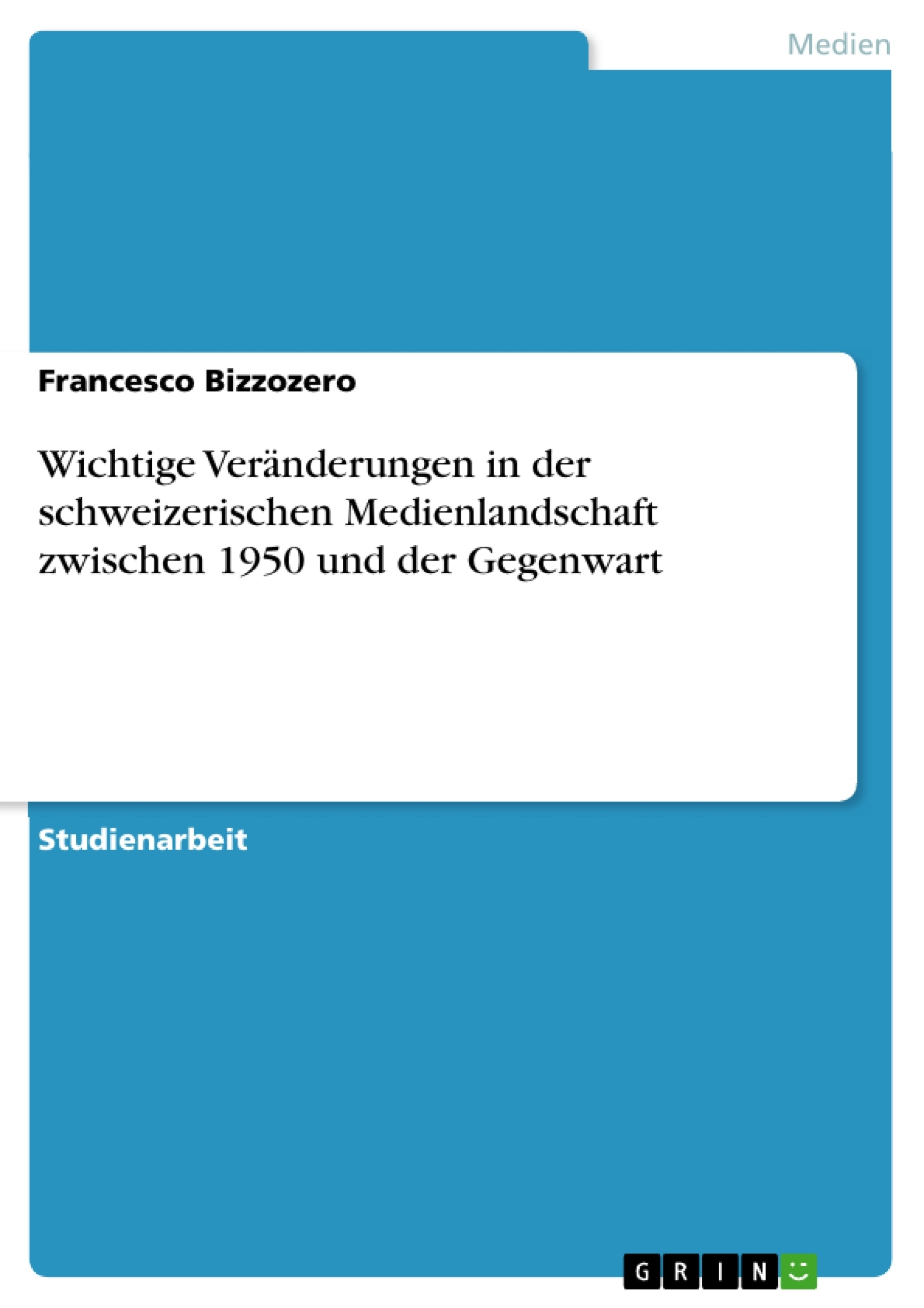Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, bedeutende Veränderungen in der schweizerischen Medienlandschaft zwischen 1950 und der Gegenwart im Überblick darzustellen und zu interpretieren. Dieses Unterfangen wirft zunächst einmal die Frage nach der zu wählenden wissenschaftlichen Herangehensweise auf, denn Mediengeschichte fällt sowohl in den Forschungsbereich der Geschichts- als auch der Publizistikwissenschaft. In der wissenschaftlichen Literatur finden sich kontroverse Aussagen über die entsprechenden Leistungen der zwei Disziplinen – sowohl von Historikern wie auch von Medienwissenschaftlern. Angesichts dieser konfliktbeladenen Ausgangslage sind zur Bearbeitung der Forschungsfrage zwei Kompromisse nötig. Erstens ist es weder im Interesse der wissenschaftlichen Auseinandersetzung noch im Sinn der vorliegenden thematischen Vorgabe, einzelne Medientitel oder –Gattungen zu untersuchen. Andererseits wäre es ein unrealistischer Anspruch, „alle“ Medien in der Erörterung inkludieren zu wollen. Zweitens scheint die vorliegende Fragestellung weder durch eine strikt geschichtswissenschaftliche, noch durch eine streng publizistikwissenschaftliche Herangehensweise – wenn es denn eine gäbe – bearbeitbar zu sein. In einem ersten Schritt bedarf es deshalb einer Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands (Kapitel 2). Dafür wird zunächst in die unterschiedlichen Definitionen des Medienbegriffs aus publizistikwissenschaftlicher Sicht eingeführt (2.1). In der Folge wird die Genese verschiedener Mediengattungen vor 1950 im Überblick skizziert, um die jüngeren Entwicklungen einordnen zu können (2.2). In einem zweiten Schritt wird der Medienwandel ab 1950 aus drei Perspektiven beschrieben (Kapitel 3): Aus technologie- und regulationsgeschichtlicher Perspektive werden sowohl die Diffusion technologischer Innovationen als auch die zentralen medienrechtlichen Entwicklungen besprochen (3.1). Aus wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Perspektive wird auf die Wechselbeziehungen zwischen sozioökonomischen Faktoren und dem Medienwandel eingegangen (3.2). Darauf aufbauend, werden die gesellschaftlichen Folgen dieses Wandels aus einer öffentlichkeitstheoretischen Perspektive interpretiert (3.3). Zum Schluss werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert (Kapitel 4).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands
- Definitionen des Medienbegriffs
- Historische Verortung
- Medienwandel ab 1950
- Technologie- und regulationsgeschichtliche Perspektive
- Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Perspektive
- Kommerzialisierung
- Konzentration
- Öffentlichkeitstheoretische Perspektive
- Funktionen von Öffentlichkeit
- Gesellschaftliche Folgen des Medienwandels
- Zusammenfassung und Diskussion
- Die wichtigsten Veränderungen der Medienlandschaft
- Kritik und Forschungsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit analysiert die bedeutenden Veränderungen in der schweizerischen Medienlandschaft zwischen 1950 und der Gegenwart. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung und Interpretation dieser Veränderungen, wobei verschiedene Perspektiven betrachtet werden, um ein umfassendes Bild der Entwicklung zu zeichnen.
- Der Einfluss technologischer Innovationen auf die Medienlandschaft.
- Die Auswirkungen von Kommerzialisierungs- und Konzentrationsprozessen auf die Schweizer Medienlandschaft.
- Die Bedeutung von Öffentlichkeitstheorien für das Verständnis des Medienwandels.
- Die Rolle der staatlichen Regulierung in der Entwicklung der Schweizer Medienlandschaft.
- Die Herausforderungen und Chancen der digitalen Medienlandschaft in der Schweiz.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Forschungsfrage sowie die methodische Vorgehensweise. Das zweite Kapitel grenzt den Untersuchungsgegenstand ein, indem es verschiedene Definitionen des Medienbegriffs aus publizistikwissenschaftlicher Sicht beleuchtet und die Genese verschiedener Mediengattungen vor 1950 im Überblick skizziert. Das dritte Kapitel beschreibt den Medienwandel ab 1950 aus drei Perspektiven: technologie- und regulationsgeschichtlich, wirtschafts- und sozialgeschichtlich sowie öffentlichkeitstheoretisch.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die zentralen Schlüsselwörter und Fokusthemen dieser Arbeit sind: Schweizer Medienlandschaft, Medienwandel, Kommerzialisierung, Konzentration, Digitalisierung, Technologie, Regulierung, Öffentlichkeitstheorie, Funktionen von Öffentlichkeit, Gesellschaftliche Folgen, Kritik, Forschungsausblick.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Schweizer Medienlandschaft seit 1950 verändert?
Die Veränderungen sind geprägt durch technologische Innovationen (TV, Internet), zunehmende Kommerzialisierung und eine starke Medienkonzentration.
Was bedeutet „Medienkonzentration“ in der Schweiz?
Es beschreibt den Prozess, bei dem immer weniger Verlage (wie Tamedia oder Ringier) eine wachsende Anzahl von Medientiteln kontrollieren, was die Vielfalt beeinflussen kann.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Die Digitalisierung hat die Verbreitungswege revolutioniert, traditionelle Geschäftsmodelle von Zeitungen unter Druck gesetzt und neue Formen der öffentlichen Kommunikation ermöglicht.
Wie greift der Staat in den Medienmarkt ein?
Durch Regulationspolitik und Medienrecht (z. B. Konzessionen für Radio und Fernsehen) versucht der Staat, einen Leistungsauftrag und die Qualität der Berichterstattung zu sichern.
Welche gesellschaftlichen Folgen hat der Medienwandel?
Der Wandel beeinflusst die politische Meinungsbildung und die Funktionen der Öffentlichkeit, wobei die Gefahr einer Fragmentierung des Publikums diskutiert wird.
- Citar trabajo
- Francesco Bizzozero (Autor), 2015, Wichtige Veränderungen in der schweizerischen Medienlandschaft zwischen 1950 und der Gegenwart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299058