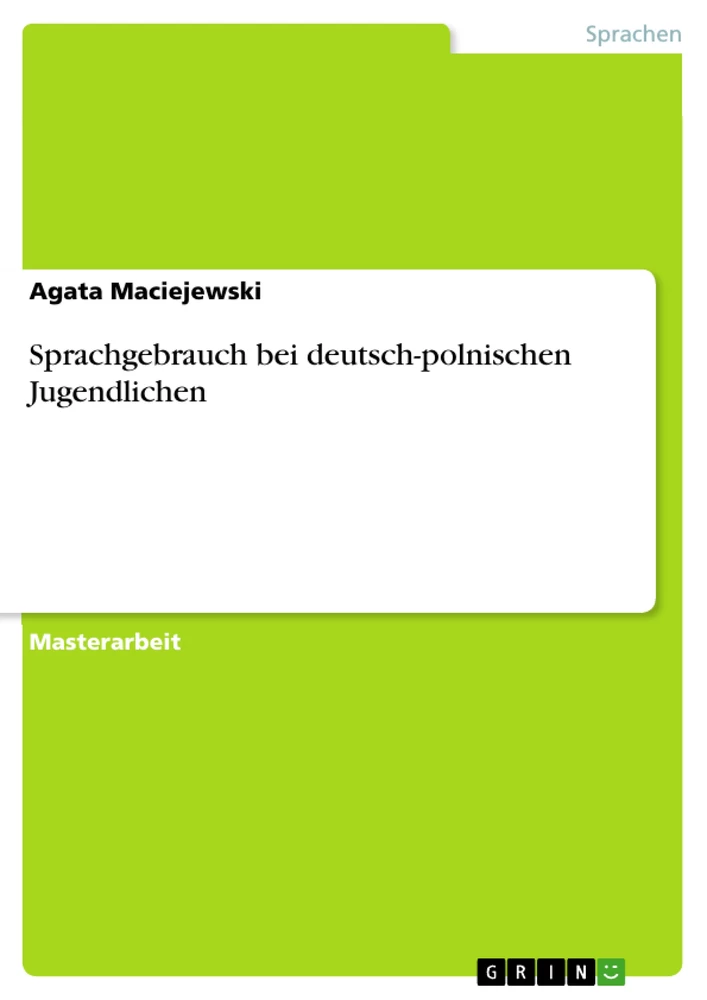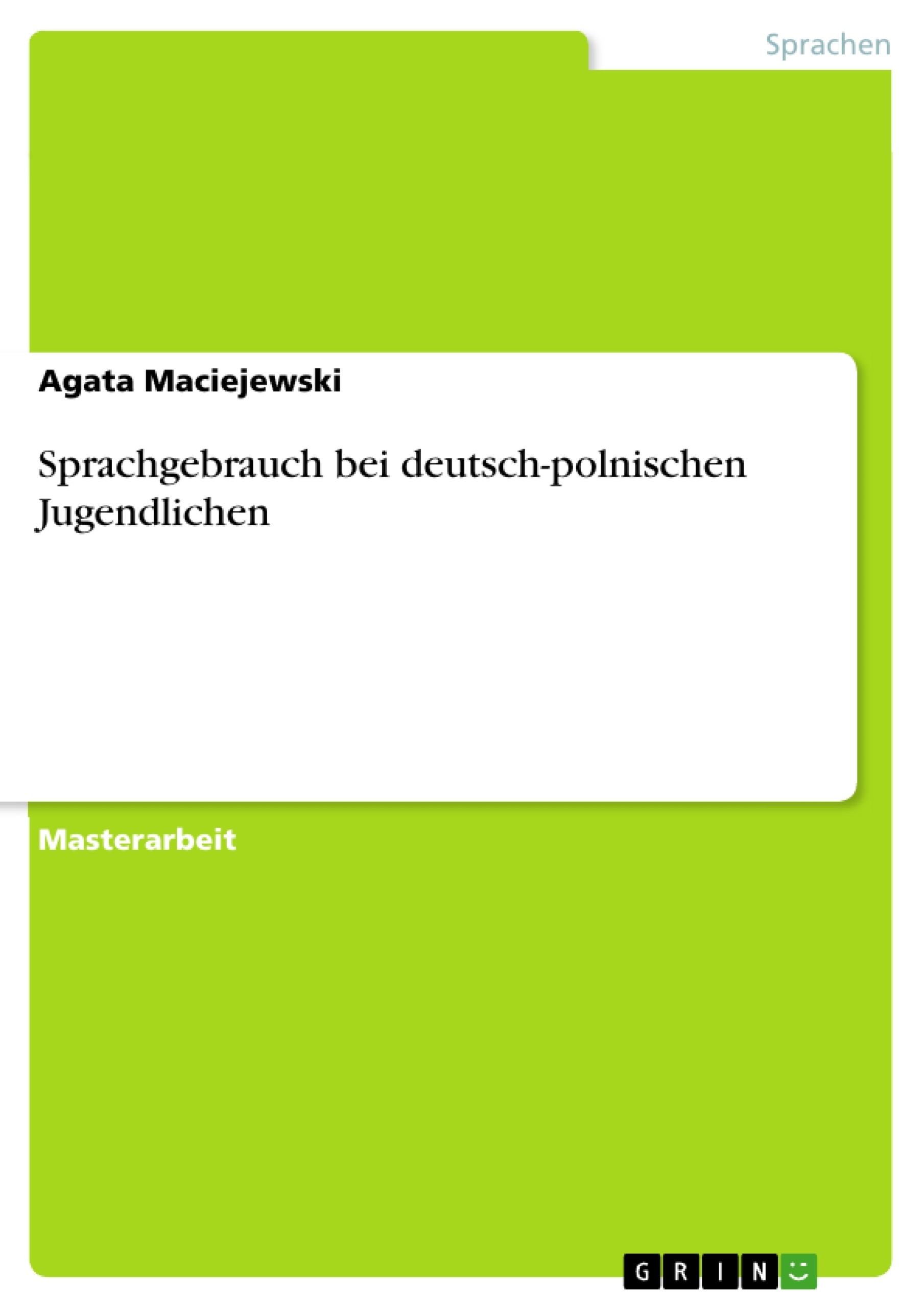Wer die Kommunikation zwischen Zweisprachigen erlebt, stellt oft fest, dass Bilinguale über Sprachgebrauchsmuster verfügen, die Monolinguale nicht zeigen. Sprachmischungen stellen dabei ein sehr häufiges Phänomen dar. Neben den lexikalischen Elementen, können auch grammatische und phonologische Elemente innerhalb eines Satzes aus mehr als einer Sprache stammen, welche als Sprachkontaktphänomene bezeichnet werden.
Während einige Migrantensprachen bisher umfassend erforscht wurden, weist die Forschung in Bezug auf die deutsch-polnische Migrantensprache eine Lücke auf. Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag, diese zu erfüllen und befasst sich mit folgenden Fragen:
1. Welche Besonderheiten und Sprachkontaktphänomene treten im Sprachgebrauch bei deutsch-polnischen Sprechern auf?
2. Welche Unterschiede ergeben sich in Bezug auf diese Aspekte zwischen jüngeren und älteren Bilingualen mit einer unterschiedlichen Aufenthaltsdauer in Deutschland?
Um diese Fragen zu beantworten, wurden zwei Gruppen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Aufenthaltsdauer in Deutschland untersucht. Es wurden Sprachdaten sowohl in Form von Spontanaufnahmen als auch von elizierten Daten erhoben und unter Berücksichtigung der individuellen Sprachkompetenz auf die auftretenden Sprachkontaktphänomene analysiert.
Im ersten Teil der Arbeit erfolgt zunächst eine Begriffsdefinition von Bilingualismus. Es wird auf den Zweitspracherwerb in verschiedenen Altersstufen sowie auf den gegenseitigen Spracheneinfluss eingegangen. Des Weiteren werden alle Formen von möglichen Sprachkontaktphänomenen dargestellt, wobei insbesondere auf zwei Modelle von Myers-Scotton Bezug genommen wird: Das MLF-Modell und das 4-M-Modell. Es wird eine Gegenüberstellung der polnischen und deutschen Sprache vorgenommen, die methodische Vorgehensweise erläutert und eine Sprachstandsdiagnose auf Basis der elizierten Daten sowie der Sprachdaten bei beiden Gruppen durchgeführt. Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit der strukturellen Analyse der auftretenden Sprachkontaktphänomene, wobei der Fokus auf die morphologische, syntaktische und semantische Ebene gelegt wird. Die Sprachkontaktphänomene werden unter Einbezug der bilingualen Kompetenz und der Unterschiede hinsichtlich beider Sprachsysteme ermittelt und begründet. Im anschließenden Teil werden Besonderheiten des Sprachgebrauchs beider Gruppen gegenübergestellt und verglichen und Antworten auf die beiden zentralen Forschungsfragen gegeben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Was ist Bilingualismus?
- Erstsprache, Zweitsprache, dominante Sprache und bevorzugte Sprache
- Gleichzeitiger und nachzeitiger Erwerb zweier Sprachen
- Entwicklung der Zweitsprache
- Gegenseitiger Spracheneinfluss, Transfer und Interferenz
- Sprachkontaktphänomene
- Code-switching
- Insertion und Alternation
- Das Matrix-Language-Frame Model
- Das 4-M-Modell
- Lehnformungen
- Konvergenzen
- Zusammenfassung
- Komparatistik Deutsch - Polnisch
- Nomina
- Das Genus
- Der Kasus
- Deklinationstypen
- Konjugation von Verben
- Die Syntax
- Erste Schlussfolgerungen
- Methodik und Datenkorpus
- Die Gruppen der Informanten
- Die Untersuchungsmethodik
- Elizierte Daten
- Einzelinterviews
- Grammatiktests und freie schriftliche Arbeiten
- Gruppenarbeit
- Aufnahmen von Spontandaten
- Sprachstandsdiagnose
- Strukturelle Analyse der Sprachkontaktphänomene der Gruppe 1
- Code-switching
- Insertions
- Embedded Language Islands
- Alternations
- Lehnformungen
- Konvergenzen
- Weitere Besonderheiten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Strukturelle Analyse der Sprachkontaktphänomene der Gruppe 2
- Insertions
- Embedded Language Islands
- Alternations
- Lehnformungen
- Weitere Besonderheiten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Vergleich der Sprachkontaktphänomene zwischen beiden Gruppen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der strukturellen Analyse von Sprachkontaktphänomenen im bilingualen Sprachgebrauch von Personen, die in Deutsch und Polnisch gleichermaßen kompetent sind. Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede im Sprachgebrauch von deutsch-polnischen Sprechern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Aufenthaltsdauer in Deutschland zu untersuchen. Dabei werden sowohl die individuellen Sprachkenntnisse als auch die Unterschiede zwischen den beiden Sprachsystemen berücksichtigt.
- Untersuchung von Sprachkontaktphänomenen im bilingualen Sprachgebrauch von deutsch-polnischen Sprechern
- Analyse der Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen jüngeren und älteren Bilingualen
- Betrachtung der Auswirkungen der unterschiedlichen Aufenthaltsdauer in Deutschland auf den Sprachgebrauch
- Analyse der Einflüsse der individuellen Sprachkenntnisse auf den Sprachgebrauch
- Vergleich der Sprachsysteme von Deutsch und Polnisch im Kontext von Sprachkontaktphänomenen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Masterarbeit vor und erläutert die Relevanz der Untersuchung von Sprachkontaktphänomenen im deutsch-polnischen Sprachgebrauch.
- Was ist Bilingualismus?: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Bilingualismus und erklärt die verschiedenen Arten des Spracherwerbs. Es werden die Begriffe Erstsprache, Zweitsprache, dominante Sprache und bevorzugte Sprache näher beleuchtet.
- Gegenseitiger Spracheneinfluss, Transfer und Interferenz: Dieses Kapitel behandelt die Phänomene des gegenseitigen Spracheneinflusses, des Transfers und der Interferenz, die im Sprachgebrauch von Bilingualen auftreten können.
- Sprachkontaktphänomene: Dieses Kapitel stellt verschiedene Arten von Sprachkontaktphänomenen vor, darunter Code-switching, Lehnformungen und Konvergenzen. Es werden auch wichtige Modelle zur Erklärung dieser Phänomene, wie das Matrix-Language-Frame Model und das 4-M-Modell, vorgestellt.
- Komparatistik Deutsch - Polnisch: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Sprachen Deutsch und Polnisch hinsichtlich ihrer grammatischen Strukturen. Es werden die Unterschiede in der Nominalflexion, der Genuszuweisung, der Kasusmarkierung, der Deklinationstypen, der Konjugation von Verben und der Syntax beleuchtet.
- Methodik und Datenkorpus: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung und die Zusammensetzung des Datenkorpus. Es werden die beiden untersuchten Gruppen von deutsch-polnischen Sprechern vorgestellt, sowie die verschiedenen Methoden zur Datenerhebung.
- Sprachstandsdiagnose: Dieses Kapitel analysiert den Sprachstand der beiden untersuchten Gruppen.
- Strukturelle Analyse der Sprachkontaktphänomene der Gruppe 1: Dieses Kapitel untersucht die Sprachkontaktphänomene, die in der Gruppe der älteren deutsch-polnischen Sprecher auftreten.
- Strukturelle Analyse der Sprachkontaktphänomene der Gruppe 2: Dieses Kapitel analysiert die Sprachkontaktphänomene, die in der Gruppe der jüngeren deutsch-polnischen Sprecher auftreten.
- Vergleich der Sprachkontaktphänomene zwischen beiden Gruppen: Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Analyse der Sprachkontaktphänomene in den beiden Gruppen und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden zentralen Themen und Begriffen: Bilingualismus, Sprachkontaktphänomene, Code-switching, Lehnformungen, Konvergenzen, Deutsch-Polnische Sprachkontakte, Sprachentwicklung, Sprachsystemvergleich, Sprachstandsdiagnose, Datenanalyse.
- Citation du texte
- Agata Maciejewski (Auteur), 2011, Sprachgebrauch bei deutsch-polnischen Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299162