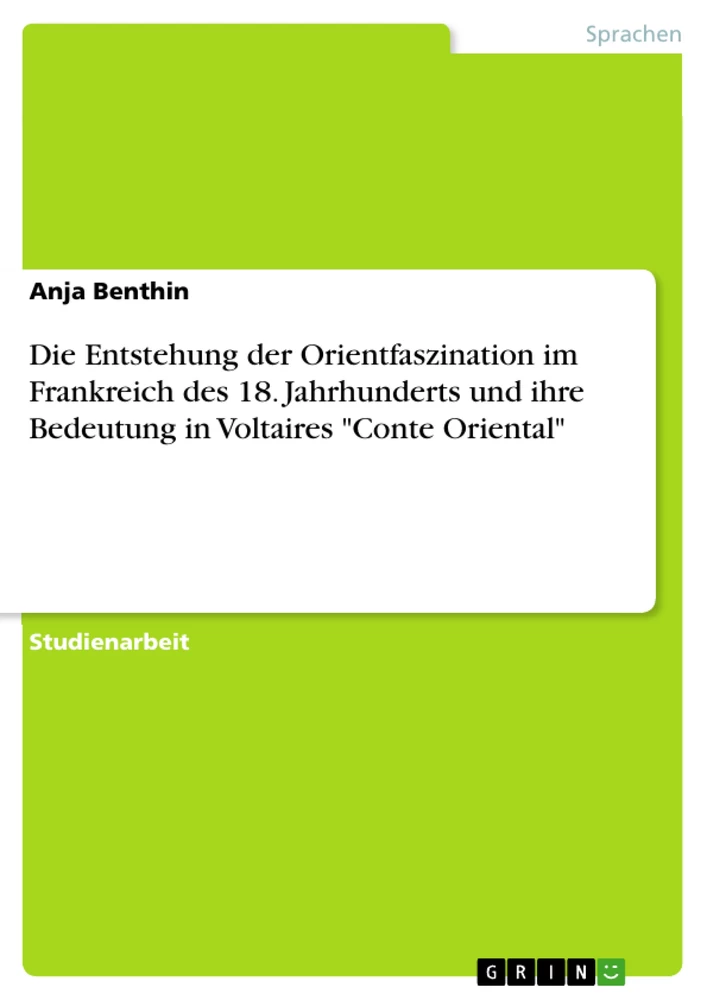Bereits im 17.Jahrhundert begannen die orientalischen Einflüsse Einzug in die französischen Lebensformen zu nehmen. Dies geschah einerseits durch Reiseberichte über den Orient, andererseits aber auch durch reale Begegnungen mit dem „Anderen“, die ebenfalls das Interesse der Gesellschaft an allem Orientalischen weckten. Der Höhepunkt dieses Interesses und der Orientmode wurde allerdings ab 1704 durch die Übersetzung der Mille et une Nuits in das Französische erreicht. Auch Voltaire folgte dieser Mode und trug mit seinen zahlreichen "Contes Orientaux" zweifelsohne zu einem Stück Weltliteratur bei.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Reisebewegung des 17.Jahrhunderts als Auslöser der Orientfaszination
- Jean Baptiste Tavernier
- Jean de Thévenot
- Jean Chardin
- Andere Auslöser der Orientfaszination
- Les Mille et une Nuits
- Orientalismus am Beispiel von Voltaires Zadig
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Orientfaszination im Frankreich des 18. Jahrhunderts und ihre Bedeutung in Voltaires contes orientaux. Sie beleuchtet, wie Reiseberichte, reale Begegnungen mit dem „Anderen“ und Werke wie „Les Mille et une Nuits“ das Interesse an der orientalischen Kultur und Lebensweise förderten.
- Die Rolle von Reiseberichten in der Verbreitung von Wissen über den Orient
- Der Einfluss von realen Begegnungen mit dem „Anderen“ auf die Wahrnehmung des Orients
- Die Bedeutung von literarischen Werken wie „Les Mille et une Nuits“ für die Orientfaszination
- Die Verwendung der orientalischen Kulisse in Voltaires contes orientaux und ihre Bedeutung für die Vermittlung philosophischer Botschaften
- Die Rezeption der Orientfaszination in der französischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Orientfaszination im Frankreich des 18. Jahrhunderts ein und erläutert die Relevanz von Voltaires contes orientaux in diesem Kontext. Kapitel 1 analysiert die Reisebewegung des 17. Jahrhunderts als wichtigen Auslöser der Orientfaszination. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle von Handelsreisenden wie Jean-Baptiste Tavernier und deren Reiseberichten. Kapitel 2 untersucht weitere Faktoren, die zur Entstehung der Orientfaszination beitrugen, insbesondere die Übersetzung der „Mille et une Nuits“ ins Französische. Kapitel 3 betrachtet den Orientalismus am Beispiel von Voltaires „Zadig“ und analysiert die Verwendung der orientalischen Kulisse in diesem conte oriental.
Schlüsselwörter (Keywords)
Orientfaszination, Frankreich, 18. Jahrhundert, Reiseberichte, Jean-Baptiste Tavernier, Les Mille et une Nuits, Voltaire, contes orientaux, Orientalismus, Zadig, Philosophie, Literatur, Kultur, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand die Orientfaszination im Frankreich des 18. Jahrhunderts?
Die Faszination wurde durch Reiseberichte des 17. Jahrhunderts, reale Begegnungen mit Gesandten und literarische Werke wie "Tausendundeine Nacht" ausgelöst.
Welche Rolle spielten Reiseberichte für den Orientalismus?
Berichte von Reisenden wie Jean-Baptiste Tavernier und Jean Chardin lieferten detaillierte Informationen über die Kultur und Lebensweise im Orient und weckten das Interesse der Gesellschaft.
Was ist die Bedeutung von "Les Mille et une Nuits" für diese Epoche?
Die Übersetzung von "Tausendundeine Nacht" ins Französische ab 1704 markierte den Höhepunkt der Orientmode und beeinflusste die Literatur maßgeblich.
Wie nutzt Voltaire den Orient in seinem Werk "Zadig"?
Voltaire nutzt die orientalische Kulisse als verschlüsselten Raum, um philosophische Botschaften und Gesellschaftskritik zu vermitteln, ohne die Zensur direkt herauszufordern.
Was sind die "Contes Orientaux"?
Es handelt sich um orientalische Erzählungen, eine literarische Gattung, die im 18. Jahrhundert sehr populär war und der auch Voltaire mit seinen Werken folgte.
- Citar trabajo
- Anja Benthin (Autor), 2008, Die Entstehung der Orientfaszination im Frankreich des 18. Jahrhunderts und ihre Bedeutung in Voltaires "Conte Oriental", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299194