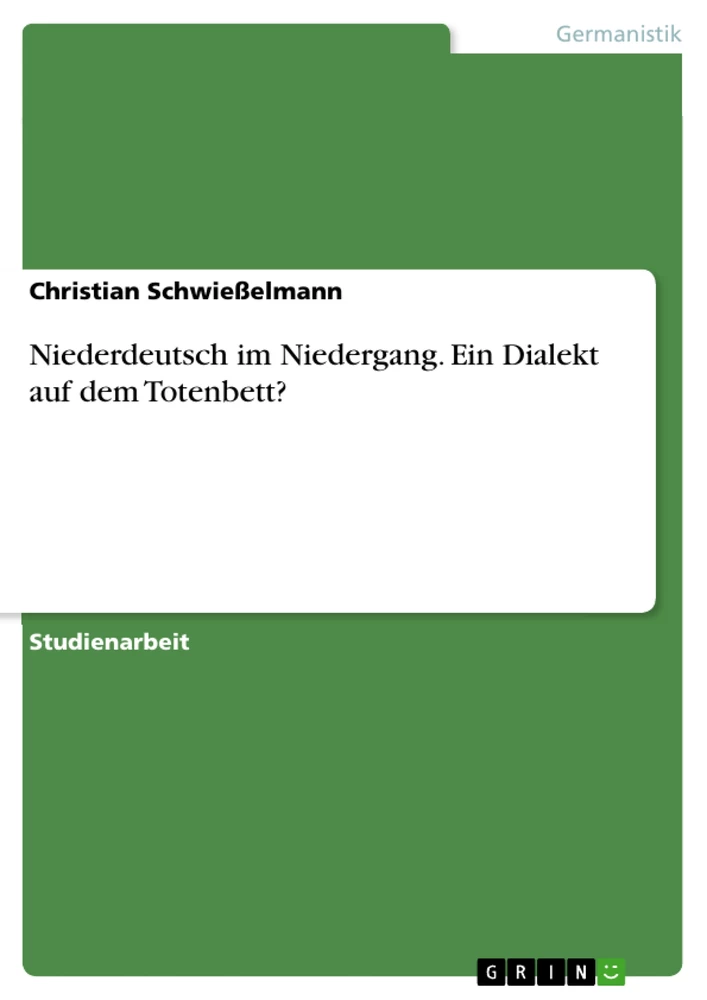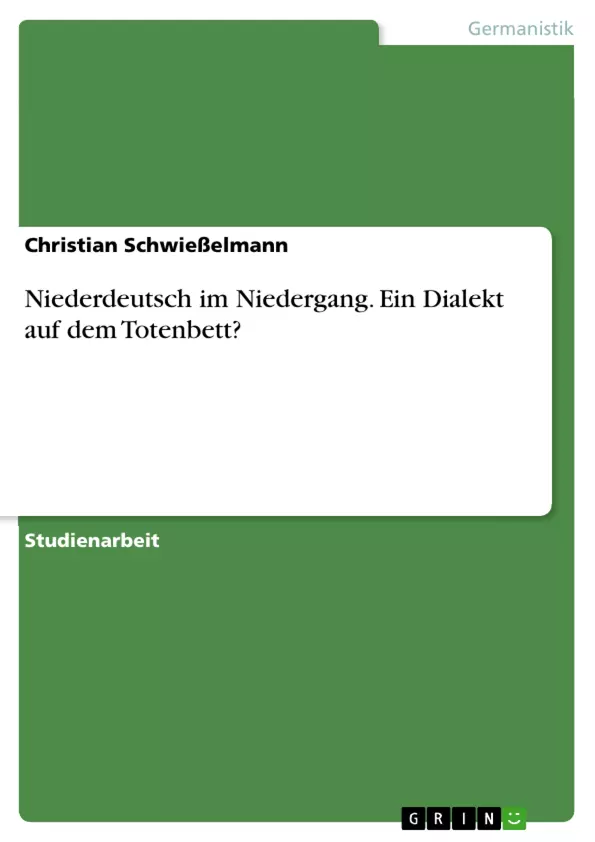Der Besucherrückgang der niederdeutschen Bühne ist nur ein Indikator für den fortschreitenden Schwund des Niederdeutschen, der sich sowohl im Rückgang der Sprachkompetenzen und der Verwendungshäufigkeit bei den Sprechern als auch im Abbau dialektaler Eigenheiten und in der Angleichung an die Standardsprache widerspiegelt.
Die vorliegende Arbeit will diesen Sprachwandel auf pragmatischer und grammatikalischer Ebene nachzeichnen. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Zukunft des Niederdeutschen, dessen Funktionsverlust seit Beginn der Neuzeit sehr gut erforscht ist. Zentrale Frage ist, ob es sich im Falle des Niederdeutschen retrospektiv um einen „aussterbenden“ Dialekt (Sprachwechsel) oder prospektiv um eine regionale Varietät des Standarddeutschen handelt (Sprachwandel).
Entsprechend gestaltet sich die Methodik der Untersuchung: In einem ersten Schritt wird die geänderte Sprachverwendung des Niederdeutschen beschrieben; in einem zweiten Schritt folgt der Analyse der pragmatischen Ebene die der grammatikalischen: Wie verändert sich das niederdeutsche Sprachsystem unter dem wachsenden Einfluss des hochdeutschen Standards? Welche dialektalen Besonderheiten schleifen sich ab und warum? Dominiert der Abbau oder die Angleichung? Der dritte Schritt ist weniger deskriptiv angelegt und fragt stattdessen analytisch nach den inneren und äußeren Gründen des veränderten Sprechverhaltens. Liegen sie endogen in einem Einstellungswandel der Sprecher gegenüber dem Niederdeutschen oder aber in exogenen Faktoren wie Medieneinfluss, inner- und außerdeutsche Migration, Demographie, unzulängliche institutionelle Tradierung des Niederdeutschen usw. begründet? Basis der Untersuchung bilden jüngere und ältere Studien, insbesondere empirisch angelegte Umfragen, die Änderungen in der Kompetenz und Performanz des Niederdeutschen dokumentieren. Am Schluss stehen ein Fazit und ein Ausblick in die Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Ohnsorgs Sorgen
- Fragestellung: Ein Dialekt auf dem Totenbett?
- Forschungsstand: Was die Linguistik dazu sagt...
- Hauptteil: Der Verlust der Sprache...........
- Pragmatisch: Aus dem Munde aus dem Sinn..
- Abbau und Angleichung........
- Ursächlich: Sein oder Bewusstsein?
- Schluss: Düstere Prognosen.........
- Fazit: Rückzug auf allen Ebenen...
- Ausblick: Tummelplatz für Sprachhistoriker?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Niederdeutschen und seinem Wandel im Kontext der Standardisierung des Deutschen. Sie untersucht den Rückgang des Niederdeutschen in der Sprachverwendung und analysiert die Ursachen und den Prozess dieses Sprachwandels. Dabei wird die Frage gestellt, ob es sich beim Niederdeutschen um einen "aussterbenden" Dialekt (Sprachwechsel) oder eine regionale Varietät des Standarddeutschen (Sprachwandel) handelt.
- Der Rückgang des Niederdeutschen in der Sprachverwendung
- Die Ursachen des Sprachwandels
- Die Veränderungen im Sprachsystem des Niederdeutschen
- Die Rolle des Standarddeutschen im Sprachwandel
- Die Zukunft des Niederdeutschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung des Ohnsorg-Theaters als eines der letzten Residenzen des Niederdeutschen. Es wird der Rückgang des Niederdeutschen in der Sprachverwendung und der Besucherrückgang des Ohnsorg-Theaters als Indikatoren für den Sprachwandel diskutiert.
Das erste Kapitel analysiert den Forschungsstand zum Niederdeutschen. Es werden unterschiedliche Definitionen des Niederdeutschen und die Debatte um seine Klassifizierung als Sprache, Dialekt oder dialektisierte Sprache beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob das Niederdeutsche eine eigene Standardsprache besitzt und welche Rolle die Variationsbreite der niederdeutschen Mundarten spielt.
Das zweite Kapitel widmet sich der pragmatischen und grammatikalischen Ebene des Sprachwandels. Es werden die Veränderungen in der Sprachverwendung des Niederdeutschen sowie die Abbau- und Angleichungsprozesse im Sprachsystem analysiert. Dabei werden die dialektalen Besonderheiten und ihr Einfluss auf das Standarddeutsche beleuchtet.
Schlüsselwörter
Niederdeutsch, Plattdeutsch, Sprachwandel, Sprachwechsel, Standardisierung, Dialekt, Ausbaudialekt, Soziolinguistik, Sprachverwendung, Mundart, Sprachsystem, Pragmatik, Grammatik, Forschungsstand, Ohnsorg-Theater
Häufig gestellte Fragen
Stirbt das Niederdeutsche (Plattdeutsch) aus?
Die Arbeit untersucht, ob es sich um einen endgültigen Sprachwechsel (Aussterben) oder einen Sprachwandel hin zu einer regionalen Varietät des Hochdeutschen handelt.
Was sind die Ursachen für den Rückgang des Dialekts?
Exogene Faktoren wie Medieneinfluss, Migration und Demographie sowie ein Einstellungswandel der Sprecher spielen eine zentrale Rolle.
Wie verändert sich das niederdeutsche Sprachsystem?
Es findet ein Abbau dialektaler Eigenheiten und eine zunehmende Angleichung an die hochdeutsche Standardsprache statt.
Welche Rolle spielt das Ohnsorg-Theater?
Der Besucherrückgang an der niederdeutschen Bühne gilt als Indikator für den schwindenden Stellenwert der Sprache im öffentlichen Bewusstsein.
Gibt es eine niederdeutsche Standardsprache?
Die linguistische Debatte dreht sich oft darum, ob das Niederdeutsche als eigene Sprache, Dialekt oder dialektisierte Sprache einzustufen ist.
- Citation du texte
- Christian Schwießelmann (Auteur), 2015, Niederdeutsch im Niedergang. Ein Dialekt auf dem Totenbett?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299258