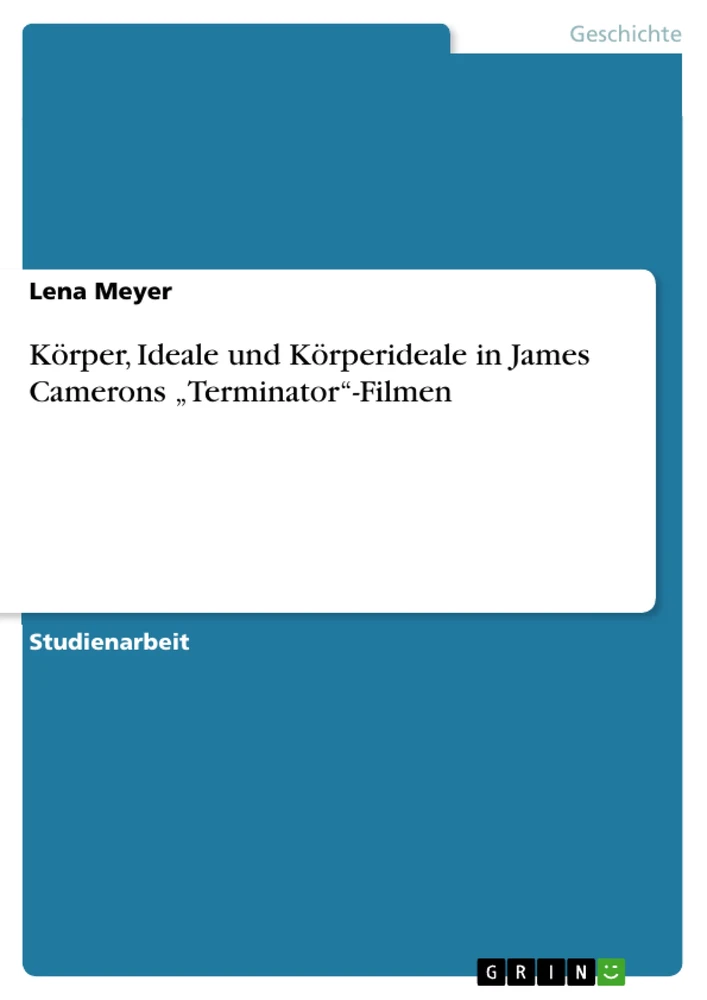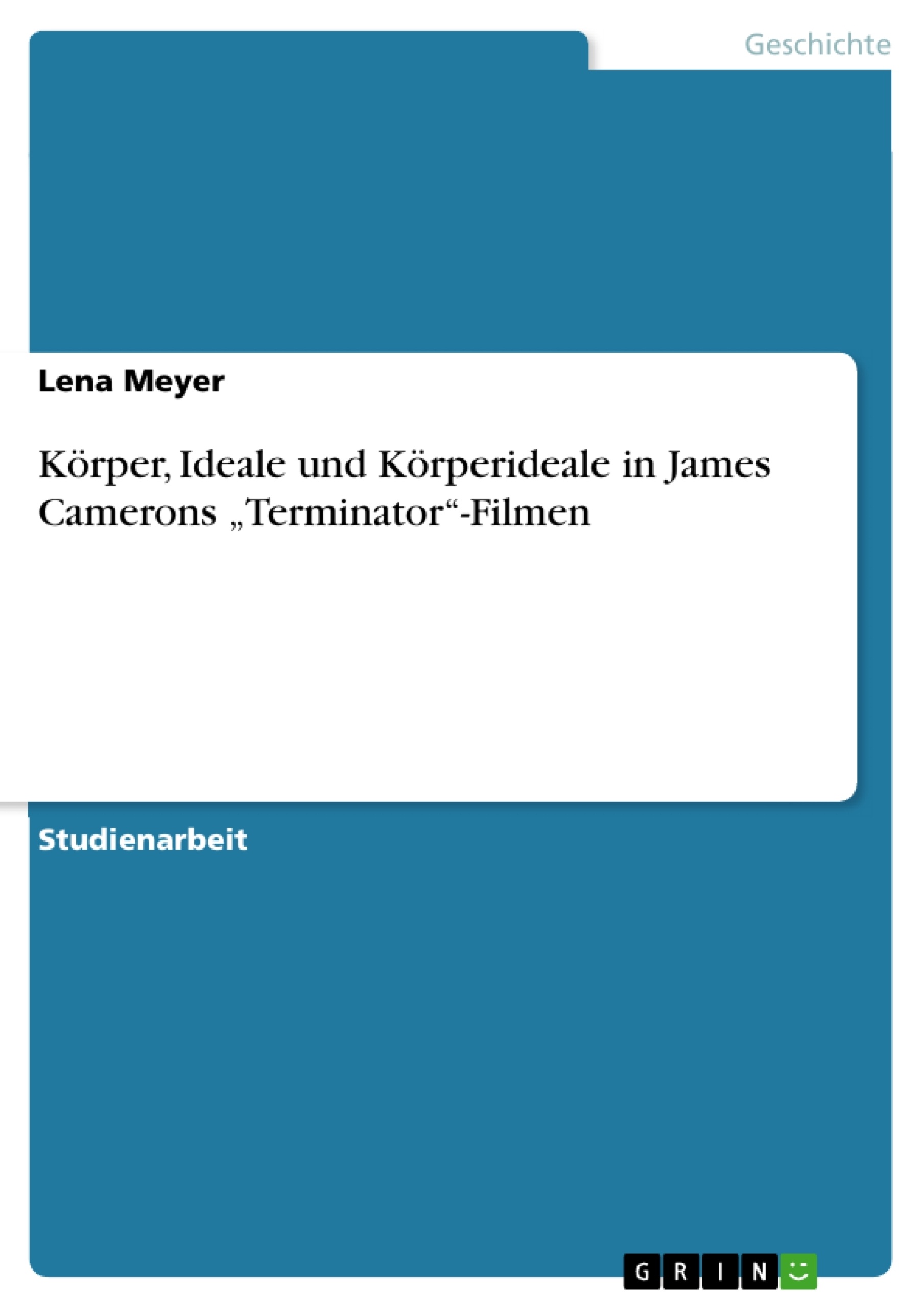Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Körperlichkeit in Actionfilmen anhand der "Terminator"-Filme. Dabei werden die beiden Filme und die in ihnen behandelten Themen und Diskurse zunächst kurz in ihren jeweiligen historischen Kontext eingeordnet. Anschließend wird untersucht, wie der Körper und seine Möglichkeiten präsentiert werden, welche Körpermodelle wie gezeigt, wie bewertet werden und für welche Vorstellungen stehen.
Hier ist besonders die Rolle der Frau und ihres Körpers von Interesse, aber auch der Kontrast entsprechend gezeigter Männerkörper im Vergleich zur dominierenden Figur (im wörtlichen wie übertragenen Sinne) Arnold Schwarzeneggers. Es wird analysiert, wie Vorstellungen von sex und gender dargestellt, beziehungsweise etabliert werden und welche Rolle dabei der Körperlichkeit zukommt.
Ferner wird die Rolle des Terminator selbst beleuchtet und die Art und Weise, in der Cameron in einer der wohl berühmtesten Maschinen der Filmgeschichte eine Vorstellung körperlicher Ästhetik der Zukunft zum Ausdruck bringt. Hier soll vor allem das Wechselspiel von Technophobie und Technophilie, von kunstvoll und künstlich gestalteten Körpern untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Terminator als „Diskursmaschine“
- Mann und Maschine, Mann gegen Maschine - Männlichkeiten in The Terminator 1&2
- Der „sportlich-herbe Typ“ – Frauen und Weiblichkeit in The Terminator 1&2
- „Do I look like the mother of the future?“ – Mutterschaft in The Terminator 1&2
- Der technische Körper: Zwischen Kunst & Künstlichkeit, Form & Funktionalität
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Körperlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit in James Camerons „Terminator“-Filmen (1 und 2). Im Fokus steht die Untersuchung der präsentierten Körpermodelle, ihrer Bewertung und der damit verbundenen Idealvorstellungen. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der Frau und den Kontrast zu den männlichen Figuren gelegt.
- Darstellung von Körperlichkeit im Actionfilmgenre
- Analyse der Geschlechterrollen und -vorstellungen
- Der Terminator als Maschine und seine Entwicklung
- Das Wechselspiel von Technophobie und Technophilie
- Der Einfluss des Zeitgeistes auf die Filmbotschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt das Actionfilmgenre als körperlich geprägtes Genre, das sich oft auf das Wechselspiel von Jäger und Gejagtem reduziert. Die „Terminator“-Filme werden als Beispiel für diese Gattung vorgestellt und ihre Eignung für eine Analyse von Körperlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit herausgestellt. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Körperdarstellungen, Geschlechterrollen und der Rolle des Terminators an.
2. Der Terminator als „Diskursmaschine“: Dieses Kapitel untersucht die „Terminator“-Filme im Kontext ihrer Entstehungszeit und analysiert die Angst vor einer weltumspannenden Zerstörung als zentrales Motiv. Es vergleicht die Darstellung der Apokalypse in beiden Filmen: im ersten Teil als mögliches positives Element, das die Überlebenden stärkt, im zweiten Teil als zu verhindernde Katastrophe. Der Wandel der Botschaft wird mit dem Zeitgeist und möglichen Produktionsdruck in Verbindung gebracht. Der Terminator selbst wird als veränderliche Figur im Laufe der Reihe dargestellt.
3. Mann und Maschine, Mann gegen Maschine - Männlichkeiten in The Terminator 1&2: Der Fokus liegt auf der Darstellung von Männlichkeit, insbesondere der Eröffnungsszene des ersten Films mit dem nackten Terminator. Die Analyse hinterfragt die Darstellung des muskulösen Körpers und seine mögliche symbolische Bedeutung. Die Szene wird als Zurschaustellung eines archaischen, kraftvollen Männerideals interpretiert, das an Bodybuilding-Wettbewerbe erinnert.
Schlüsselwörter
Terminator, Körperlichkeit, Männlichkeit, Weiblichkeit, Actionfilm, Geschlechterrollen, Technophobie, Technophilie, Apokalypse, Zeitgeist, James Cameron.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Körperlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit in James Camerons "Terminator"-Filmen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Körperlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit in James Camerons "Terminator"-Filmen (Teil 1 und 2). Der Fokus liegt auf den präsentierten Körpermodellen, ihrer Bewertung und den damit verbundenen Idealvorstellungen, insbesondere der Rolle der Frau im Kontrast zu den männlichen Figuren.
Welche Themen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Körperlichkeit im Actionfilmgenre, analysiert Geschlechterrollen und -vorstellungen, betrachtet den Terminator als Maschine und seine Entwicklung, beleuchtet das Wechselspiel von Technophobie und Technophilie und untersucht den Einfluss des Zeitgeistes auf die Filmbotschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, dem Terminator als „Diskursmaschine“, Männlichkeiten in den Terminator-Filmen, Weiblichkeiten in den Terminator-Filmen, Mutterschaft in den Terminator-Filmen, dem technischen Körper, und einer Zusammenfassung. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Thematik.
Wie wird der Terminator in der Arbeit betrachtet?
Der Terminator wird als „Diskursmaschine“ betrachtet und seine Darstellung im Kontext der Entstehungszeit und der Angst vor einer weltumspannenden Zerstörung analysiert. Seine Entwicklung als Figur über die beiden Filme hinweg wird ebenfalls untersucht.
Wie werden Männlichkeit und Weiblichkeit dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Männlichkeit, zum Beispiel anhand der Eröffnungsszene des ersten Films mit dem nackten Terminator, und interpretiert sie als Zurschaustellung eines archaischen Männerideals. Die Darstellung von Weiblichkeit wird im Kontrast dazu untersucht, ebenso die Rolle der Mutterschaft.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Terminator, Körperlichkeit, Männlichkeit, Weiblichkeit, Actionfilm, Geschlechterrollen, Technophobie, Technophilie, Apokalypse, Zeitgeist, James Cameron.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die in den "Terminator"-Filmen präsentierten Körpermodelle, Geschlechterrollen und Idealvorstellungen zu analysieren und deren Bedeutung im Kontext des Actionfilmgenres und des Zeitgeistes zu interpretieren.
- Quote paper
- Lena Meyer (Author), 2013, Körper, Ideale und Körperideale in James Camerons „Terminator“-Filmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299333