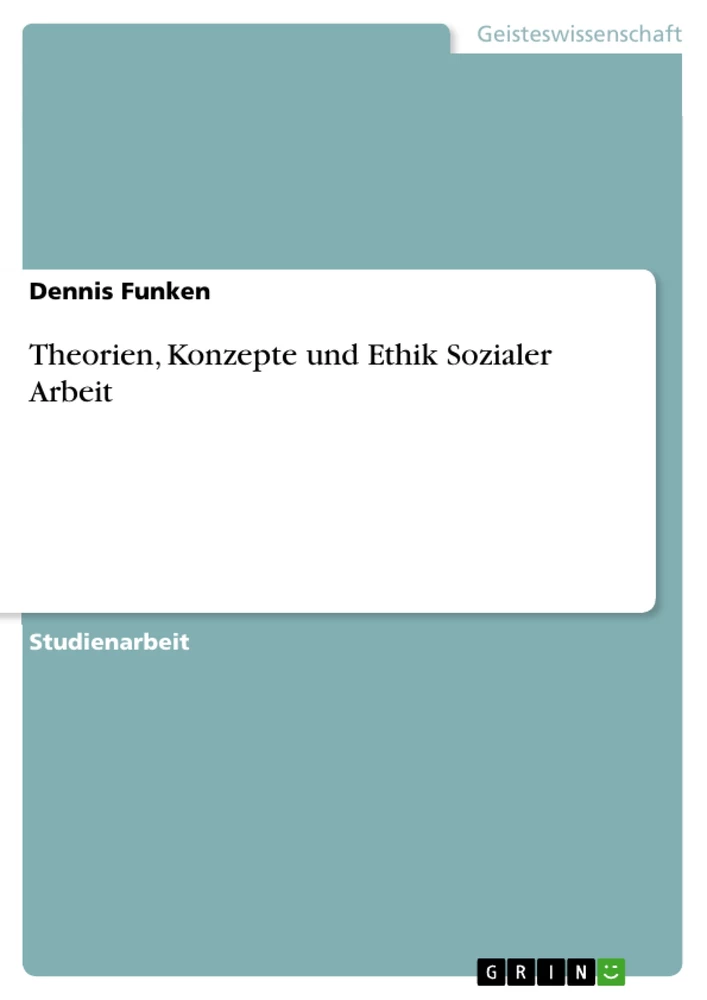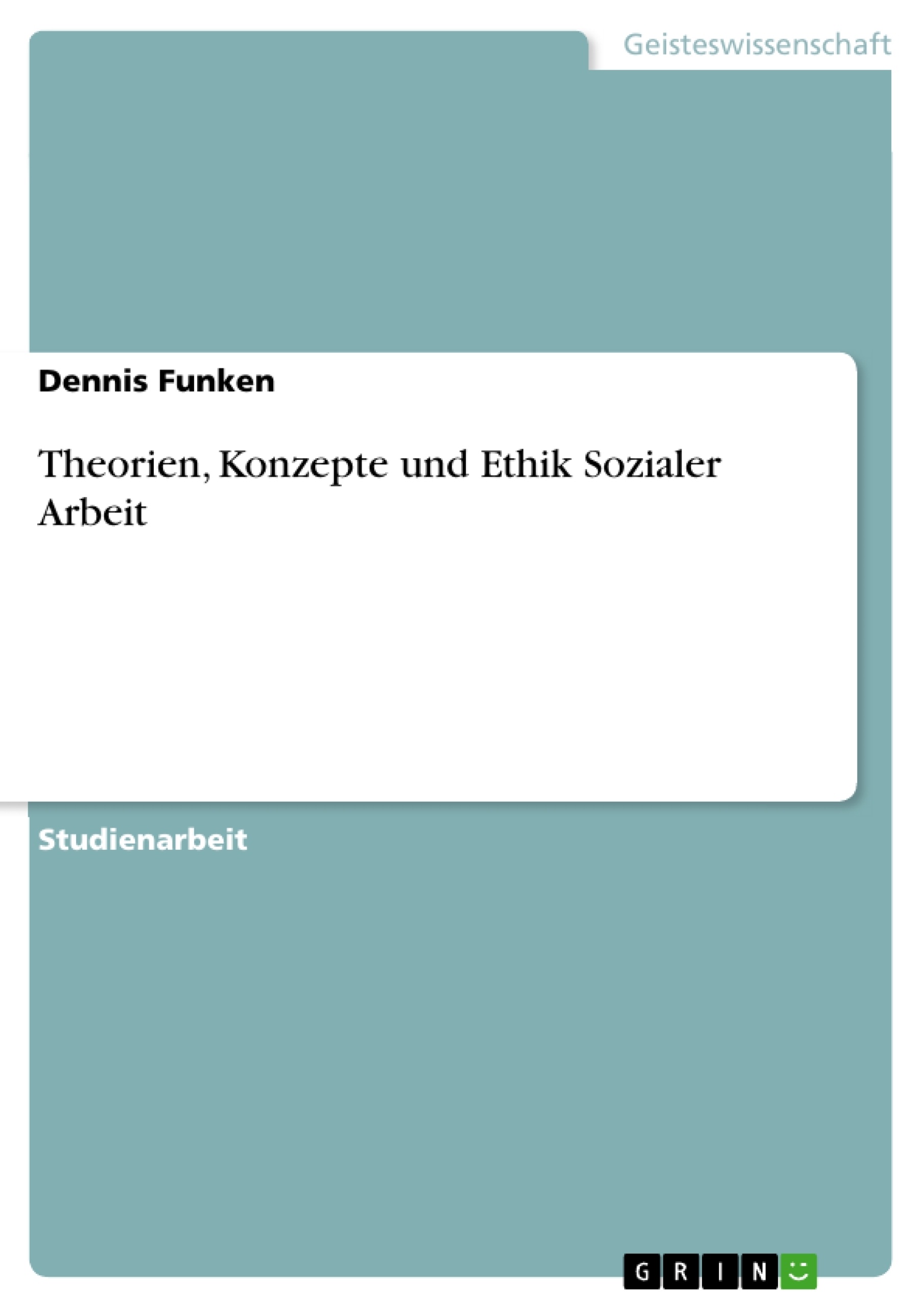Im Zuge dieser Ausarbeitung soll in einem ersten Schritt ein theoretischer Überblick der lebensweltorientierten sowie der systemischen Soziale Arbeit geschaffen werden und weiterhin die Vielschichtigkeit der Ethik, beziehungsweise des ethischen Selbstverständnisses Sozialer Arbeit thematisiert werden.
Der systemische als auch der lebensweltorientierte Ansatz sowie das ethische Selbstverständnis Sozialer Arbeit sollen dabei nicht in aller Ausführlichkeit beschrieben sowie nicht ausschließlich theoretisch dargelegt werden, sondern vielmehr in einen vor allem für die Praxis relevanten Kontext gesetzt werden, um innerhalb der Fallanalyse auch dementsprechend angewendet und auf den Kontext des Fallbeispiels übertragen werden zu können. Der Fall soll zwar auch analysiert werden, dennoch soll ebenfalls den Theorien, den Konzepten und der Ethik Sozialer Arbeit entsprechende Handlungsoptionen erörtert werden, beziehungsweise soll der Fall nach dem 6-Schritte-Modell der ethischen Urteilsfindung nach Tödt gelöst werden.
Innerhalb eines konkludierenden Schritts soll überdies zu einer persönlichen Einschätzung des Falls unter Berücksichtigung der Theorien, Konzepte und ethischen Urteilsfindung gelangt werden. Bei dem Fallbeispiel handelt es sich weiterhin um einen Fall des Regelverstoßes in einer Wohngruppe für Mädchen mit Gewalterfahrungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
- Systemische Soziale Arbeit
- Ethik in der Sozialen Arbeit
- Ethisches Fundament der Sozialen Arbeit
- Spannungsverhältnis: Klient und Staat (Hilfe und Kontrolle)
- Spannungsverhältnis: Institution und Individuum
- Modelle zur ethischen Urteilsfindung
- Fallanalyse
- Zur Anwendung lebensweltorientierter Sozialer Arbeit
- Zur Anwendung systemischer Sozialer Arbeit
- Falllösung im Kontext des ethischen Selbstverständnisses Sozialer Arbeit
- Eigene Einschätzung im Rahmen eines Fazits
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Theorien, Konzepte und die Ethik Sozialer Arbeit anhand eines Fallbeispiels. Dabei werden die lebensweltorientierte und die systemische Soziale Arbeit sowie das ethische Selbstverständnis Sozialer Arbeit in den Vordergrund gestellt. Die Arbeit zielt darauf ab, diese theoretischen Ansätze in einen praxisrelevanten Kontext zu setzen und auf den Kontext des Fallbeispiels zu übertragen.
- Lebensweltorientierung in der Sozialen Arbeit
- Systemische Soziale Arbeit
- Ethisches Selbstverständnis der Sozialen Arbeit
- Fallanalyse im Kontext der Theorien und Konzepte
- Ethische Urteilsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert den Aufbau der Arbeit. Es wird ein Fallbeispiel vorgestellt, das im Laufe der Arbeit analysiert und im Kontext der Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit diskutiert wird.
Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
Dieses Kapitel definiert das Konzept der Lebensweltorientierung und erläutert die verschiedenen Zugänge und Dimensionen dieses Ansatzes. Es werden die Struktur- und Handlungsmaximen der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit dargestellt und der Bezug zu Hans Thierschs Werk hergestellt.
Systemische Soziale Arbeit
Das Kapitel beleuchtet die systemische Soziale Arbeit und ihre spezifischen Leistungen. Es werden die Grundsätze der systemischen Arbeit sowie die Ethik systemischer Sozialer Arbeit vorgestellt. Die Handlungsansätze der systemischen Sozialen Arbeit werden ebenfalls erläutert.
Ethik in der Sozialen Arbeit
Dieses Kapitel behandelt das ethische Fundament der Sozialen Arbeit und die Spannungsverhältnisse zwischen Klient und Staat sowie Institution und Individuum. Es werden Modelle zur ethischen Urteilsfindung vorgestellt.
Fallanalyse
Der Fall des Regelverstoßes in einer Wohngruppe für Mädchen mit Gewalterfahrungen wird im Kontext der lebensweltorientierten und systemischen Sozialen Arbeit analysiert. Es werden Handlungsoptionen im Kontext des ethischen Selbstverständnisses Sozialer Arbeit erörtert und der Fall nach dem 6-Schritte-Modell der ethischen Urteilsfindung nach Tödt gelöst.
Eigene Einschätzung im Rahmen eines Fazits
Dieses Kapitel fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet eine persönliche Einschätzung des Fallbeispiels unter Berücksichtigung der Theorien, Konzepte und ethischen Urteilsfindung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lebensweltorientierung, systemische Soziale Arbeit, Ethik, ethisches Selbstverständnis, Fallanalyse, Handlungsoptionen, ethische Urteilsfindung und das 6-Schritte-Modell nach Tödt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit?
Dieser Ansatz nach Hans Thiersch orientiert sich an der Alltagswelt der Klienten und zielt auf die Bewältigung lebensweltlicher Probleme ab.
Wie definiert sich systemische Soziale Arbeit?
Sie betrachtet Probleme nicht isoliert im Individuum, sondern als Ergebnis von Wechselwirkungen innerhalb sozialer Systeme (z.B. Familie, Institutionen).
Was ist das 6-Schritte-Modell der ethischen Urteilsfindung?
Es ist ein Modell nach Tödt, das Fachkräften hilft, in komplexen Fallbeispielen methodisch begründete ethische Entscheidungen zu treffen.
Welches Spannungsverhältnis besteht zwischen Hilfe und Kontrolle?
Soziale Arbeit agiert oft im Auftrag des Staates (Kontrolle), muss aber gleichzeitig das Wohl und die Autonomie des Klienten (Hilfe) wahren.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit analysiert?
Analysiert wird ein Regelverstoß in einer Wohngruppe für Mädchen mit Gewalterfahrungen.
- Arbeit zitieren
- Dennis Funken (Autor:in), 2014, Theorien, Konzepte und Ethik Sozialer Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299484