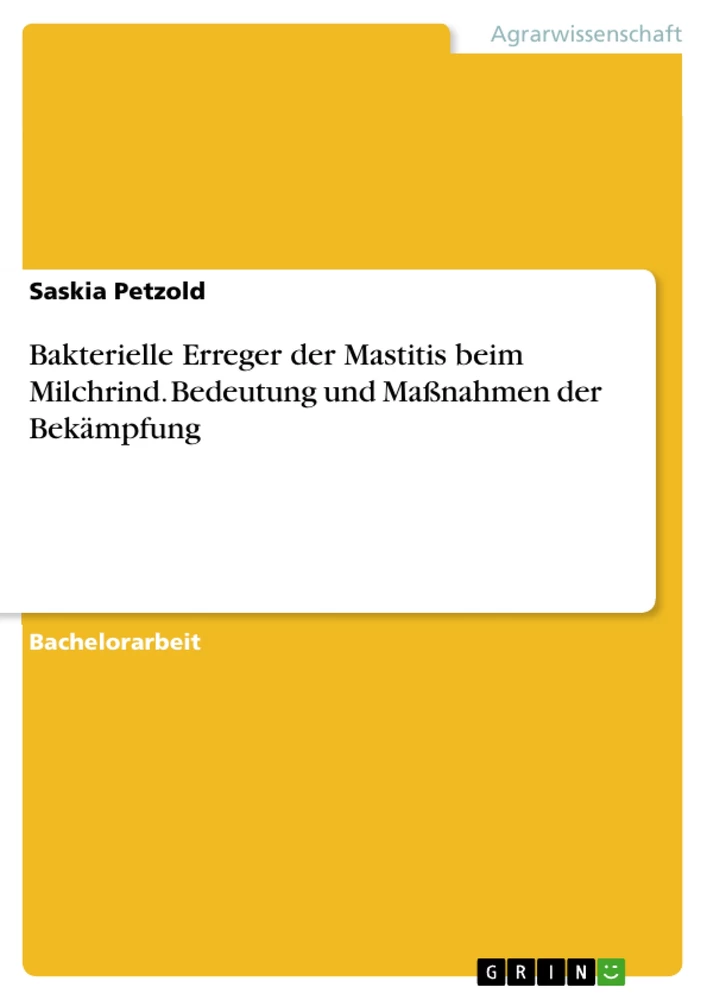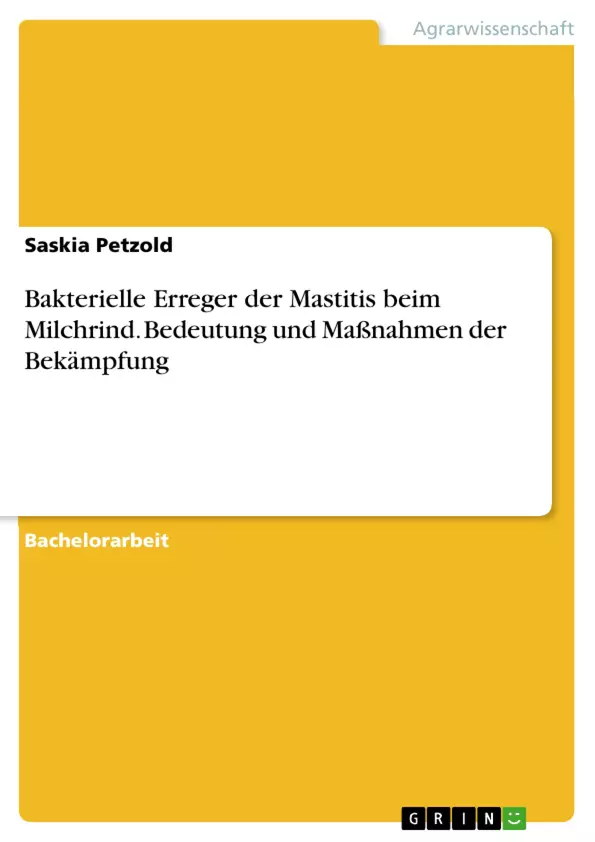Ein gravierendes Problem in der milcherzeugenden Intensiv-Wirtschaft ist seit jeher die Mastitis, die Euterentzündung beim Milchrind. Sie gilt mit 14,8% neben den Fruchtbarkeitsstörungen (20,7%) als größter Verlustbringer in der Milchviehhaltung und als Hauptabgangsursache der Milchkühe in Deutschland (ADR, 2009). In den letzten Jahren wurde zwar eine enorme Steigerung der Milchleistung erreicht, hingegen konnte langfristig gesehen die Mastitisbekämpfung beim Rind eher weniger zufriedenstellend realisiert werden (Wendt et al., 1998).
Für den Milcherzeuger stellt die Eutergesundheit und die Qualität der Milch eine Existenzfrage dar, da hierbei erhebliche finanzielle Verluste möglich sind. Denn einhergehend mit steigender Leistung erhöht sich die Anfälligkeit des äußerst empfindlichen Euters auf Krankheitserreger, welches sich wiederum stark negativ auf die Zellzahl und die gewinnbringende Milchmenge auswirkt. Besonders bei der Akzeptanz des wertvollen Lebensmittels Milch legt der moderne Verbraucher hohen Wert auf eine unbedenkliche Herkunft von gesunden und artgerecht gehaltenen Tieren. Diese lebensmittelhygienische Relevanz verstärkt sich besonders bei der Direktvermarktung und der Erzeugung von Rohmilchprodukten.
Die Mastitis ist eine infektiöse multifaktoriell bedingte Erkrankung der Milchdrüse des Rindes und gilt als Bestandsproblem. Deshalb sollte im Blickpunkt des Herdenmanagements insbesondere eine erfolgreiche Prävention zur Vermeidung neuer Infektionen liegen, an Stelle ständiger Einzelbekämpfungsmaßnahmen bei erkrankten Kühen. Denn nicht nur durch Verluste in der Milchleistung, sondern auch durch Aufwendungen für Behandlungen und Therapiemaßnahmen, erhöhten Arbeitsaufwand und höhere Bestandsergänzungskosten, unterliegt der Milchviehhalter stark schwankenden ökonomischen Auswirkungen (Veauthier, 2011).
Für eine gute Vorbeuge ist es jedoch notwendig, dass der Herdenmanager ausreichende Kenntnisse über Ursachen, Symptome, Übertragung und Therapiemöglichkeiten der Mastitis besitzt. Nur so ist es möglich, sowohl frühestmöglich die Risiken für die Entstehung einer Erkrankung zu erkennen und nach Möglichkeit zu verhindern, als auch langfristig die Eutergesundheit zu verbessern bzw. zu erhalten, wenn vorherrschende Erreger und deren Quellen im eigenen Stall bekannt sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Mastitis bei der Milchkuh.
- 2.1 Definition „Mastitis“.
- 2.2 Kategorien und Verlaufsformen der Mastitis.
- 2.3 Ursachen für einen erhöhten Zellgehalt.
- 2.4 Kennzeichen und Bedeutung einer Mastitiserkrankung.
- 2.5 Erregerarten und deren Einteilung.
- 3 Darstellung der fünf aktuell bedeutendsten bakteriellen Mastitiserreger
- 3.1 Aktuelle Untersuchungsergebnisse von Milchproben auf Erregerhäufigkeiten in Deutschland.
- 3.2 Morphologie und kulturelle Eigenschaften
- 3.2.1 Streptokokken
- 3.2.2 Staphylokokken
- 3.2.3 Coliforme Bakterien
- 3.3 Pathogenese
- 3.3.1 Übertragung und Infektionswege.
- 3.3.2 Abwehrpotential des Euters.
- 3.3.3 Entzündung.
- 3.3.4 Symptome und Krankheitsverlauf.
- 3.4 Nachweis und Behandlungsmöglichkeiten
- 3.5 Therapieansätze.
- 4 Prophylaktische Bekämpfungsmaßnahmen – Ansatzpunkte im Management
- 4.1 Melkablauf.
- 4.1.1 Melktechnik.
- 4.1.2 Melkroutine
- 4.1.3 Melkarbeit und -hygiene
- 4.1.4 Routinediagnostik – Erkennen von Mastitiden
- 4.1.5 Melkatmosphäre
- 4.1.6 Milchflusskurven.
- 4.2 Haltungsmanagement und Umweltfaktoren.
- 4.3 Fütterungsmanagement.
- 4.4 Trockenstellmanagement.
- 5 Vorgehensweise einer Bestandssanierung – Einführung eines Eutergesundheitsprogrammes.
- 5.1 Risikoanalyse im Bestand – Ermittlung des Eutergesundheitsstatus.
- 5.2 Definition der Sanierungsziele
- 5.3 Planen und Einleiten von Sanierungsmaßnahmen zur Beseitigung von Fehlern und Schwachstellen im Stallmanagement.
- 5.4 Nachhaltige Verbesserung der Eutergesundheit durch systematische Erfolgskontrolle.
- 5.5 Einführen eines Monitoringprogrammes zur Überwachung der Eutergesundheit.
- 6 Diskussion - Bedeutung der prophylaktischen Bekämpfung.
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit bakteriellen Erregern der Mastitis beim Milchrind und analysiert die Bedeutung dieser Krankheit sowie die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Mastitis-Problematik zu vermitteln und die wichtigsten Aspekte der Prävention und Behandlung zu beleuchten.
- Pathogenese und Übertragung von Mastitiserregern
- Symptome, Verlauf und Folgen der Mastitis
- Bedeutung der Eutergesundheit für die Milchproduktion und Tierwohl
- Prophylaktische Maßnahmen zur Vermeidung von Mastitiden
- Strategien zur Bestandssanierung und Eutergesundheitsmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 führt in die Definition und die verschiedenen Formen der Mastitis ein. Es werden außerdem die Ursachen für einen erhöhten Zellgehalt in der Milch sowie die Bedeutung einer Mastitiserkrankung für die Milchproduktion und das Tierwohl erläutert. Kapitel 3 befasst sich mit den fünf aktuell bedeutendsten bakteriellen Mastitiserregern. Es werden die Morphologie, kulturellen Eigenschaften, Pathogenese und Übertragung der Erreger sowie die Abwehrmechanismen des Euters und die Symptome der Krankheit beschrieben. Kapitel 4 widmet sich den prophylaktischen Maßnahmen zur Bekämpfung von Mastitiden. Hier werden verschiedene Aspekte des Melkmanagements, des Haltungsmanagements, des Fütterungsmanagements und des Trockenstellmanagements beleuchtet. Kapitel 5 beschreibt die Vorgehensweise bei der Bestandssanierung und der Einführung eines Eutergesundheitsprogrammes. Dazu gehören die Risikoanalyse im Bestand, die Definition der Sanierungsziele, die Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sowie die Überwachung der Eutergesundheit durch ein Monitoringprogramm. Kapitel 6 diskutiert die Bedeutung der prophylaktischen Bekämpfung von Mastitiden und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes im Eutergesundheitsmanagement.
Schlüsselwörter
Mastitis, Milchrind, Eutergesundheit, bakterielle Erreger, Streptokokken, Staphylokokken, Coliforme Bakterien, Pathogenese, Übertragung, Symptome, Behandlung, Prävention, Melkmanagement, Haltungsmanagement, Fütterungsmanagement, Trockenstellmanagement, Bestandssanierung, Eutergesundheitsmanagement, Monitoringprogramm.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Mastitis beim Milchrind?
Mastitis ist eine infektiöse Entzündung der Milchdrüse (Euter), die durch verschiedene bakterielle Erreger verursacht wird und eine der häufigsten Krankheiten in der Milchviehhaltung ist.
Welches sind die bedeutendsten Erreger der Mastitis?
Zu den wichtigsten bakteriellen Erregern zählen Streptokokken, Staphylokokken (wie Staphylococcus aureus) und coliforme Bakterien (wie E. coli).
Warum ist die Eutergesundheit ökonomisch so wichtig?
Mastitis führt zu hohen Verlusten durch geringere Milchmengen, Behandlungskosten, erhöhte Zellzahlen in der Milch und den vorzeitigen Abgang von Kühen aus dem Bestand.
Welche Rolle spielt die Melkhygiene bei der Vorbeugung?
Eine konsequente Melkroutine, saubere Melkzeuge und eine gute Melkarbeit sind entscheidend, um die Übertragung von Erregern während des Melkvorgangs zu verhindern.
Was umfasst ein Eutergesundheitsprogramm zur Bestandssanierung?
Ein solches Programm beinhaltet eine Risikoanalyse, die Definition von Sanierungszielen, die Optimierung von Haltung und Fütterung sowie ein kontinuierliches Monitoring der Zellzahlen.
- Quote paper
- B.Sc. Saskia Petzold (Author), 2012, Bakterielle Erreger der Mastitis beim Milchrind. Bedeutung und Maßnahmen der Bekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299802