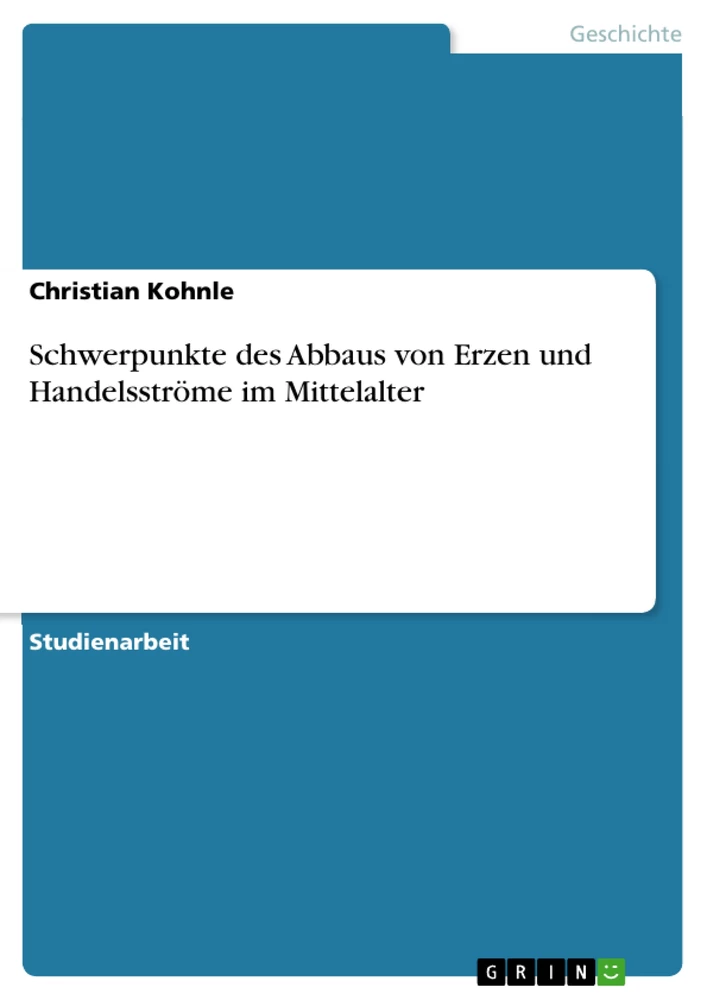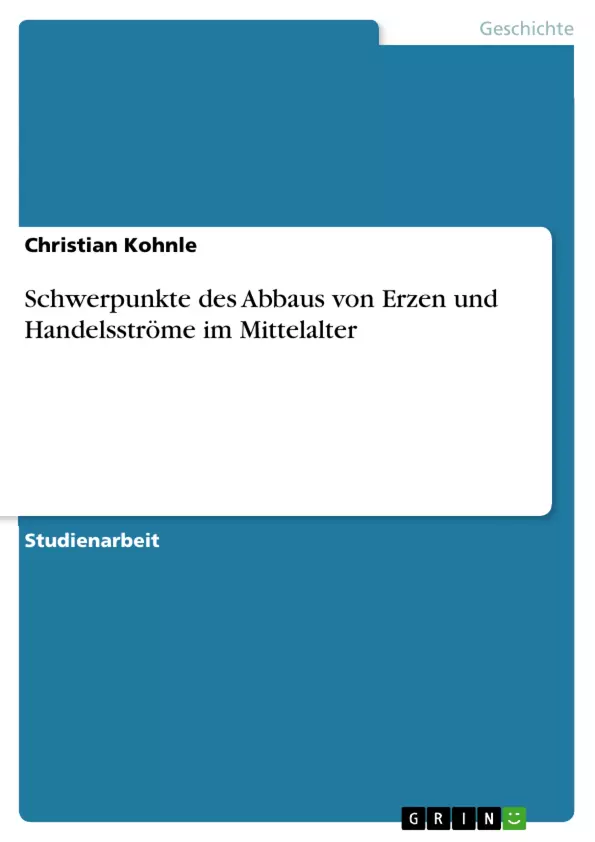Diese Arbeit beschreibt den Entwicklungsweg des Erzhandels von den Anfängen im Frühmittelalter bis hin in das Spätmittelalter, als die Augsburger Kaufmannsfamilien und allen voran die Familie Fugger, den Handel von Erzen beherrschten.
Der Aufstieg des Handels im Mittelalter legte den Grundstein für die folgende, immer weitergehende Entwicklung von Transportmitteln und Transportwegen. Der Weg hierhin, die verschiedenen Erze und Abbaugebiete sowie wichtige Akteure des Handels von Erzen im Mittelalter, werden in dieser Arbeit beleuchtet. Den Akteuren, wie der Hanse und der Kaufmannsfamilie Fugger, kommt hierbei innerhalb dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zu.
Die Anfänge des Abbaus von Erzen sowie deren Handel reichen weit in der Geschichte des Menschen zurück. Die vorliegende Arbeit setzt sich mit den Schwerpunkten des Abbaus von Erzen und deren Handelsströmen im Mittelalter auseinander.
Die Menschheit sieht sich seit jeher einer Knappheit von Gütern ausgesetzt. Da Ressourcen auf der Erde im Allgemeinen ungleich verteilt sind, entstand der Handel mit Gütern. Die Vorkommen von Erzen auf der Erde sind somit ebenfalls ungleich verteilt.
Im Mittelalter entwickelte sich der Handel mit Erzen zu Zeiten des Frühmittelalters, aus dem Abbau in bäuerlichen Kleinbetrieben heraus. Diese bauten Erze als Nebenerwerb ab. Erst im Hochmittelalter entstand der Handel von Erzen im größeren Rahmen, da durch die zahlreichen Städtegründungen neue Märkte entstanden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Thematik
- Vorgehensweise und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Zeitliche Abgrenzung
- Handelsgüter und Abbau
- Stätten des Bergbaus im Mittelalter
- Schwazer Silberbergwerk
- Ungarn
- Oberpfalz und Harz
- Schweden
- Handelsströme
- Entwicklung des Handels
- Transportwege
- Märkte
- Zölle
- Die Hanse
- Die Fugger
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Schwerpunkte des Abbaus von Erzen und deren Handelsströme im Mittelalter. Sie beleuchtet die Entwicklung des Erzhandels vom Frühmittelalter bis ins Spätmittelalter, wobei der Fokus auf den Einfluss von wichtigen Akteuren wie der Hanse und der Familie Fugger liegt.
- Die Entwicklung des Erzhandels im Mittelalter
- Die wichtigsten Abbaugebiete von Erzen in Europa
- Die Rolle von Transportwegen und Märkten im Erzhandel
- Die Bedeutung der Hanse und der Fugger für den Erzhandel
- Die Auswirkungen des Erzhandels auf die Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Erzhandels im Mittelalter ein und erläutert die Vorgehensweise sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die zeitliche Abgrenzung und die wichtigsten Handelsgüter sowie deren Abbaumethoden.
Kapitel zwei widmet sich den Abbaugebieten von Erzen im Mittelalter, darunter die Schwazer Bergwerke in Tirol, das Kupfer- und Silberbergwerk in Neusohl im damaligen Ungarn, die Eisen- und Silberbergwerke in der Oberpfalz und dem Harz sowie das Abbaugebiet in Falun, in Mittelschweden.
Kapitel drei beschreibt die Handelsströme im Mittelalter, wobei die Entwicklung des Handels im Allgemeinen und von Erzen im Besonderen dargestellt wird. Es werden die Transportwege, die Märkte und die Zölle des Erzhandels beleuchtet. Schließlich werden die Handelstätigkeiten der Hanse und der Familie Fugger als wichtige Akteure im Erzhandel im Mittelalter dargestellt.
Schlüsselwörter
Erzhandel, Mittelalter, Abbaugebiete, Transportwege, Märkte, Zölle, Hanse, Fugger, Schwazer Silberbergwerk, Neusohl, Oberpfalz, Harz, Falun.
Häufig gestellte Fragen
Wann begann der großflächige Handel mit Erzen im Mittelalter?
Während im Frühmittelalter bäuerliche Kleinbetriebe dominierten, entstand der großflächige Handel erst im Hochmittelalter durch die Gründung zahlreicher Städte und neuer Märkte.
Welche Rolle spielte die Familie Fugger im Erzhandel?
Die Fugger, insbesondere im Spätmittelalter, beherrschten den Handel mit Silber und Kupfer und finanzierten durch ihre Gewinne oft Kaiser und Könige.
Welche waren die bedeutendsten Bergbaustätten in Europa?
Zu den wichtigsten Stätten zählten das Schwazer Silberbergwerk (Tirol), Neusohl (Ungarn), der Harz und die Oberpfalz sowie Falun in Schweden.
Wie beeinflusste die Hanse den Metallhandel?
Die Hanse kontrollierte wichtige Handelswege in Nord- und Osteuropa und war maßgeblich am Transport und Vertrieb von Metallen beteiligt.
Welche Transportwege wurden für Erze genutzt?
Der Transport erfolgte über mühsame Landwege mit Karren sowie über Wasserwege (Flüsse und Meere), die kostengünstiger für schwere Lasten waren.
- Quote paper
- Christian Kohnle (Author), 2014, Schwerpunkte des Abbaus von Erzen und Handelsströme im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299872