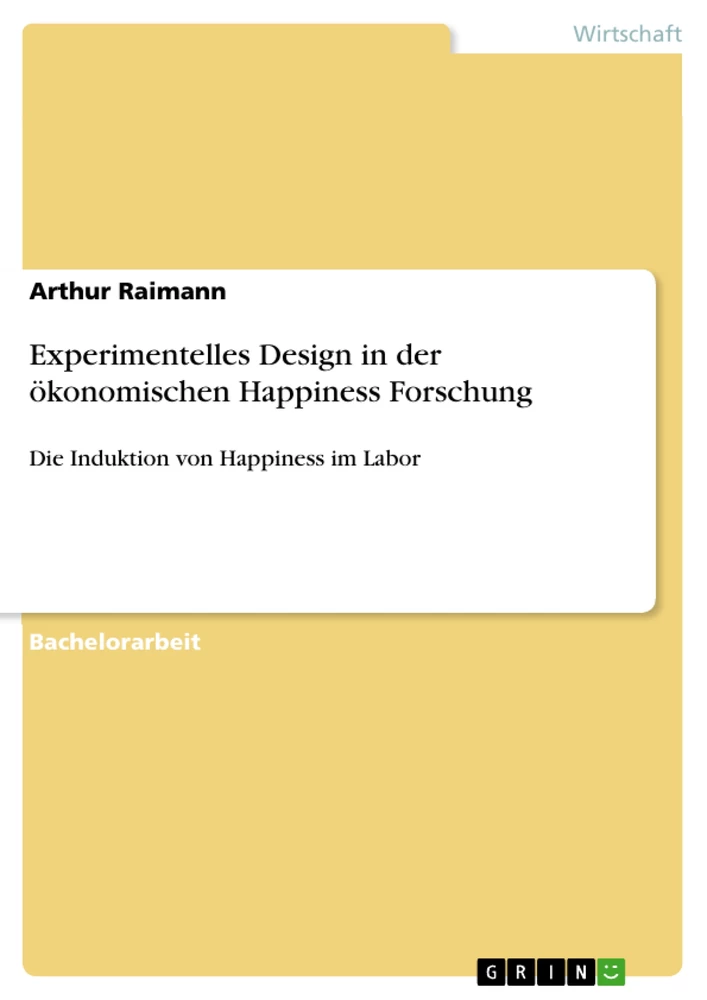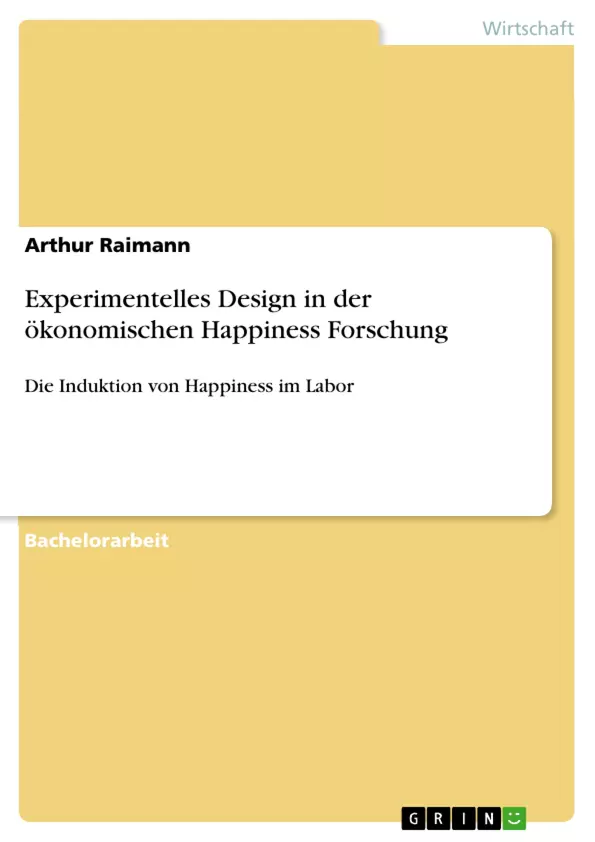Happiness bzw. Glück gilt im Allgemeinen als ein unumstößliches Lebensziel. Faktisch möchte jeder glücklich sein. Es spielt sich gegenwärtig eine enorme Entwicklung in der Ökonomie ab. In den letzten Jahren ist die Happiness-
Forschung auch zu einem wichtigen Thema in der Wirtschaftswissenschaft geworden. Dies kann überraschend erscheinen, da der Gegenstand der Wirtschaftswissenschaft das Wirtschaften des Materiellen ist. Die Ökonomie beschäftigte und beschäftigt sich auch heute noch hauptsächlich mit der Produktion und Verteilung von Gütern. In der Makroökonomik setzen sich die Ökonomen mit gesamtwirtschaftlichen Problemen auseinander (z.B.
Konjunkturablauf). Eine andere Situation herrscht in der Mikroökonomik, wo das Verhalten von Individuen als Konsumenten und Produzenten analysiert wird. Dabei verfolgen die Individuen eine Maximierung ihres eigenen Nutzens. Diese
individuelle Maximierung führt kausal zu einem größtmöglichen Nutzen für alle. Erst seit Ende der 1990er Jahre wurde die Frage nach dem Glück zu einem Thema in der Wirtschaftswissenschaft. Dafür gibt es zwei maßgebliche Gründe. Der erste ist, dass sich Menschen in bestimmten Situationen nicht rational verhalten. Sie unterliegen vielen Anomalien und verhalten sich kurzfristiger als sie eigentlich
wollen, was zu inkonsistentem Verhalten führt, oder sie sind nicht fähig richtig vorherzusagen welchen Nutzen ihnen bestimmte Güter in der Zukunft bringen werden. In den Bereichen, in denen die Anomalien vorkommen, macht der
herkömmliche Ansatz falsche Verhaltensprognosen. Der zweite Grund sind die großen Fortschritte der Sozialpsychologie in den letzten Jahren bezüglich der empirischen Erfassung des Glücks.
In der ökonomischen Happiness-Forschung geht es um Fragen, wie sich Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation, institutionelle Faktoren wie demokratische Entscheidungsprozesse und Einkommensunterschiede auf das
individuelle Wohlbefinden auswirken. Da die Happiness-Forschung sehr viel Potenzial in sich birgt, ist es wichtig
Methoden herauszuarbeiten, die es den Ökonomen erlauben, Happiness im Labor zu induzieren, um den ökonomischen Fragestellungen in einem neuem Blickwinkel begegnen zu können.
In dieser Bachelorarbeit, werde ich der Frage nachgehen, wie Happiness im Labor von Ökonomen induziert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau der Bachelorarbeit
- 2. Glück und positiver Affekt
- 2.1 Happiness in der Psychologie
- 2.1.1 Affekte in der Psychologie
- 2.2 Happiness in der Philosophie
- 2.3 Happiness und positiver Affekt in der Wirtschaftswissenschaft
- 3. Experimente in der Wirtschaftswissenschaft
- 4. Der Zusammenhang von Glück und relativen Auszahlungen
- 4.1 Das relative Einkommen
- 4.2 Die Adaption des Happiness
- 4.3 Ein weiteres Ergebnis bezüglich relativen Auszahlung
- 4.4 Fazit
- 5. Induktion von „Happiness“ bzw. „positiven Affekten“ im Labor
- 5.1 Affektinduktion im Labor durch Ökonomen: Verwendung von Videoclips
- 5.1.1 Verwendung von Videoclips I: Happiness und Produktivität
- 5.1.2 Verwendung von Videoclips II: Happiness und Zeitpräferenzen
- 5.2 Affektinduktion im Labor durch Ökonomen: Verwendung der Methode von Erfolg und Misserfolg
- 5.2.1 Verwendung der Methode von Erfolg und Misserfolg I: Risiko- und Zeitpräferenz unter der Induktion von Stimmungszuständen
- 5.2.2 Verwendung der Methode von Erfolg und Misserfolg II: Stimmungsgelenktes Verhalten in strategischen Interaktionen
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Induktion von Happiness im Labor im Kontext der ökonomischen Happiness-Forschung. Die Arbeit analysiert verschiedene experimentelle Designs und Methoden, die in der Wirtschaftswissenschaft verwendet werden, um positive Affekte zu induzieren und deren Auswirkungen auf ökonomisches Verhalten zu untersuchen.
- Experimentelle Designs zur Induktion von Happiness im Labor
- Der Einfluss von relativen Auszahlungen auf Happiness
- Die Rolle von positiven Affekten im ökonomischen Entscheidungsverhalten
- Anwendung verschiedener Methoden der Affektinduktion (Videoclips, Erfolg/Misserfolg)
- Zusammenhang zwischen Happiness, Risiko- und Zeitpräferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Forschungsfrage und die Methodik, die im weiteren Verlauf angewendet wird.
2. Glück und positiver Affekt: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es beleuchtet die Konzepte von Happiness und positiven Affekten aus psychologischer, philosophischer und wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive, um ein umfassendes Verständnis der verwendeten Konzepte zu schaffen und den theoretischen Rahmen für die empirischen Untersuchungen zu etablieren. Es werden verschiedene Definitionen und Messmethoden von Glück und positiven Affekten diskutiert und miteinander verglichen.
3. Experimente in der Wirtschaftswissenschaft: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Methoden und Ansätze experimenteller Forschung in der Wirtschaftswissenschaft, um den methodologischen Rahmen für die empirische Untersuchung in den folgenden Kapiteln zu schaffen. Es werden verschiedene experimentelle Designs und deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Induktion von positiven Affekten diskutiert.
4. Der Zusammenhang von Glück und relativen Auszahlungen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss relativer Einkommen und Auszahlungen auf das subjektive Glücksempfinden. Es werden verschiedene Theorien und empirische Befunde zu diesem Thema dargestellt und diskutiert, einschließlich der Adaption des Happiness an veränderte Einkommensverhältnisse und der Bedeutung relativer Vergleiche. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich relative Positionen im Vergleich zu anderen Personen auf das individuelle Glücksgefühl auswirken.
5. Induktion von „Happiness“ bzw. „positiven Affekten“ im Labor: Das zentrale Kapitel dieser Arbeit beschreibt detailliert verschiedene experimentelle Methoden, die zur Induktion von positiven Affekten im Labor verwendet werden. Es werden zwei Hauptansätze präsentiert: die Verwendung von Videoclips und die Induktion von Erfolgserlebnissen bzw. Misserfolgen. Für jede Methode werden konkrete Beispiele aus der Literatur angeführt und deren Eignung zur Affektinduktion bewertet. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse der jeweiligen Stärken und Schwächen der Methoden, sowie deren Anwendbarkeit in ökonomischen Experimenten.
Schlüsselwörter
Happiness, positiver Affekt, experimentelles Design, ökonomische Experimente, Affektinduktion, relative Einkommen, Zeitpräferenzen, Risikopräferenzen, Videoclips, Erfolg/Misserfolg, Psychologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Induktion von Happiness im Labor
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Induktion von Happiness (Glück) im Labor im Kontext der ökonomischen Happiness-Forschung. Sie analysiert verschiedene experimentelle Designs und Methoden, die in der Wirtschaftswissenschaft verwendet werden, um positive Affekte zu induzieren und deren Auswirkungen auf ökonomisches Verhalten zu untersuchen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf experimentelle Designs zur Induktion von Happiness, den Einfluss relativer Auszahlungen auf Happiness, die Rolle positiver Affekte im ökonomischen Entscheidungsverhalten, die Anwendung verschiedener Methoden der Affektinduktion (Videoclips, Erfolg/Misserfolg) und den Zusammenhang zwischen Happiness, Risiko- und Zeitpräferenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt den Aufbau. Kapitel 2 (Glück und positiver Affekt) legt die theoretischen Grundlagen aus psychologischer, philosophischer und wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive dar. Kapitel 3 (Experimente in der Wirtschaftswissenschaft) gibt einen Überblick über experimentelle Forschungsmethoden. Kapitel 4 (Zusammenhang von Glück und relativen Auszahlungen) untersucht den Einfluss relativer Einkommen auf das Glücksempfinden. Kapitel 5 (Induktion von „Happiness“ im Labor) beschreibt detailliert experimentelle Methoden zur Induktion positiver Affekte (Videoclips, Erfolg/Misserfolg). Kapitel 6 (Zusammenfassung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden der Affektinduktion werden untersucht?
Die Arbeit untersucht zwei Hauptansätze zur Induktion positiver Affekte im Labor: die Verwendung von Videoclips und die Induktion von Erfolgserlebnissen bzw. Misserfolgen. Die jeweiligen Vor- und Nachteile und die Anwendbarkeit in ökonomischen Experimenten werden kritisch analysiert.
Welche Rolle spielen relative Auszahlungen?
Die Arbeit untersucht den Einfluss relativer Einkommen und Auszahlungen auf das subjektive Glücksempfinden. Es werden Theorien und empirische Befunde zu diesem Thema dargestellt, einschließlich der Adaption des Happiness an veränderte Einkommensverhältnisse und der Bedeutung relativer Vergleiche.
Wie werden Happiness und positive Affekte definiert und gemessen?
Kapitel 2 diskutiert verschiedene Definitionen und Messmethoden von Glück und positiven Affekten aus psychologischer, philosophischer und wirtschaftswissenschaftlicher Sicht und vergleicht diese miteinander.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Happiness, positiver Affekt, experimentelles Design, ökonomische Experimente, Affektinduktion, relative Einkommen, Zeitpräferenzen, Risikopräferenzen, Videoclips, Erfolg/Misserfolg, Psychologie, Philosophie, Wirtschaftswissenschaft.
- Quote paper
- Arthur Raimann (Author), 2014, Experimentelles Design in der ökonomischen Happiness Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299888