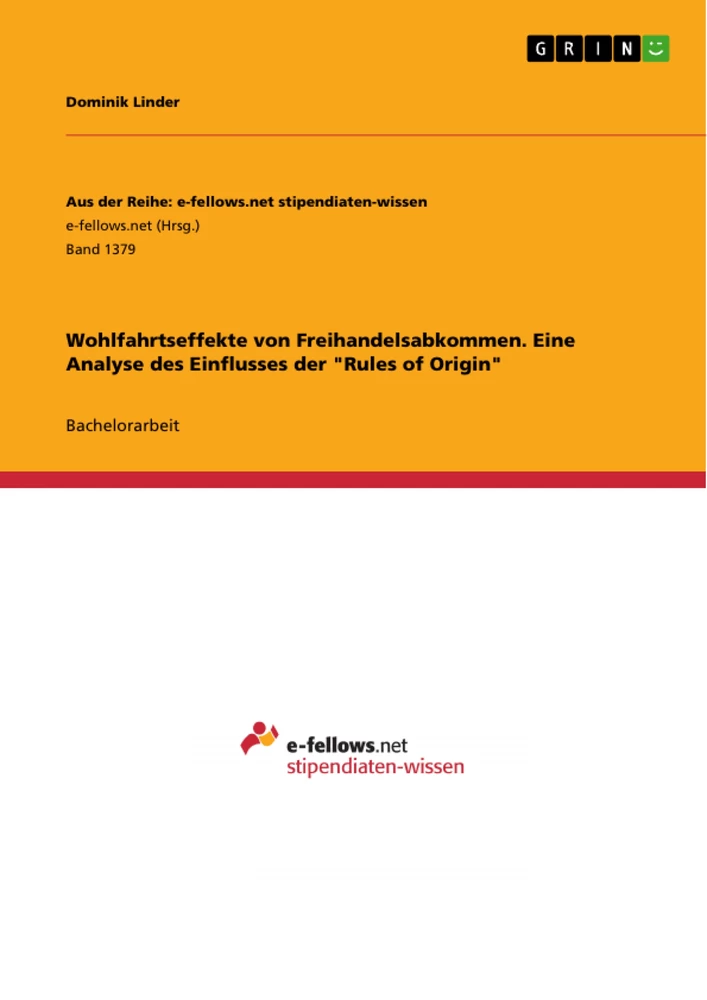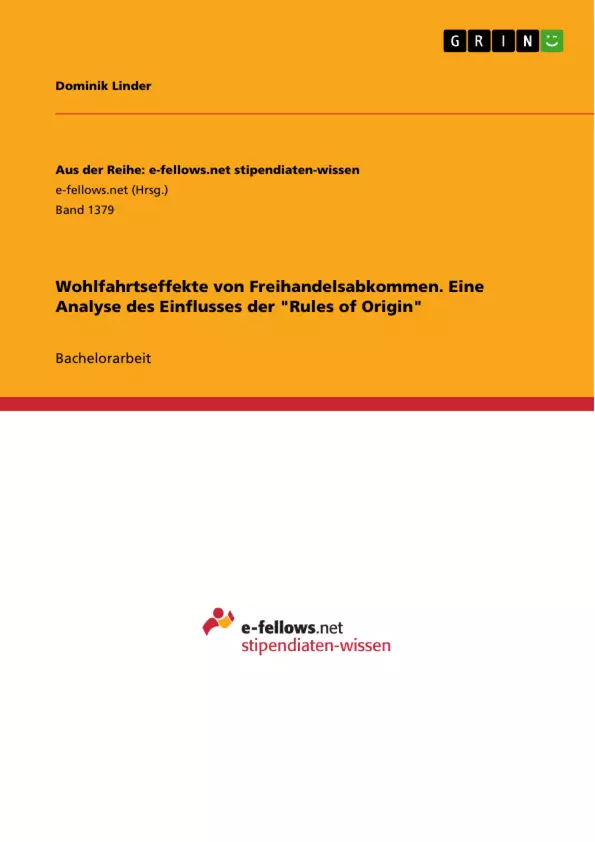Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Ursprungsregeln bei der Formierung von Freihandelsabkommen auf die Wohlfahrt der FTA-Partnerländer. Dazu wird eine komparativ statische Analyse der Auswirkungen der Formierung eines FTA mit und ohne ROO durchgeführt, wobei die Wohlfahrt der FTA- Partnerländer untersucht wird. Es zeigt sich, dass in einem FTA, in dem keine ROO verankert sind, der positive die negativen Wohlfahrtseffekte nur unter bestimmten Umständen übersteigt.
Der klassische „Trade Creation“-Effekt kann von dem negativen „Input Price“-Effekt und „Derived Demand“-Effekt überwogen werden. Bei der Untersuchung eines FTA mit ROO wird ebenso eine komparativ statische Analyse durchgeführt. Es wird dabei gezeigt, dass die Wohlfahrtseffekte abhängig sind von der Höhe des geforderten Anteils der „lokalen Wertschöpfung“ und von der Bemessungsgrundlage für die ROO. Außerdem ergeben sich Unterschiede zwischen einem Markt mit perfektem Wettbewerb und einer Monopolstellung. Abhängig von diesen Einflussfaktoren können sich FTAs mit ROO positiv oder negativ auf die Wohlfahrt eines Landes auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Freihandelsabkommen
- 2.1. Hintergrund
- 2.2. Formierung eines Freihandelsabkommens
- 2.3. Vergleich eines Freihandelsabkommen und einer Zollunion
- 3. Rules of Origin (ROO)
- 3.1. Hintergrund
- 3.2. Gründe für und gegen die Aufnahme von ROO in ein FTA
- 3.3. Arten der Bemessungsgrundlage für den LC
- 4. Wohlfahrtseffekte eines FTA ohne ROO
- 4.1. Modellaufbau
- 4.2. Auswirkungen auf die Importe
- 4.3. Wohlfahrtseffekte
- 5. Wohlfahrtseffekte eines FTA mit ROO
- 5.1. Model Outline
- 5.2. Wohlfahrtseffekte bei perfektem Wettbewerb
- 5.2.1. Kostenbasierte Bemessung
- 5.2.2. Preisbasierte Bemessung
- 5.3 Wohlfahrtseffekte bei einem ausländischem Monopol
- 5.3.1. Kostenbasierte Bemessung
- 5.3.2. Preisbasierte Bemessung
- 6. Modellvergleich zwischen einer FTA-Formierung mit und ohne ROO
- 7. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Ursprungsregeln (ROO) auf die Wohlfahrt der Partnerländer in Freihandelsabkommen (FTA). Sie analysiert, wie sich die Einführung von ROO auf die Handelsströme und das Wohlfahrtsniveau der beteiligten Länder auswirkt.
- Der Einfluss von Ursprungsregeln auf die Handelsströme
- Die Auswirkungen von ROO auf die Wohlfahrt der FTA-Partnerländer
- Die Rolle von "Trade Creation" und "Trade Diversion" bei der Beurteilung der Wohlfahrtseffekte
- Die Bedeutung der Bemessungsgrundlage für die ROO
- Der Vergleich von FTAs mit und ohne ROO
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Wohlfahrtseffekte von Freihandelsabkommen ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar. Kapitel 2 erläutert die Funktionsweise von Freihandelsabkommen und geht auf die Bedeutung von Ursprungsregeln ein. Kapitel 3 analysiert die verschiedenen Arten von Ursprungsregeln und die Gründe für ihre Verwendung in Freihandelsabkommen. Kapitel 4 untersucht die Wohlfahrtseffekte eines FTA ohne ROO, wobei ein Modell zur Analyse der Auswirkungen auf Importe und Wohlfahrt entwickelt wird. Kapitel 5 analysiert die Wohlfahrtseffekte eines FTA mit ROO unter verschiedenen Szenarien, wie z.B. perfekter Wettbewerb und Monopolstellung. Kapitel 6 vergleicht die Ergebnisse der Modelle aus den Kapiteln 4 und 5 und diskutiert die Unterschiede in den Wohlfahrtseffekten. Kapitel 7 bietet eine kritische Würdigung der Ergebnisse und beleuchtet die Limitationen der Untersuchung.
Schlüsselwörter
Freihandelsabkommen, Ursprungsregeln, Wohlfahrtseffekte, Trade Creation, Trade Diversion, Input Price Effekt, Derived Demand Effekt, Local Content, Kostenbasierte Bemessung, Preisbasierte Bemessung, Perfekter Wettbewerb, Monopol, FTA-Partnerländer
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Rules of Origin" (ROO)?
Ursprungsregeln legen fest, ab wann ein Produkt als "einheimisch" in einem Partnerland eines Freihandelsabkommens gilt, um Zollvorteile zu erhalten.
Wie beeinflussen Ursprungsregeln die Wohlfahrt?
Die Effekte hängen von der Höhe der geforderten lokalen Wertschöpfung ab; sie können positiv durch "Trade Creation" oder negativ durch "Input Price"-Effekte wirken.
Was ist der Unterschied zwischen Trade Creation und Trade Diversion?
Trade Creation bezeichnet neuen Handel zwischen Partnern, während Trade Diversion den Ersatz effizienterer Importe aus Drittländern durch weniger effiziente Importe aus Partnerländern beschreibt.
Welche Rolle spielt die Marktform für die ROO-Wirkung?
Die Arbeit zeigt Unterschiede in den Wohlfahrtseffekten zwischen Märkten mit perfektem Wettbewerb und solchen mit einer Monopolstellung auf.
Warum werden ROO in Freihandelsabkommen aufgenommen?
Sie dienen dazu, den Missbrauch von Zollvorteilen durch Drittländer zu verhindern, können aber auch als protektionistisches Instrument wirken.
- Citar trabajo
- Dominik Linder (Autor), 2014, Wohlfahrtseffekte von Freihandelsabkommen. Eine Analyse des Einflusses der "Rules of Origin", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299968