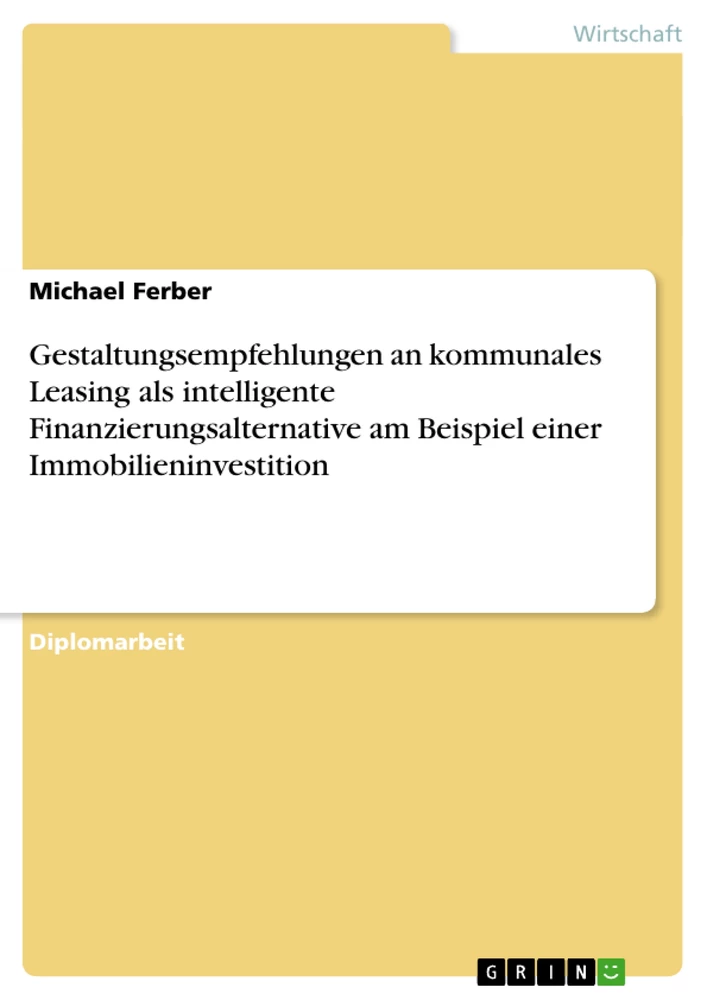rt
„2003 wird ein Schicksalsjahr für die Städte2“, so betonte die amtierende Präsidentin des Deutsche Städtetags, die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth anlässlich des Jahreswechsels 2002/ 2003.
So seien nach einer Reihe von Jahren mit finanziell unbefriedigenden Ergebnissen, die in den „Katastrophenjahren“3 2001 und 2002 gipfelten, so Roth weiter, die Kommunalhaushalte in eine Besorgnis erregende Schieflage geraten. Gründe hierfür seien in den sinkenden Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte zu sehen, die seit dem Ende der 1990er Jahre im Zuge der schwachen weltwirtschaftlichen Konjunktur beständig abnahmen.
So hätten beispielsweise kommunale Kassenkredite, eigentlich zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe gedacht, im Jahr 2002 eine Höhe von über 11 Milliarden Euro erreicht, im Vergleich zu 0,5 Milliarden Euro noch vor zehn Jahren. In Anbetracht dessen könnten auch kurzfristige Insolvenzen von Städten nicht ausgeschlossen werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Dr. Stephan Articus führte weiterhin aus, dass bereits eine geringe Zinserhöhung bei den derzeit verhältnismäßig billigen Kassenkrediten dann zur Zahlungsunfähigkeit führen würde.
Sinkenden Steuereinnahmen und in der Folge wachsenden und immer weiter ausgereizten Kreditaufnahmen auf der einen Seite stehen aber beständig steigende Anforderungen der Politik gegenüber, die den Spielraum für dringend nötige öffentliche Investitionen immer weiter einengen. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im Jahr 2002, als die Bundesrepublik die Stabilitätsrichtlinien, die im Vertrag von Maastricht im Dezember 1991 beschlossen wurden, mit einem Haushaltsdefizit von 3,7 Prozent deutlich verfehlte. Genauso wie die Stabilitätsbedingungen im Maastrichtvertrag wurde auch der im Grundgesetz vorgegebene Kernsatz, wonach die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht überschreiten dürfen, im Jahr 2002 verletzt. Finanzminister Eichel sah sich sogar gezwungen, wollte er sich nicht dem Vorwurf des Verfassungsbruchs aussetzen, eine „Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts“ erklären.
Die gewaltigen Herausforderungen, die seit und mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 auf die Haushalte zugekommen sind, haben Überlegungen intensiviert, öffentliche Investitionen mit Hilfe privater Finanzierungsinstrumente zu realisieren, bzw. darüber hinaus auch öffentliche Aufgaben an Private zu vergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Kommunale Finanzierungsmöglichkeiten
- Situation der kommunalen Haushalte
- Aktuelle Lage, Ursachen, Auswirkungen
- Möglichkeiten für Investitionen trotz knapper Kassen
- Ausblick und Prognosen
- Finanzierungsalternativen für kommunale Haushalte
- Begriffe, Definitionen
- Kreditkauf/ Eigenbau
- Leasing
- Miete
- Mietkauf
- Abgrenzungen
- Private Vorfinanzierung vs. Leasing
- Mobilien- vs. Immobilienleasing und Finanzierungs- vs. Operate Leasing
- Zusammenfassung
- Begriffe, Definitionen
- Situation der kommunalen Haushalte
- Leasing im Überblick
- Vollamortisationsvertrag (Full-Pay-Out-Vertrag)
- Teilamortisationsvertrag (Non-Pay-Out-Vertrag)
- Teilamortisationsvertrag mit Andienungsrecht des Leasinggebers
- Teilamortisationsverträge mit Mehr- oder Mindererlösbeteiligung
- Teilamortisationsverträge mit Restwertrisiko beim Leasinggeber
- Kündbare Teilamortisationsverträge
- Teilamortisationsverträge im Immobilienleasing
- Teilamortisationsvertrag im eigentlichen Sinne
- Mieterdarlehensverträge
- Steuerrelevante Betrachtung der Zuordnung zum Leasinggeber
- Steuerliche Zuordnung bei Vollamortisationsverträgen im Immobilienleasing
- Steuerliche Zuordnung bei Teilamortisationsverträgen im Immobilienleasing
- Zusammensetzung der Leasingraten
- Leasingraten bei Vollamortisationsverträgen im Immobilienleasing
- Leasingraten bei Teilamortisationsverträgen
- Besonderheiten der Vertragsabwicklung
- Gründung von Objektgesellschaften
- Objektgesellschaft ohne Beteiligung des Leasingnehmers
- Objektgesellschaft mit Beteiligung des Leasingnehmers
- Erwerb des Leasingobjekts
- Erwerb des Grundstücks
- Kauf bzw. Neuerstellung von Gebäuden
- Gründung von Objektgesellschaften
- Refinanzierungsmöglichkeiten von Leasingverträgen
- Darlehensfinanzierung
- Forfaitierung
- Finanzierung über Leasingfonds
- Leistungen des Leasinggebers - Leasinggeber als „,Full-Service-Provider”
- Full-Service-Leasing im Überblick
- Full-Service-Leasing im Immobilienbereich
- Leistungen im Zusammenhang mit der Grundstücksbeschaffung
- Leistungen im Zusammenhang mit der Objekterstellung
- Leistungen währen der Vertragslaufzeit
- Leistungen und Verpflichtungen des Leasingnehmers
- Leasingraten
- Sonderzahlungen des Leasingnehmers
- Leistungen bei Vertragsende
- Mietnebenkosten
- Mieterdarlehenszahlungen
- Vormieten
- Zusammenfassung
- Leasing und Haushaltsrecht
- Haushaltsgrundsätze
- Veranschlagungen im kommunalen Haushalt
- Realisierung des kommunalen Immobilienleasing
- Wirtschaftliche und rechtliche Voraussetzungen für Leasinggeschäfte
- Objektbezogene Voraussetzungen
- Leasingfähige Objekte
- Voraussetzungen für Leasingfähigkeit
- Spezialleasing als Hindernis für Generierung steuerlicher Vorteile
- Verschuldungsspielraum und Verschuldungsgrenzen
- Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft – Umgehung verfassungsrechtlicher Verschuldungsgrenzen
- Staatliche Förderung und Zuschüsse
- Gewährung von Landeszuschüssen
- Gewährung von Bundeszuschüssen
- EU-Zuschüsse
- Zusammenfassung
- Wirtschaftlichkeit der Leasingfinanzierung
- Vor- und Nachteile des Leasings
- Quantitative, monetäre Aspekte
- Effekte auf die Liquiditätssituation
- Steuereffekte
- Sonstige quantitative Aspekte
- Qualitative Aspekte
- Bonität der Finanzierungspartner
- Investitions- und Eigentumsrisiko
- ,,Pay-as-you-use\"-Effekt
- Nichtbelastung des Vermögenshaushalts
- Sonstige Aspekte
- Quantitative, monetäre Aspekte
- Gestaltungsempfehlungen für wirtschaftliche Leasingverträge
- Zusammenfassung
- Vor- und Nachteile des Leasings
- Innovative Organisationsformen der öffentlichen Hand - Leasing und leasingähnliche Gestaltungen
- Neue Wege kommunaler Leistungserstellung
- Bedürfnislage der öffentlichen Hand
- Gesellschaftsrechtliche Fragen und Risikoaspekte
- Zusammenstellung der Projektbeteiligten
- Finanzierungselemente
- Private Projektfinanzierung bei öffentlichen Aufgaben
- Qualitative und formale Betrachtung ausgewählte Organisationsmodelle mit Leasing oder leasingsähnlichen Konstruktionen
- Kommunalkredit
- Die Gebietskörperschaft investiert und betreibt selbständig
- Die kommunale Anlage wird durch einen privaten Investor betrieben
- Leasingmodell
- Betreibermodell
- Das Fondsmodell als Sonderfall
- Zusammenfassung
- Kommunalkredit
- Berechnung der Vorteilhaftigkeit einer Leasingfinanzierung am Modell
- Annahmen
- Nomenklatur
- Modellanalyse
- Kalkulationszins
- Barwertbetrachtung aus Sicht der Kommune
- Barwertberechnung aus Sicht des privatwirtschaftlichen Leasinggebers
- Vorteilhaftigkeitsbedingung für den kommunalen Leasingnehmer
- Konklusion und wirtschaftliche Bewertung
- Beispiel zur Verdeutlichung
- Zusammenfassung
- Zusammenfassung der Arbeit
- Neue Wege kommunaler Leistungserstellung
- Herausforderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft
- Leasing als Finanzierungsalternative
- Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für kommunales Leasing
- Gestaltungsempfehlungen für Leasingverträge
- Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Leasingmodellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Finanzierungsalternative „kommunales Leasing“. Im Fokus steht die Gestaltungsempfehlung des Leasings im Rahmen einer Immobilieninvestition. Die Arbeit analysiert dabei die Herausforderungen der kommunalen Haushaltswirtschaft und untersucht, wie sich die Anwendung von Leasingmodellen als Instrument zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und zur Optimierung der Finanzierungsstruktur einsetzen lässt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort beleuchtet die angespannte Finanzsituation der Kommunen und die Bedeutung alternativer Finanzierungsformen. Kapitel 2 behandelt die unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten für Kommunen und definiert die zentralen Begriffe des Leasings. Kapitel 3 geht auf die verschiedenen Leasingmodelle ein, insbesondere auf Vollamortisations- und Teilamortisationsverträge. Dabei werden steuerliche Aspekte und die Vertragsabwicklung beleuchtet. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen von Leasing im kommunalen Haushaltsrecht. Kapitel 5 analysiert die Wirtschaftlichkeit von Leasingfinanzierungen, indem es quantitative und qualitative Aspekte der Finanzierungsform betrachtet. Kapitel 6 stellt verschiedene innovative Organisationsformen vor, die mit Leasing oder leasingsähnlichen Konstruktionen kombiniert werden können. Das Kapitel schließt mit einer Analyse der Vorteilhaftigkeit von Leasingmodellen.
Schlüsselwörter
Kommunales Leasing, Finanzierungsalternative, Immobilienleasing, Haushaltswirtschaft, Wirtschaftlichkeit, rechtliche Rahmenbedingungen, Steuerliche Aspekte, Innovative Organisationsformen, Projektfinanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist kommunales Immobilienleasing?
Es ist eine Finanzierungsalternative, bei der eine Kommune eine Immobilie von einem privaten Geber least, anstatt sie durch klassische Kredite selbst zu bauen und zu finanzieren.
Warum nutzen Kommunen Leasing trotz knapper Kassen?
Leasing ermöglicht Investitionen ohne direkte Belastung des Vermögenshaushalts und kann helfen, verfassungsrechtliche Verschuldungsgrenzen zu umgehen.
Was ist der Unterschied zwischen Voll- und Teilamortisation?
Bei Vollamortisation decken die Raten die gesamten Kosten des Gebers, bei Teilamortisation bleibt ein Restwert, der am Ende der Laufzeit verrechnet wird.
Was versteht man unter „Full-Service-Leasing“ bei Immobilien?
Der Leasinggeber übernimmt neben der Finanzierung auch Leistungen wie Grundstücksbeschaffung, Bauleitung und Instandhaltung während der Vertragslaufzeit.
Welche Rolle spielt das Haushaltsrecht beim kommunalen Leasing?
Leasingverträge müssen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen und bedürfen oft der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.
- Arbeit zitieren
- Michael Ferber (Autor:in), 2003, Gestaltungsempfehlungen an kommunales Leasing als intelligente Finanzierungsalternative am Beispiel einer Immobilieninvestition, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30005