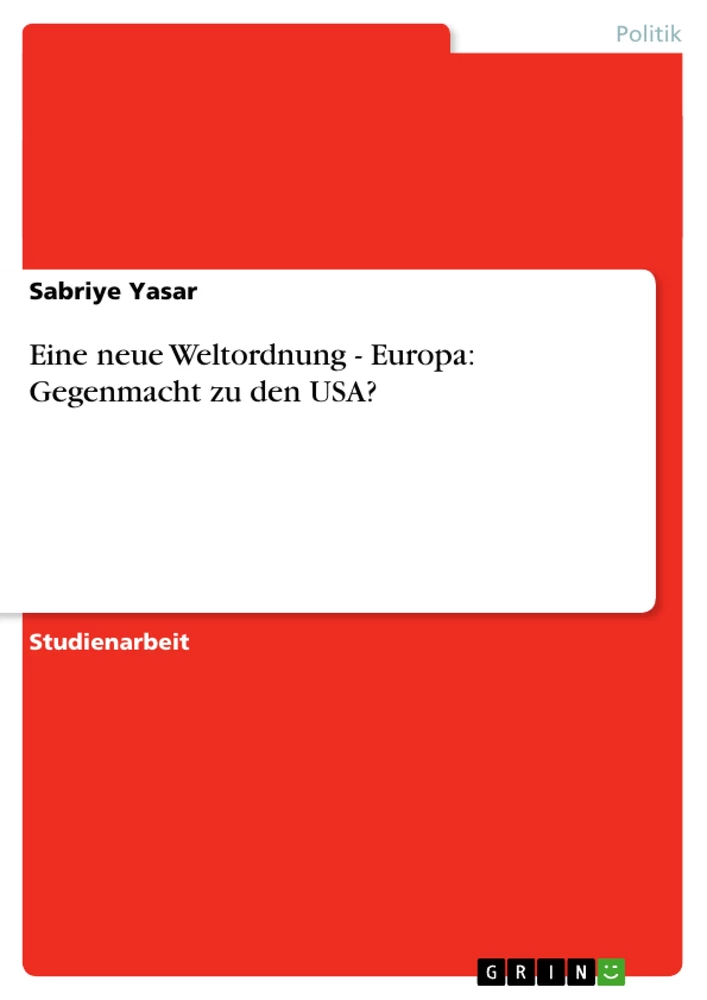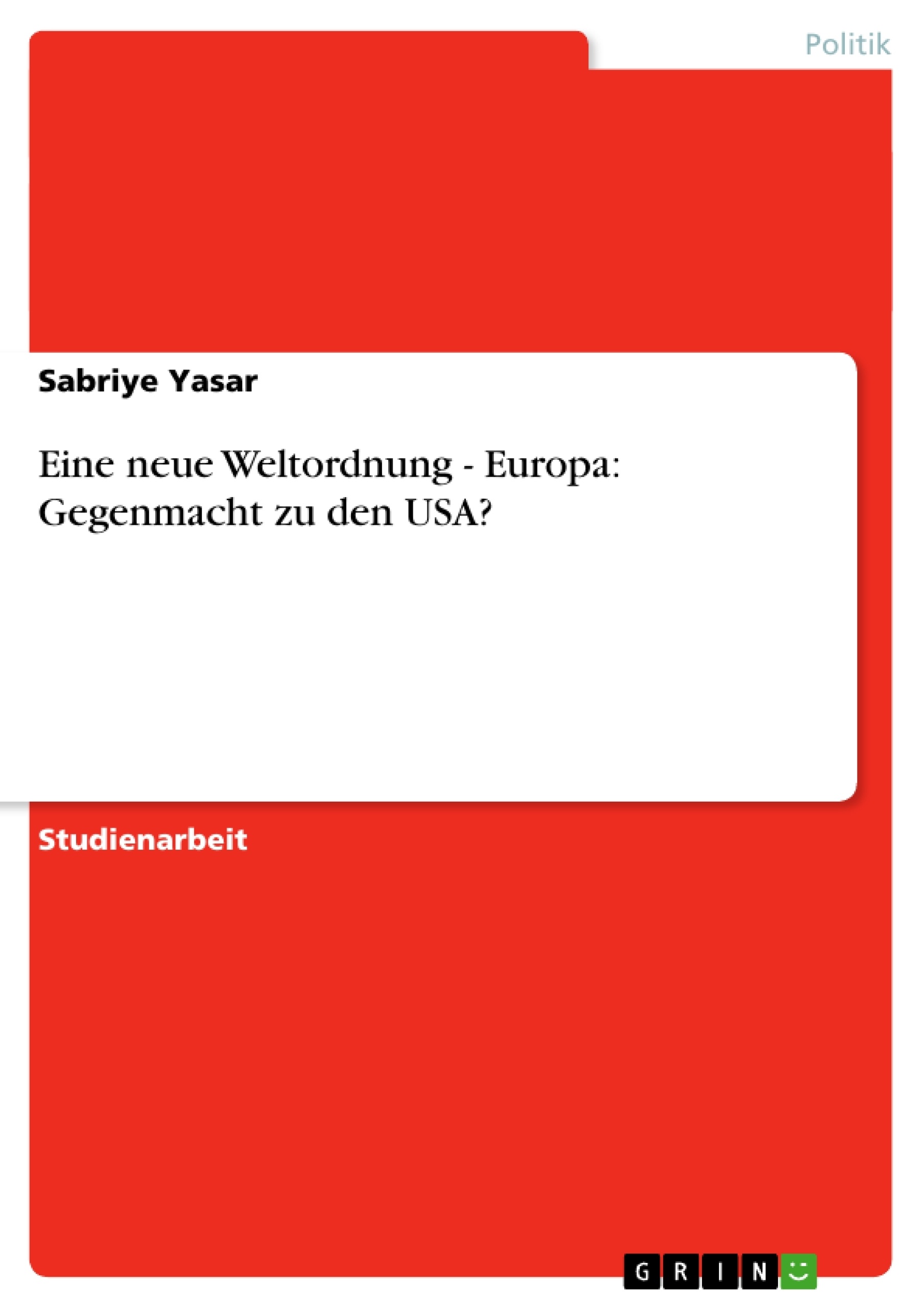Dan Diner beschreibt in „Verkehrte Welten“, dass amerikafeindliche Gesinnungen schon immer vorhanden gewesen wären. In Zeiten des großen geschichtlichen Umbruchs und der Krisen stellt er eine Verstärkung „amerikafeindlicher Ressentiments“ fest.
Ein Ereignis, das zu einer Verstärkung geführt habe, sei der Vietnamkrieg.
Den USA wurden Imperialismus, Skrupellosigkeit und Heuchlerei vorgeworfen.
Zur Zeit der Nato Nachrüstungsdebatte in den frühen achtziger Jahren tauchten diese Vorwürfe wieder auf.
Auf der internationalen Ebene galt Amerika als Schutzherr und Bewahrer von Frieden auf der Welt.
Dieses, schon fast selbstverständliche Paradigma der internationalen Politik, erfährt in den aktuellen Ereignissen seine Widerlegung, denn die Bush – Regierung tritt nun als Verursacher von Konflikten auf. Amerika habe sich von einer „den Frieden schützenden zu einer räuberischen Macht“ entwickelt.
Im Verlauf des Angriffs auf Afghanistan und dem Krieg gegen Irak wird die als selbstverständlich geltende Macht Amerikas öffentlich in Frage gestellt. Diese große Ablehnung hat zwar nicht den Krieg verhindert, aber eine Diskussion darüber in Gang gesetzt, die den Machtanspruch der USA bezweifelt und teilweise sogar ablehnt. Die selbsternannte „Weltpolizei“ Amerika wird stark kritisiert, seine Position im internationalen Machtgefüge in Frage gestellt.
In dieser Arbeit soll es in erster Linie um den strategischen Akteur Europa gehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zerfall der USA
- 2.1 Bestandsaufnahmen
- 2.1.1 Der Irak
- 2.1.2 Deutschland und Frankreich
- 3. Von der Nützlichkeit zur Überflüssigkeit
- 3.1 Die Fixierung auf den Islam
- 4. Europas Beitrag
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem aktuellen politischen und strategischen Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Der Fokus liegt auf der Frage, ob Europa eine Gegenmacht zu den USA darstellen kann, insbesondere im Kontext des „Zerfalls“ der USA, wie ihn Emmanuel Todd beschreibt.
- Der Zerfall der USA nach Emmanuel Todd
- Die Bedeutung von „Freund-Feind-Bildern“ in der amerikanischen Außenpolitik
- Die Rolle des Irak im Kontext der amerikanischen Machtpolitik
- Europas Position und Rolle in der internationalen Ordnung
- Die Frage der „Überflüssigkeit“ Amerikas im Kontext globaler Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Kontext von „Amerikafeindlichkeit“ und der Kritik an der US-amerikanischen Machtpolitik dar. Sie führt die These von Dan Diner ein, die auf eine Verstärkung von „amerikafeindlichen Ressentiments“ in Zeiten des Umbruchs verweist.
- Zerfall der USA: Dieses Kapitel beleuchtet die Theorie des französischen Soziologen Emmanuel Todd, der den Zerfall der USA prognostiziert. Dabei wird auf die These eingegangen, dass die USA ihre demokratischen Züge verliert, während die Welt gleichzeitig eine zunehmende Demokratisierung erfährt.
- Bestandsaufnahmen: Dieser Abschnitt beleuchtet die „Freund-Feind-Bilder“, die sich in der amerikanischen Politik nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entwickelt haben. Der Irak und die Reaktion der USA auf den Irak-Krieg dienen dabei als Beispiel.
- Von der Nützlichkeit zur Überflüssigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet die zunehmende Kritik an der amerikanischen Außenpolitik und die Frage, ob die USA im Kontext globaler Herausforderungen tatsächlich noch ein notwendiger Akteur ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Begriffe und Konzepte wie „Antiamerikanismus“, „Zerfall der USA“, „Freund-Feind-Bilder“, „Irak-Krieg“, „Weltordnung“, „Machtpolitik“, „Demokratisierung“, „Europa“, „Gegenmacht“, „Überflüssigkeit“ und „transnationaler Terrorismus“. Sie greift auf Theorien und Analysen von Emmanuel Todd und Dan Diner zurück, um das Verhältnis zwischen den USA und Europa im aktuellen geopolitischen Kontext zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Kann Europa eine Gegenmacht zu den USA darstellen?
Die Arbeit untersucht, ob Europa durch eine eigenständige strategische Rolle ein Gegengewicht zum Machtanspruch der USA bilden kann.
Was besagt die Theorie von Emmanuel Todd zum 'Zerfall der USA'?
Todd prognostiziert einen Niedergang der USA, da sie ihre demokratischen Werte verlieren, während der Rest der Welt sich zunehmend demokratisiert.
Wie hat der Irak-Krieg das Bild der USA verändert?
Die USA wurden zunehmend als 'räuberische Macht' statt als Friedensbewahrer wahrgenommen, was weltweit Diskussionen über ihren Machtanspruch auslöste.
Welche Rolle spielen 'Freund-Feind-Bilder' in der US-Außenpolitik?
Nach 9/11 nutzte die US-Regierung diese Bilder massiv zur Legitimation militärischer Interventionen, was insbesondere in Europa (Deutschland/Frankreich) kritisiert wurde.
Was versteht Dan Diner unter 'amerikafeindlichen Ressentiments'?
Diner stellt fest, dass Kritik an den USA oft in Krisenzeiten und bei großen geschichtlichen Umbrüchen (wie dem Vietnamkrieg) verstärkt auftritt.
- Quote paper
- Sabriye Yasar (Author), 2003, Eine neue Weltordnung - Europa: Gegenmacht zu den USA?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30007