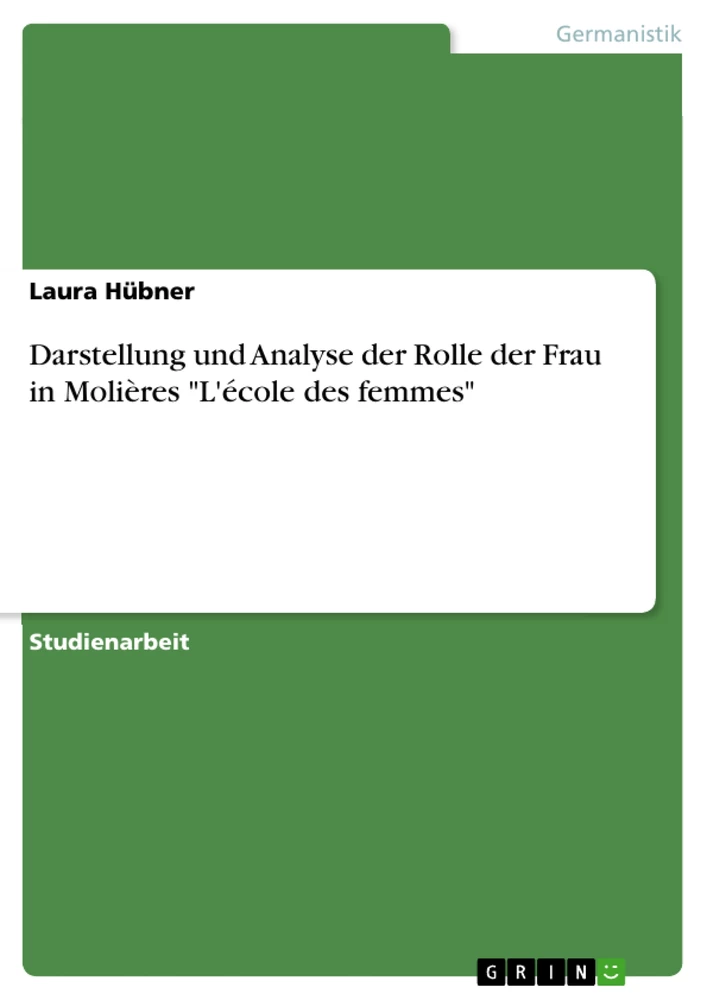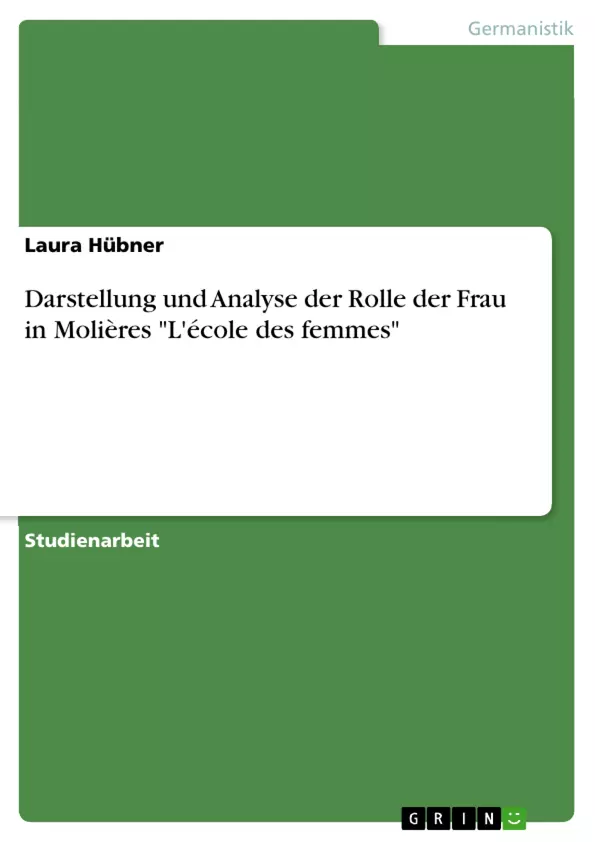Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Darstellung der Agnès im Stück „Die Schule der Frauen“ und den Hintergrund ihres Erziehungsmodells, welcher nach einem ganz bestimmten weiblichen Rollenideal funktionieren sollte, zu analysieren. Desweiteren wird ein chronologischer Überblick über die Entwicklung bzw. Emanzipation der Agnès während der Geschichte präsentiert. Außerdem wird die molièrsche Intention zum Schreiben einer Verskomödie mit diesem doch recht gesellschaftskritischen Inhalt hinterfragt.
Bevor die Rolle der Agnès jedoch detailliert beschrieben und plausibel analysiert werden kann, soll zum besseren Verständnis zunächst eine Inhaltsangabe des Theaterstücks «Die Schule der Frauen» erfolgen und im Anschluss daran möchte ich die Stellung der Frau im 17. Jahrhundert in Frankreich, also den historischen Hintergrund darlegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motive zum Anfertigen dieser Hausarbeit
- Kurze Erläuterung und Einbettung des Werkes
- Inhaltsangabe des Werkes „L'école des femmes“
- Die Stellung der Frau im 17. Jahrhundert
- Patriarchalismus und Vorurteile gegenüber Weiblichkeit
- Die Legitimation der Ungleichheit der Geschlechter durch die Kirche
- Erziehungs- und Bildungsideal junger Mädchen und Frauen
- Frühaufklärung und Salonkultur
- Darstellung und Analyse der Agnès
- Ausgangssituation
- Entwicklung bzw. Emanzipation der Agnès
- Hintergrund zur Entstehung der Komödie
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Rolle der Frau in Molières „L'école des femmes“ und untersucht die damit verbundenen gesellschaftlichen und pädagogischen Aspekte des 17. Jahrhunderts.
- Die Darstellung der Agnès als Symbol für das weibliche Ideal der Zeit
- Die Kritik an den traditionellen Erziehungsmethoden und Geschlechterrollen
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema der weiblichen Bildung und Emanzipation
- Die Einbettung der Komödie in den historischen Kontext des 17. Jahrhunderts
- Die Analyse der Intentionen Molières in Bezug auf die Darstellung der Frau und die Kritik an der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Motive der Verfasserin für die Hausarbeit und gibt einen kurzen Überblick über das Werk „L'école des femmes“. Im zweiten Kapitel wird eine Inhaltsangabe des Stückes präsentiert. Das dritte Kapitel widmet sich der Stellung der Frau im 17. Jahrhundert, wobei die Themen des Patriarchalismus, der kirchlichen Legitimation der Ungleichheit, der Erziehungsideale und der Salonkultur beleuchtet werden. Das vierte Kapitel analysiert die Darstellung und Entwicklung der Agnès im Stück. Schließlich beleuchtet das Kapitel fünf den Hintergrund zur Entstehung der Komödie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der weiblichen Rolle im 17. Jahrhundert, der Kritik an traditionellen Erziehungsmethoden, der Darstellung der Frau in der Literatur, der französischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, der Komödie als literarische Gattung und der Intentionen Molières.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Figur Agnès in Molières „Die Schule der Frauen“?
Agnès wird zunächst als naives, abgeschirmtes Mädchen dargestellt, das nach einem strengen patriarchalen Ideal erzogen wurde, sich aber im Laufe des Stücks emanzipiert.
Wie war die Stellung der Frau im Frankreich des 17. Jahrhunderts?
Die Gesellschaft war stark patriarchalisch geprägt; Frauen hatten kaum Rechte und ihre Bildung wurde oft auf religiöse und hauswirtschaftliche Aspekte begrenzt.
Was kritisiert Molière an den damaligen Erziehungsmethoden?
Molière kritisiert den Versuch, Frauen durch Unwissenheit und Isolation tugendhaft zu halten, und zeigt, dass wahre Klugheit und Liebe sich nicht unterdrücken lassen.
Welche Bedeutung hatte die Kirche für das Frauenbild der Zeit?
Die Kirche legitimierte oft die Unterordnung der Frau unter den Mann und beeinflusste maßgeblich die Erziehungsideale für junge Mädchen.
Was ist die „Schule der Frauen“ im übertragenen Sinne?
Es ist eine ironische Bezeichnung für die Lebenserfahrung und die natürliche Intelligenz, die Frauen trotz (oder wegen) der männlichen Unterdrückungsversuche entwickeln.
- Quote paper
- Laura Hübner (Author), 2014, Darstellung und Analyse der Rolle der Frau in Molières "L'école des femmes", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300212