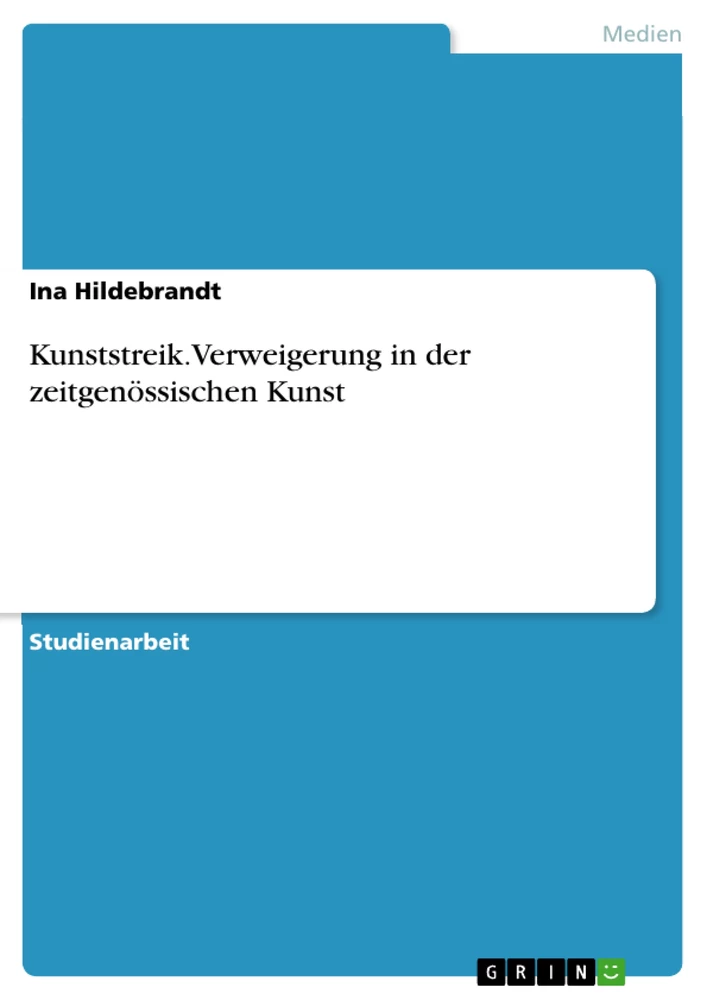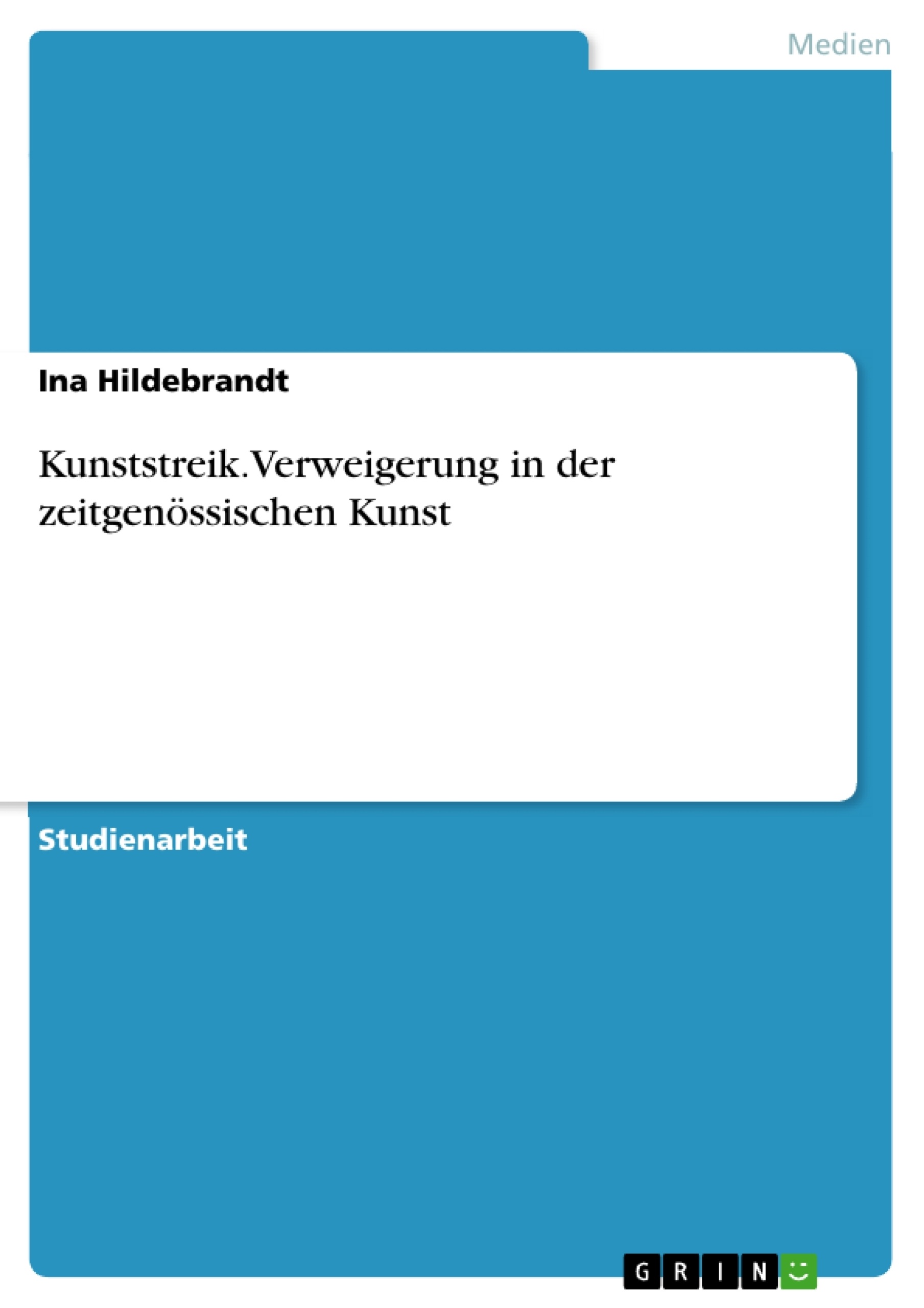„Was wäre jedoch, wenn das Nicht(s)tun zu einer Quelle produktiver Verweigerung würde?“ fragt man im Booklet zur Ausstellung "Neue Wege ins Nichtstun", die 2014 in Wien stattfand.
Der Rückgriff auf die Verweigerung und ihr Potenzial in der zeitgenössischen Kunst, die stetig von neoliberalen Produktionsstrukturen ergriffen wird, fußt geradezu auf einer 'Tradition der Verweigerer'. Indem sie sich den bestehenden ästhetischen Normen, der Anbiederung an den Kunstmarkte oder dem Innovationsdruck verweigern, kämpfen politisch engagierte Künstler seit jeher gegen den Kunstbetrieb oder soziale Missstände an. Sie schreiben Manifeste oder führen Protestaktionen durch, alleine oder im Kollektiv. Andere wenden sich ganz von der Kunst ab.
Zum Repertoire der künstlerischen Verweigerung gehört auch der Kunststreik. Mehrere Male wurde er ausgerufen, im Westen als auch im Osten Europas und in den USA. Einer hat in den 1970er Jahren eine der radikalsten und konkretesten Aufrufe verfasst. Für einen Zeitraum von drei Jahren forderte der deutschstämmige britische Künstler Gustav Metzger die komplette Einstellung der künstlerischen Produktion und Kollaboration mit dem Kunstbetrieb. Metzger Arbeiten entstanden stets vor dem Hintergrund eines ausgeprägten politischen Bewusstseins und der Befürchtung einer möglichen nuklearen Katastrophe. Insbesondere in seiner frühen Auto Destruktiven und Auto Kreativen Kunst hat er sich stets mit dem Wesen von Zerstörung und Neuschaffung beschäftig und formulierte hier konsequent eine radikale Abkehr von der Kunstproduktion als Kampfansage an gesellschaftliche Verhältnisse. Wie bei anderen, ist auch sein Streikaufruf missglückt im Sinne einer tatsächlichen kollektiven Aktion.
In diesem Text soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern der Kunststreik mit einem klassischen Streik der Lohnarbeiter zu vergleichen ist, welche Bedingungen für seinen Erfolg notwendig sind und ob er trotz äußeren Scheiterns Elemente beinhaltet, die eine Gültigkeit und Notwendigkeit im künstlerischen als auch gesellschaftlichen Sinne besitzt. Dabei wird anhand einzelner Textpassagen der Aufruf Metzgers mit Hilfe von Texten zur Streiktheorie untersucht um abschließend mit Blick auf die Praxis der französischen Intermettans sowie dem Potenzial in der zeitgenössischen Kunst wie z.B. beim Human Strike von Claire Fonataine, Verbindungen herzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Art into Society - Society into Art 1974
- Years without Art 1977 - 1980
- Streik
- Solidarität
- Bewusstsein
- Der Kunststreik und sein Erbe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht den Kunststreik als Form des Widerstands gegen den Kunstbetrieb und die gesellschaftlichen Verhältnisse. Er beleuchtet die Parallelen zum klassischen Streik der Lohnarbeiter und analysiert die Bedingungen für einen erfolgreichen Kunststreik. Darüber hinaus werden die historischen und theoretischen Grundlagen des Kunststreiks anhand von Texten zur Streiktheorie beleuchtet.
- Der Kunststreik als Form des Widerstands gegen den Kunstbetrieb
- Die Parallelen zum klassischen Streik der Lohnarbeiter
- Die Bedingungen für einen erfolgreichen Kunststreik
- Die historischen und theoretischen Grundlagen des Kunststreiks
- Die Relevanz des Kunststreiks in der zeitgenössischen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des Kunststreiks ein und stellt den Kontext des Textes dar. Sie beleuchtet die Tradition der Verweigerung in der Kunst und stellt den Kunststreik von Gustav Metzger als ein Beispiel für eine radikale Form des Widerstands vor.
Art into Society - Society into Art 1974
Dieses Kapitel beschreibt die Teilnahme von Gustav Metzger an der Ausstellung „Art into Society - Society into Art. Seven German Artist“ in London. Metzger verweigerte zunächst die Teilnahme an der Ausstellung, da er eine Vereinnahmung durch das Kunstsystem befürchtete. Er beschränkte seine Beteiligung auf einen Beitrag im Katalog und seine Präsenz während der Ausstellung.
Years without Art 1977 - 1980
Dieses Kapitel analysiert Metzgers Aufruf zum Kunststreik in seinem Text „Years without Art 1977 - 1980“. Metzger fordert Künstler dazu auf, für drei Jahre ihre Produktion einzustellen und jede Zusammenarbeit mit dem Kunstbetrieb zu verweigern. Er argumentiert, dass die Kunst durch die staatliche Förderung und die Verbindung zum Kapitalismus in ihrer Kritikfähigkeit eingeschränkt ist und zur Harmonisierung der Gesellschaft beiträgt.
Schlüsselwörter
Kunststreik, Kunstbetrieb, Gesellschaft, Politik, Verweigerung, Streiktheorie, Kunstproduktion, Kultur, Kapitalismus, Harmonisierung, Tradition, politische Kunst, zeitgenössische Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem Kunststreik?
Ein Kunststreik ist die bewusste Verweigerung der künstlerischen Produktion und der Zusammenarbeit mit dem Kunstbetrieb, oft als politischer Protest gegen gesellschaftliche Missstände oder den Kunstmarkt.
Wer war Gustav Metzger und was forderte er?
Gustav Metzger war ein britischer Künstler deutscher Herkunft. In den 1970er Jahren rief er zu einem dreijährigen Kunststreik auf, um die Verstrickung der Kunst in den Kapitalismus und das Wettrüsten zu kritisieren.
Ist ein Kunststreik mit einem klassischen Arbeiterstreik vergleichbar?
Die Arbeit untersucht Parallelen, stellt jedoch fest, dass Künstler oft keine klassischen Lohnarbeiter sind. Ein Kunststreik zielt eher auf die Entzug der kulturellen Legitimation des Systems ab.
Was ist „Auto-Destruktive Kunst“?
Ein von Metzger entwickeltes Konzept, bei dem die Zerstörung des Kunstwerks Teil des Schaffensprozesses ist, um auf die Destruktivität der modernen Gesellschaft und nukleare Bedrohungen hinzuweisen.
Warum scheiterten die meisten Aufrufe zum Kunststreik?
Häufig mangelt es an kollektiver Solidarität unter Künstlern, da der Kunstbetrieb stark auf individueller Sichtbarkeit basiert. Dennoch besitzen diese Aufrufe oft eine theoretische und ideelle Gültigkeit.
- Citation du texte
- Ina Hildebrandt (Auteur), 2015, Kunststreik.Verweigerung in der zeitgenössischen Kunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300286