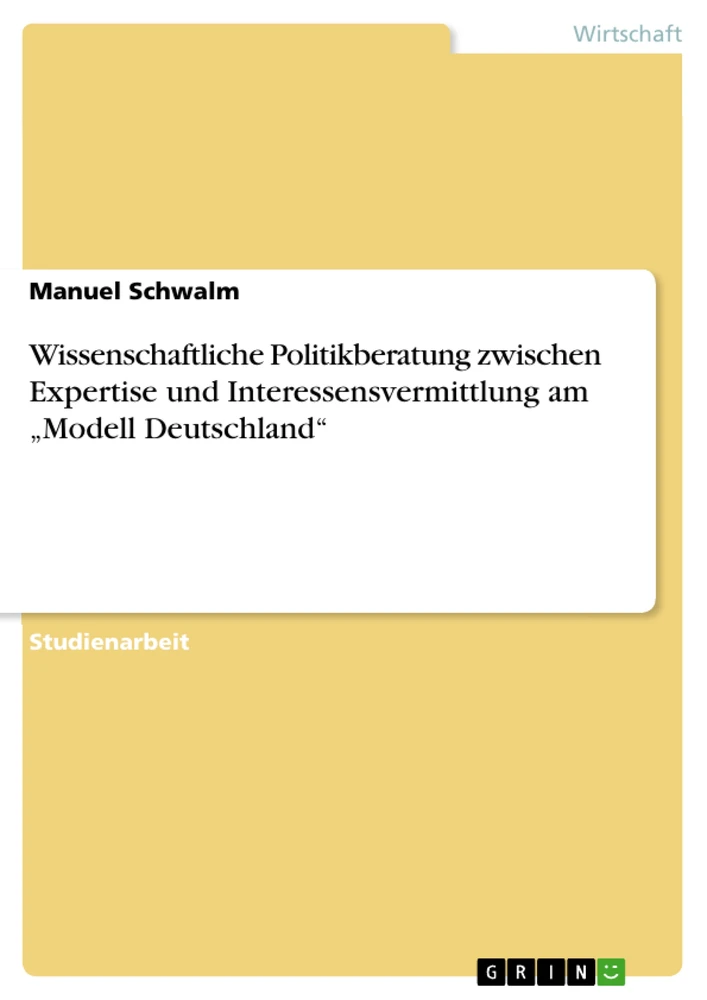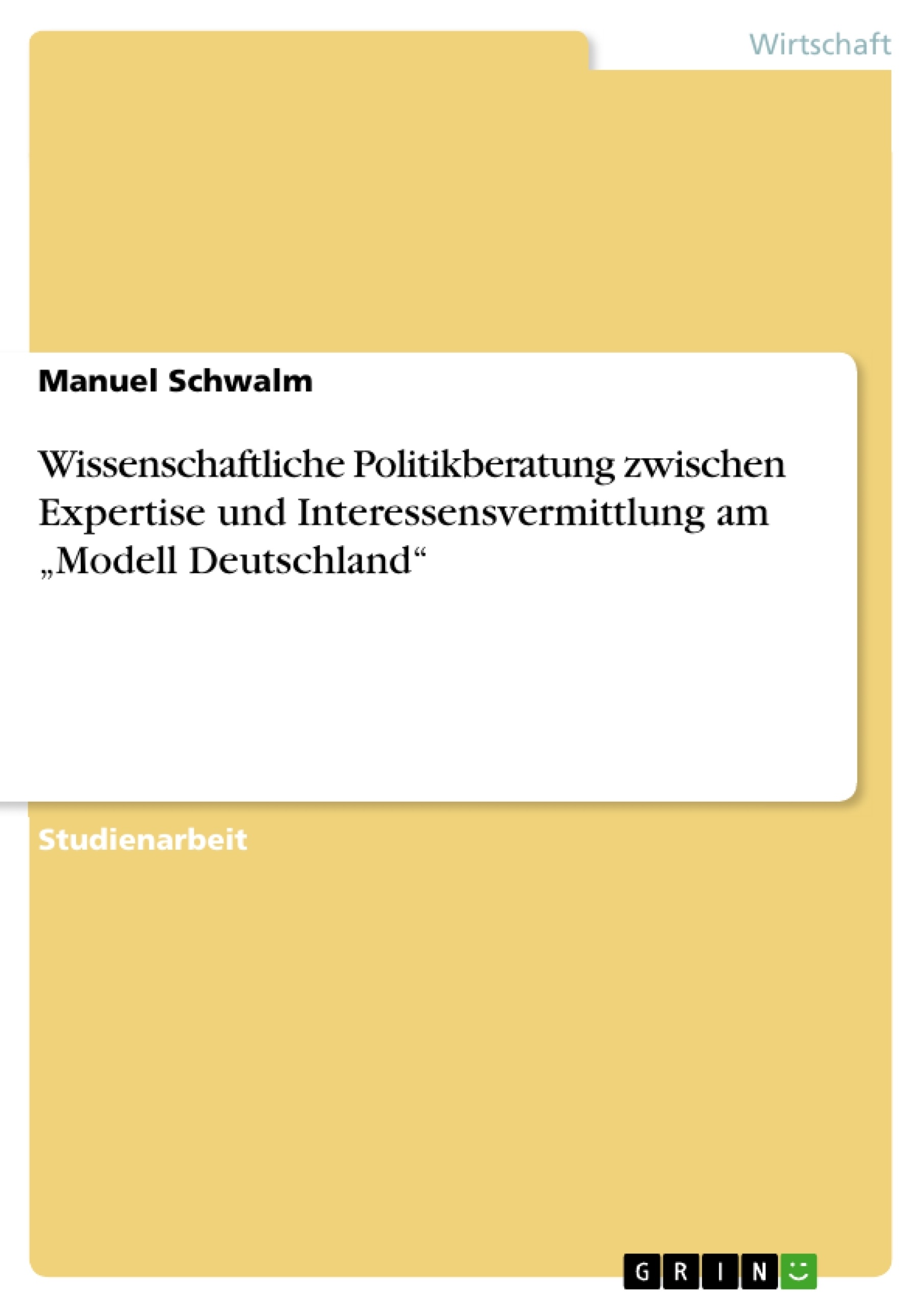Wissenschaftliche Politikberatung hat in Deutschland eine lange Tradition. Neben der Bereitstellung von fachlicher Expertise für die Vorbereitung von Entscheidungen stellen Expertengremien allerdings auch eine Arena der Interessensartikulation und -vermittlung von gesellschaftlichen Gruppen und Verbänden dar. Kommissionen, Räte oder Arbeitskreise sind somit in korporatistische Strukturen eingebunden. Die qualitative Einbindung in politische Entscheidungsprozesse als auch die quantitative Institutionalisierung dieser Gremien war stetigen Wandlungen unterworfen.
Die Gründung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (im Folgenden Sachverständigenrat) in der Mitte der 1960er Jahre, und die korporatistische Flankierung der durch ihn vorgeschlagenen konzertierten Aktion war sichtbares Zeichen der Hochphase von Expertengremien in politischen Entscheidungsprozessen. Die hohen Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht, was keineswegs zu einem Attraktivitätsverlust von konzertierter Reformpolitik geführt hat. In den 1990er Jahren wurde der Gedanke an einer tripartistisch besetzte Konzertierungsarena mit dem „Bündnis für Arbeit“ widerbelebt. Während es in den 1960er Jahren in der Endphase des so genannten „deutschen Wirtschaftswunders“ vor allen Dingen um verteilungspolitische Fragen ging, hatten sich mit der Massenarbeitslosigkeit die Vorbedingungen dramatisch gewandelt. Doch das Ergebnis blieb das gleiche, die konzertierte Aktion scheiterte erneut und stand somit sinnbildlich für die breite Kritik an der Reformunfähigkeit des einstmals so erfolgreichen „Modell Deutschlands“. Die umfassende Reform des Wohlfahrtsstaats gelang wiederum dennoch mit Hilfe einer Expertenkommission.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ausgehend von der Debatte und der Gründung des Sachverständigenrats in den 1960er Jahren, die Entwicklung von wissenschaftlicher Politikberatung und Interessensvermittlung nachzuzeichnen. Welchen Wandlungs-prozessen unterliegt das Verhältnis von Staat und Verbänden der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite? Insbesondere die Dynamik politischer Prozesse soll am Beispiel der Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (im Folgenden Hartz-Kommission) dargestellt werden. Wie und warum gelang der Umbau des Sozialstaates und war dafür tatsächlich die Expertise der Hartz-Kommission erforderlich, oder waren andere Faktoren entscheidend?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptionelle Grundlagen
- Expertengremien und wissenschaftliche Politikberatung
- Expertenkommissionen und Interessenvertretung im „Modell Deutschland“
- Der Sachverständigenrat
- Sachverständigenrat
- Das Scheitern des Systems Sachverständigenrat und tripartistischer Interessensvermittlung
- Die Hartz-Kommission
- Neuer Reformeifer
- Bündnis für Arbeit
- ,,Die Stunde der Praktiker“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung wissenschaftlicher Politikberatung und Interessensvermittlung in Deutschland seit den 1960er Jahren zu beleuchten, insbesondere im Kontext der Debatte um den Sachverständigenrat. Sie untersucht, wie sich das Verhältnis von Staat und Verbänden der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite im Laufe der Zeit gewandelt hat.
- Entwicklung der wissenschaftlichen Politikberatung in Deutschland
- Verhältnis von Staat und Verbänden der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite
- Rolle von Expertenkommissionen in politischen Entscheidungsprozessen
- Analyse der Hartz-Kommission und des Umbaus des Sozialstaates
- Funktion von Expertengremien als Arena der Interessensartikulation und -vermittlung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und beschreibt die Bedeutung wissenschaftlicher Politikberatung in Deutschland. Sie beleuchtet die Rolle von Expertengremien in der Entscheidungsfindung und die Herausforderungen, die sich aus der Verknüpfung von Expertise und Interessenvertretung ergeben.
- Konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die beiden wichtigsten Funktionen wissenschaftlicher Politikberatung: die Informationsfunktion und die Legitimierungs- und Verhandlungsfunktion. Es wird die Brücke zur Interessensvermittlung geschlagen und die Rolle von Expertenkommissionen in der Interessenvertretung erläutert.
- Der Sachverständigenrat: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gründung und dem Wirken des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Es analysiert die Erwartungen an den Sachverständigenrat und das Scheitern des Systems Sachverständigenrat in der tripartistischen Interessensvermittlung.
- Die Hartz-Kommission: Dieses Kapitel befasst sich mit der Hartz-Kommission und dem Umbau des Sozialstaates. Es analysiert den „neuen Reformeifer“ der 1990er Jahre, die Rolle des „Bündnisses für Arbeit“ und die Debatte um „Die Stunde der Praktiker“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche wissenschaftliche Politikberatung, Expertengremien, Interessensvertretung, „Modell Deutschland“, Sachverständigenrat, Hartz-Kommission, Sozialstaat, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sowie Reformpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Aufgaben hat die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland?
Sie stellt fachliche Expertise für politische Entscheidungen bereit (Informationsfunktion) und dient gleichzeitig als Arena für die Interessensvermittlung gesellschaftlicher Gruppen (Legitimationsfunktion).
Was ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung?
Ein in den 1960er Jahren gegründetes Expertengremium ("Wirtschaftsweise"), das die wirtschaftliche Lage analysiert und Empfehlungen für die Politik ausspricht.
Warum scheiterte die "Konzertierte Aktion" in den 1960er Jahren?
Trotz hoher Erwartungen gelang es nicht, die verteilungspolitischen Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern dauerhaft in einem harmonischen Rahmen zu lösen.
Welche Bedeutung hatte die Hartz-Kommission für den Sozialstaat?
Die Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz-Kommission) lieferte die Grundlage für umfassende Arbeitsmarktreformen, die als "Stunde der Praktiker" bezeichnet wurden.
Was bedeutet "Modell Deutschland" in diesem Kontext?
Es beschreibt das korporatistische System der engen Zusammenarbeit zwischen Staat, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, das lange Zeit als Garant für Stabilität und Wohlstand galt.
- Citation du texte
- Manuel Schwalm (Auteur), 2013, Wissenschaftliche Politikberatung zwischen Expertise und Interessensvermittlung am „Modell Deutschland“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300395