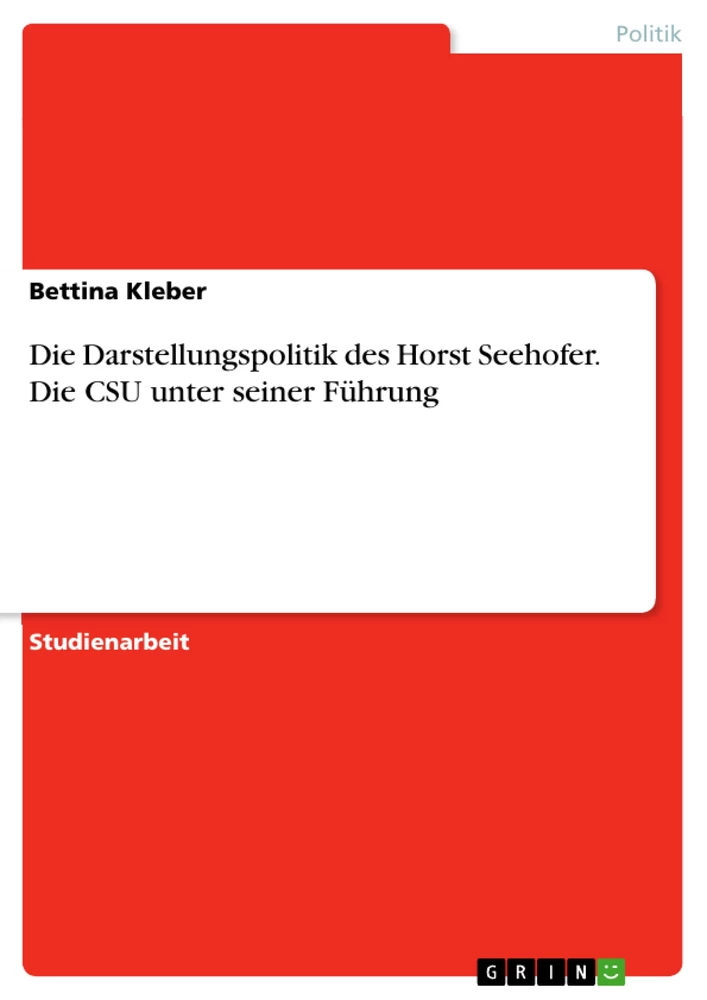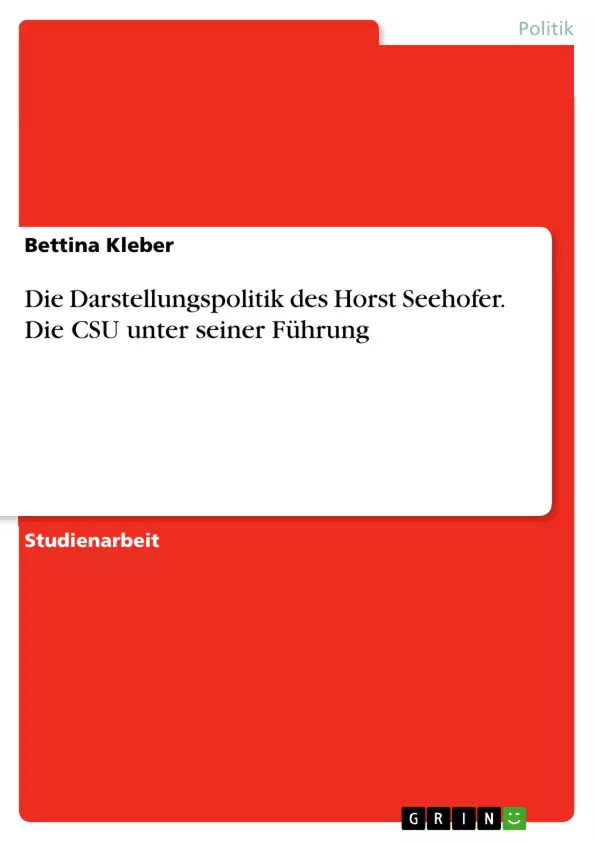In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie es dazu kam, dass Seehofer die Partei in den letzten zwei Jahren mit dem von ihm gewählten Politikstil des Machers nicht auf die ersehnten „50 plus X“ bringen konnte. Zur Beantwortung dieser Frage wird zuerst auf Karl-Rudolf Kortes Theorie eingegangen. Dabei werden Chancen und Risiken aufgezeigt.
In der Arbeit wird zuerst dargestellt, wie Seehofer im Laufe seiner Amtsführung über das Superwahljahr hinweg seinen Führungsstil zunehmend autoritärer ausgestaltete.
In einem weiteren Abschnitt wird Horst Seehofers Strategie beschrieben mittels Schwerpunktsetzung auf Telepolitik – und damit Darstellungspolitik – über die Bundespolitik den Koalitionspartner in Bayern zu schwächen, mit dem Ziel die Umfragewerte der CSU in Bayern zu steigern. Anschließend werden drei Beispiele aufgezeigt, die darlegen sollen, dass eine starke Prioritätensetzung auf Darstellungspolitik bei gleichzeitig ausbleibender Verknüpfung mit Entscheidungspolitik die Gefahr birgt, innerparteilich und in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit und Zustimmung zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Seehofer der Macher - Zwischen Machtwort, Telepolitik und Demoskopie
- Die CSU unter der strengen Führung des Horst Seehofer
- Der Amtsantritt von Horst Seehofer
- Das neue Kabinett
- Die Europawahl 2009 - Testlauf im «Super-Wahljahr»
- Vor den Bundestagswahlen 2009
- Bundestagswahl 2009
- Nach der Bundestagswahl bis Wildbad Kreuth
- Über die Bundespolitik zurück zur absoluten Mehrheit in Bayern?
- Wenn auf Worte keine Taten folgen - Das Eintreten der Gefahren einer Fehlenden Verbindung zwischen Darstellungspolitik und Entscheidungspolitik
- Quelle
- Klinikum Augsburg
- Bundeswehrreform
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die politischen Strategien von Horst Seehofer als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender im Kontext der Landtagswahl 2008 und der darauffolgenden Jahre. Sie untersucht, inwiefern Seehofers Politikstil des „Machers“ dazu beigetragen hat, die CSU wieder zu alter Stärke zu verhelfen und die ersehnten „50 plus X“ zu erreichen.
- Analyse von Seehofers Führungsstil und dessen Auswirkungen auf die CSU
- Bedeutung von Darstellungs- und Entscheidungspolitik im Kontext von Seehofers Strategien
- Untersuchung des Einflusses von Telepolitik auf die Bundespolitik und den Koalitionspartner in Bayern
- Bewertung der Risiken und Chancen von Seehofers Politikstil
- Auswirkungen von Seehofers Strategien auf die Umfragewerte der CSU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation nach der Landtagswahl 2008 dar und führt die wichtigsten Akteure und Ereignisse ein. Kapitel 2 beleuchtet Seehofers Politikstil des „Machers“ und setzt ihn in den Kontext von Karl-Rudolf Kortes Theorie der Darstellungs- und Entscheidungspolitik. Kapitel 3 analysiert die Entwicklungen innerhalb der CSU unter Seehofers Führung, beginnend mit seinem Amtsantritt bis hin zu den Bundestagswahlen 2009. Kapitel 4 betrachtet Seehofers Strategie, die Bundespolitik zu nutzen, um die Umfragewerte der CSU in Bayern zu steigern. Kapitel 5 beleuchtet die Gefahren einer starken Fokussierung auf Darstellungspolitik ohne ausreichende Verknüpfung mit Entscheidungspolitik, anhand von drei konkreten Beispielen.
Schlüsselwörter
CSU, Horst Seehofer, Darstellungspolitik, Entscheidungspolitik, Telepolitik, Macher, Führungsstil, Landtagswahl 2008, Bundestagswahl 2009, Koalition, Umfragewerte, Bayern, Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Horst Seehofers "Politikstil des Machers"?
Dieser Stil ist geprägt von einem autoritären Führungsanspruch, schnellen Richtungsentscheidungen und einer starken medialen Inszenierung als entscheidungsfreudiger Politiker.
Was ist der Unterschied zwischen Darstellungspolitik und Entscheidungspolitik?
Darstellungspolitik (Telepolitik) zielt auf die mediale Wirkung und Umfragewerte ab. Entscheidungspolitik umfasst das tatsächliche Regierungshandeln und die Umsetzung von Gesetzen.
Warum erreichte die CSU unter Seehofer nicht die angestrebten "50 plus X"?
Die Arbeit analysiert, dass eine zu starke Priorisierung der Darstellungspolitik bei ausbleibenden Taten zu einem Glaubwürdigkeitsverlust in der Öffentlichkeit führte.
Welche Rolle spielte Seehofers Strategie in der Bundespolitik?
Seehofer nutzte bundespolitische Themen, um den Koalitionspartner in Bayern zu schwächen und das Profil der CSU als eigenständige Kraft zu schärfen.
Welche Beispiele für fehlende Entscheidungspolitik werden genannt?
Die Arbeit nennt unter anderem die Diskussionen um das Klinikum Augsburg und die Bundeswehrreform als Beispiele für die Kluft zwischen Worten und Taten.
- Citar trabajo
- Bettina Kleber (Autor), 2010, Die Darstellungspolitik des Horst Seehofer. Die CSU unter seiner Führung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300396