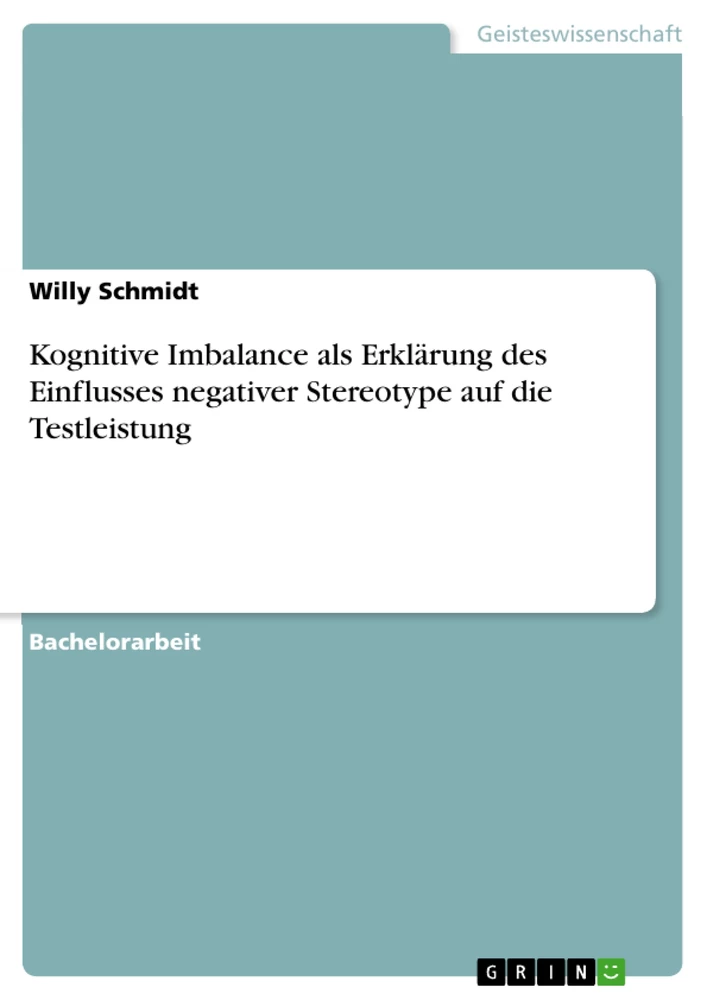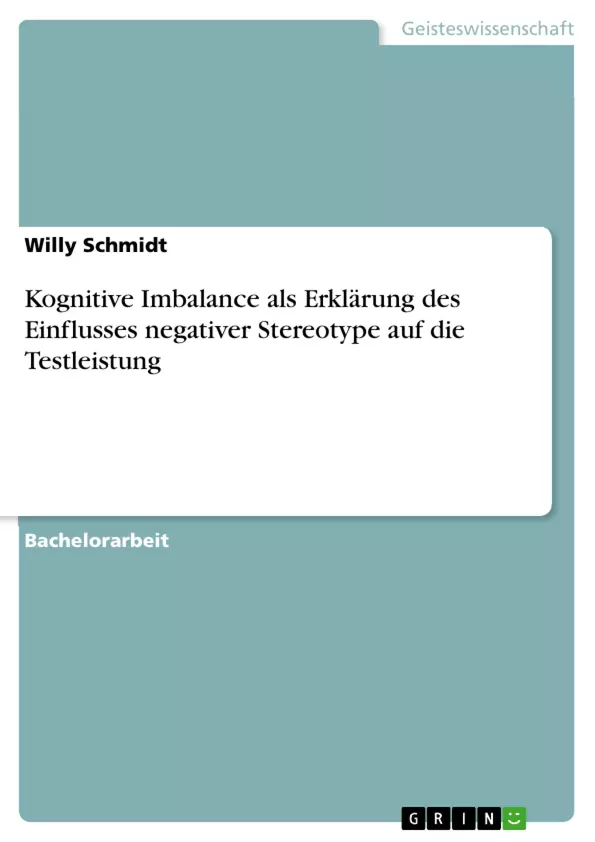Steele und Aronson (1995) beschrieben erstmals das Stereotype Threat-Phänomen als Bedrohung der Leistung aufgrund eines negativen Stereotyps. Schmader, Johns und Forbes (2008) präsentieren ein Modell zur Erklärung der leistungsmindernden Wirkung negativer Stereotype auf die Testleistung und integrieren, neben einen aktivierten negativen Stereotyp, die zwei Moderatoren „Identifikation mit der Gruppe“ und „Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich“. Sie beschreiben eine kognitive Imbalance aufgrund dieser als das Stereotype Threat-Phänomen und postulieren eine schlechtere Leistung als in einer kognitiven Balance. Diese Studie untersucht den angenommenen Einfluss der Interaktion beider Moderatoren bei einem aktivierten negativen Stereotyp auf die Testleistung und erweitert die Annahmen von Schmader et al. (2008) auf die Vergleiche der Leistung zwischen allen möglichen Kombinationen der Identifikation mit der Gruppe und dem Fähigkeitsbereich (niedrig vs. hoch). Gemessen wurde die Leistung von 34 Personen in einem Merkfähigkeitstest unter den möglichen Bedingungen (kognitive Imbalance, kognitive Balance und eine unbeschriebene Bedingung). Die Ergebnisse sprechen gegen eine Interaktion der Moderatoren und der vermuteten besseren Leistung in einer kognitiven Balance-Bedingung gegenüber einer kognitiven Imbalance-Bedingung. Lediglich eine über die Annahmen von Schmader et al. (2008) hinaus getätigte Hypothese konnte bestätigt werden: Personen mit einer niedrigen Identifikation mit der Eigengruppe und einer hohen Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich weisen im Mittel bei einem aktivierten negativen Stereotyp eine bessere Leistung auf als Personen mit einer niedrigen Identifikation mit der Eigengruppe und dem Fähigkeitsbereich.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Ziele
- 2 Theoretische Grundlagen und empirischer Erkenntnisstand
- 2.1 Stereotype Threat
- 2.1.1 Identifikation mit der Gruppe als Moderator für Stereotype Threat
- 2.1.2 Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich als Moderator für Stereotype Threat
- 2.2 Integratives Prozess-Modell nach Schmader et al. (2008)
- 2.3 Kognitive Imbalance als Erklärung für die Leistungsminderung unter Stereotype Threat
- 2.3.1 Kognitiv, physiologisch und affektiv das Arbeitsgedächtnis beeinflussende Prozesse
- 2.3.2 Das Arbeitsgedächtnis und Stereotype Threat
- 3 Fragestellung und Hypothesen
- 4 Methoden
- 4.1 Stichprobenbeschreibung und Design
- 4.2 Untersuchungsmaterialien
- 4.2.1 Cover-Story
- 4.2.2 Selbstkategorisierung, Kategorisierungstest und Erhebung der Identifikation mit der Gruppe
- 4.2.3 Manipulation und Erhebung der Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich
- 4.2.4 Aktivierung des negativen Stereotyps
- 4.2.5 Modifizierter Zahlen-Symbol-Test
- 4.3 Ablauf
- 4.4 Statistische Verfahren
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Überprüfung der Gruppenzuordnung und der Identifikation mit der Gruppe
- 5.2 Überprüfung der Manipulation der Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich
- 5.3 Überprüfung des negativen Stereotyps
- 5.4 Überprüfung der Hypothesen
- 6 Diskussion
- 6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.2 Interpretation der Ergebnisse
- 6.3 Methodenkritik
- 6.4 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss negativer Stereotype auf die Testleistung. Im Zentrum steht die Frage, wie kognitive Imbalance, die durch die Aktivierung eines negativen Stereotyps entsteht, die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Modelle und empirische Erkenntnisse zu Stereotype Threat und untersucht, wie Identifikation mit der Gruppe und dem Fähigkeitsbereich als Moderatoren wirken.
- Stereotype Threat als Erklärung für die Leistungsminderung
- Kognitive Imbalance als Mechanismus des Stereotype Threat
- Identifikation mit der Gruppe und dem Fähigkeitsbereich als Moderatoren
- Empirische Untersuchung des Einflusses negativer Stereotype auf die Testleistung
- Diskussion der Ergebnisse und ihrer Implikationen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und einer Definition des Forschungsziels. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen und den empirischen Erkenntnisstand zum Thema Stereotype Threat, wobei verschiedene Modelle und Moderatoren diskutiert werden. Kapitel 3 stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen vor. Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Untersuchung, inklusive Stichprobenbeschreibung, Untersuchungsmaterialien und -ablauf. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, wobei die Überprüfung der Gruppenzuordnung, der Manipulation und des negativen Stereotyps sowie die Überprüfung der Hypothesen im Fokus stehen. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse, interpretiert diese im Kontext der theoretischen Grundlagen und beleuchtet methodische Limitationen. Abschließend werden Ausblicke auf zukünftige Forschung gegeben.
Schlüsselwörter
Stereotype Threat, kognitive Imbalance, Identifikation, Arbeitsgedächtnis, Testleistung, empirische Forschung, Moderatoren, Leistungsbeeinträchtigung, negative Stereotype.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Stereotype Threat“-Phänomen?
Es beschreibt die Verschlechterung der Leistung einer Person in einer Testsituation, wenn sie befürchtet, ein negatives Stereotyp über ihre soziale Gruppe zu bestätigen.
Wie führt kognitive Imbalance zu schlechteren Leistungen?
Die psychologische Spannung zwischen der Identifikation mit der Gruppe und dem Wunsch nach Erfolg belastet das Arbeitsgedächtnis und mindert so die Konzentrationsfähigkeit.
Welche Moderatoren beeinflussen den Stereotype Threat?
Die zentralen Moderatoren sind die „Identifikation mit der Gruppe“ und die „Identifikation mit dem Fähigkeitsbereich“.
Was war das Ergebnis der Studie zum Merkfähigkeitstest?
Entgegen der Erwartung von Schmader et al. zeigten Personen mit niedriger Gruppenidentifikation, aber hoher Fähigkeitsidentifikation, die besten Leistungen unter Stereotyp-Aktivierung.
Wie wirkt sich Stereotype Threat auf das Arbeitsgedächtnis aus?
Physiologische und affektive Prozesse (wie Stress) beanspruchen Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses, die dann für die eigentliche Testaufgabe fehlen.
- Quote paper
- Willy Schmidt (Author), 2013, Kognitive Imbalance als Erklärung des Einflusses negativer Stereotype auf die Testleistung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300400