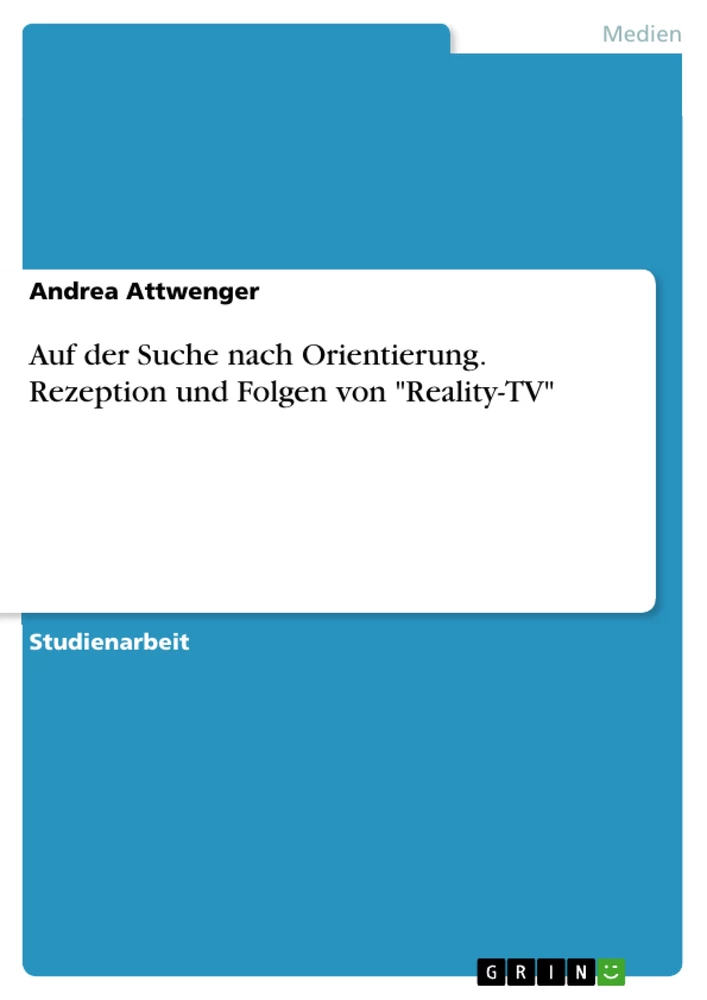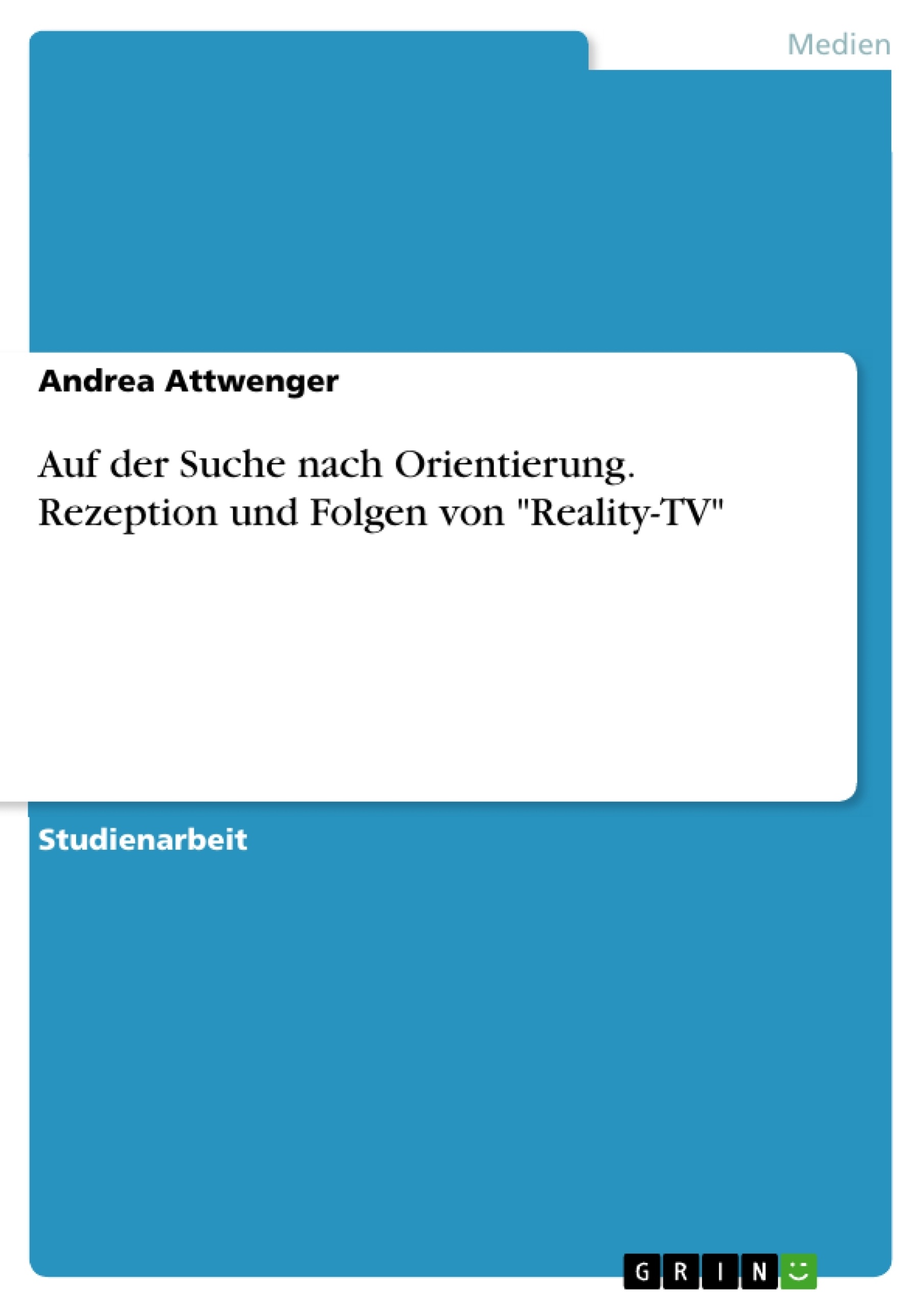Mit der zunehmenden Verbreitung von "Reality-TV"-Formaten werden auch die Fragen, warum die Zuseher solche, teils menschenverachtenden Sendungen ansehen und welche Auswirkungen diese Sendungen haben, immer häufiger diskutiert.
Die empirische Forschung konzentriert sich dabei häufig auf die Nutzungsmotive und die Wahrnehmung von Kindern und Jugendlichen, da gerade hier die Sorge besteht, diese könnten durch derartige Formate negativ beeinflusst werden.
Diese Arbeit konzentriert sich auf das von Paus-Haase et al identifizierte Rezeptionsmuster „Suche nach Orientierung“ und untersucht, wie sich diese Suche manifestiert und welche Verhaltensweisen Rezipienten zeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auf der Suche nach Orientierung
- Parasoziale Interaktion und parasoziale Beziehungen
- Identifikation
- Sozialer Vergleich
- Nachahmung und Lerneffekte
- Anschlusskommunikation
- Empirische Forschungsergebnisse
- Der Aufbau parasozialer Beziehungen
- Der Wunsch nach Alltagstauglichkeit
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Involvierende und distanzierte Rezeption
- Unterschiedliche Themenorientierung
- Orientierung, Lernen und Nachahmung
- Reality-TV-Formate als vielfältiges Orientierungsangebot
- Symbolische und konkrete Lerninhalte
- Spielerische Nachahmung
- Anschlusskommunikation in der Peergroup
- Der Umgang mit Inszenierung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Rezeptionsmotiv der „Suche nach Orientierung“ im Kontext von Reality-TV-Formaten. Die Arbeit untersucht, wie sich diese Suche manifestiert und welche Verhaltensweisen Rezipienten zeigen.
- Parasoziale Interaktion und parasoziale Beziehungen
- Identifikation mit Medienfiguren
- Sozialer Vergleich mit den dargestellten Personen
- Lernen und Nachahmung von Verhaltensweisen
- Anschlusskommunikation in der Peergroup
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Relevanz der Forschung zu Reality-TV-Formaten, insbesondere im Hinblick auf die Rezeption durch Kinder und Jugendliche. Sie stellt verschiedene Rezeptionsmuster vor, die in der empirischen Forschung identifiziert wurden, und fokussiert auf die „Suche nach Orientierung“ als zentrales Thema der Arbeit.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Rezeptionsmotiv „Suche nach Orientierung“ und analysiert dessen Bedeutung und mögliche Auswirkungen. Es werden verschiedene Merkmale und Verhaltensweisen vorgestellt, die bei orientierungssuchenden Zuschauern auftreten, insbesondere im Zusammenhang mit einer naiv-involvierenden Rezeptionshaltung.
Das dritte Kapitel präsentiert empirische Forschungsergebnisse, die den Aufbau parasozialer Beziehungen, den Wunsch nach Alltagstauglichkeit, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rezeption, Orientierung, Lernen und Nachahmung sowie die Anschlusskommunikation in der Peergroup beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Reality-TV, Rezeption, Orientierung, parasoziale Interaktion, Identifikation, sozialer Vergleich, Lernen und Nachahmung, sowie Anschlusskommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Rezeptionsmuster „Suche nach Orientierung“?
Es handelt sich um ein Motiv, bei dem Zuschauer Reality-TV nutzen, um soziale Vergleiche anzustellen, Verhaltensweisen zu lernen und Orientierung für ihren eigenen Alltag zu finden.
Was versteht man unter parasozialer Interaktion?
Dies beschreibt die einseitige Beziehung, die Zuschauer zu Medienfiguren aufbauen, wobei sie diese oft wie reale Bekannte wahrnehmen.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Reality-TV-Nutzung?
Ja, die Forschung zeigt Unterschiede in der involvierenden oder distanzierten Rezeption sowie in der Themenorientierung zwischen männlichen und weiblichen Zuschauern.
Wie wirkt sich Reality-TV auf das Lernen aus?
Reality-TV-Formate bieten symbolische und konkrete Lerninhalte, die zur spielerischen Nachahmung von Verhaltensweisen führen können.
Was ist Anschlusskommunikation?
Damit ist das Gespräch über die gesehenen Sendungen innerhalb der Peergroup (z.B. im Freundeskreis) gemeint, welches der sozialen Positionierung dient.
- Citation du texte
- Andrea Attwenger (Auteur), 2014, Auf der Suche nach Orientierung. Rezeption und Folgen von "Reality-TV", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300426